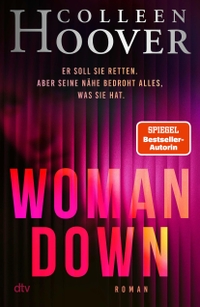Magazinrundschau
Digitale Medienmodelle
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
26.10.2010. Die Digitalisierung wird das Verlagswesen nicht umbringen, aber auf den Kopf stellen, meint Prospect. Esprit fragt sich, warum Wallonen und Flamen sich ausgerechnet über die Burka einigen können. Outlook India fühlt den Puls einer siechen Presse. In Slate findet es Anne Applebaum ganz logisch, wie unterschiedlich Briten und Franzosen auf die Krise reagieren. Die New York Times porträtiert die liberische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf. Salon.com besucht ein ghanaisches Hexenlager.
Prospect (UK), 01.11.2010
 Tom Chatfield denkt in einem sehr instruktiven, kritischen, aber nicht kulturpessimistischen Artikel über die strukturellen Veränderungen nach, die die Digitalisierung des Buchmarkts mit sich bringt. Er unterhält sich mit Autorinnen und Autoren, er erklärt, warum die Genre-Literatur der Gewinner der Umwälzungen ist und erst recht sein wird und er erläutert, warum die Prinzipien des Verlagswesens in näherer Zukunft auf den Kopf gestellt werden dürften: "Es war im Verlagswesen stets so - wie übrigens beim Kino auch -, dass eine kleine Zahl von Hits den Großteil der Einnahmen bringt und es den Produzenten so möglich macht, auf den Erfolg zukünftiger Produktionen zu wetten. Was aber, wenn dieses Glücksspiel um den Erfolg nicht mehr nötig wäre? Die Basis des Verlagswesens liegt darin, dass der Verleger den Zugang zu einer knappen, wertvollen Ressource kontrolliert - dem Druck. Digitale Medienmodelle jedoch, bei denen die Kosten der Veröffentlichung und Reproduktion fast bei Null liegen, funktionieren tendenziell genau umgekehrt: Das Material wird erst publiziert, dann beginnt der Auswahlprozess unter den Lesern. So wichtig die traditionellen Modelle der kennerschaftlichen Auswahl scheinen: Man kommt kaum umhin, sich hier eine Logik etablieren zu sehen, die auf anderen Feldern schon durchgesetzt ist. Wirf so viel Material wie nur möglich vors Publikum und lass sie selbst entscheiden. Und versuche dann, sobald sich etwas wie ein Hit abzeichnet, den Erfolg rücksichtslos zu maximieren."
Tom Chatfield denkt in einem sehr instruktiven, kritischen, aber nicht kulturpessimistischen Artikel über die strukturellen Veränderungen nach, die die Digitalisierung des Buchmarkts mit sich bringt. Er unterhält sich mit Autorinnen und Autoren, er erklärt, warum die Genre-Literatur der Gewinner der Umwälzungen ist und erst recht sein wird und er erläutert, warum die Prinzipien des Verlagswesens in näherer Zukunft auf den Kopf gestellt werden dürften: "Es war im Verlagswesen stets so - wie übrigens beim Kino auch -, dass eine kleine Zahl von Hits den Großteil der Einnahmen bringt und es den Produzenten so möglich macht, auf den Erfolg zukünftiger Produktionen zu wetten. Was aber, wenn dieses Glücksspiel um den Erfolg nicht mehr nötig wäre? Die Basis des Verlagswesens liegt darin, dass der Verleger den Zugang zu einer knappen, wertvollen Ressource kontrolliert - dem Druck. Digitale Medienmodelle jedoch, bei denen die Kosten der Veröffentlichung und Reproduktion fast bei Null liegen, funktionieren tendenziell genau umgekehrt: Das Material wird erst publiziert, dann beginnt der Auswahlprozess unter den Lesern. So wichtig die traditionellen Modelle der kennerschaftlichen Auswahl scheinen: Man kommt kaum umhin, sich hier eine Logik etablieren zu sehen, die auf anderen Feldern schon durchgesetzt ist. Wirf so viel Material wie nur möglich vors Publikum und lass sie selbst entscheiden. Und versuche dann, sobald sich etwas wie ein Hit abzeichnet, den Erfolg rücksichtslos zu maximieren."Outlook India (Indien), 01.11.2010
 Outlook feiert seinen fünfzehnten Geburtstag und hat das aktuelle Heft ganz der Presse gewidmet. Im Interview erklärt Noam Chomsky, warum er rein gar nichts von der Presse hält. Sie dient nur dazu, die Leute dumm zu halten. "Das ist ganz klar ihr Ziel. Tatsächlich ist es ihr erklärtes Ziel. In den 1920er Jahren bezeichnete man sie ganz offen als Propaganda. Aber dieses Wort bekam durch die Nazis einen schlechten Klang. Jetzt nennt man sie nicht mehr Propaganda. Die riesige Public-Relations-Industrie zum Beispiel hat das Ziel, Einstellungen und Überzeugungen zu kontrollieren. Liberale Kommentatoren wie Walter Lippmann meinten, wir müssen Konsens produzieren und den Pöbel draußen halten. Wir sind die verantwortlichen Männer, wir müssen die Entscheidungen treffen und wir müssen davor beschützt werden - ich zitiere Lippmann - 'von der verwirrten Herde, der Öffentlichkeit, niedergetrampelt zu werden'. In einem demokratischen Prozess sind wir Beteiligte, sie gucken zu. Und die Aufgabe der Intellektuellen, der Medien und so weiter, ist es sicherzustellen, dass sie still sind, geduckt und gehorsam. Das ist der Blick vom liberalen Ende des Spektrums."
Outlook feiert seinen fünfzehnten Geburtstag und hat das aktuelle Heft ganz der Presse gewidmet. Im Interview erklärt Noam Chomsky, warum er rein gar nichts von der Presse hält. Sie dient nur dazu, die Leute dumm zu halten. "Das ist ganz klar ihr Ziel. Tatsächlich ist es ihr erklärtes Ziel. In den 1920er Jahren bezeichnete man sie ganz offen als Propaganda. Aber dieses Wort bekam durch die Nazis einen schlechten Klang. Jetzt nennt man sie nicht mehr Propaganda. Die riesige Public-Relations-Industrie zum Beispiel hat das Ziel, Einstellungen und Überzeugungen zu kontrollieren. Liberale Kommentatoren wie Walter Lippmann meinten, wir müssen Konsens produzieren und den Pöbel draußen halten. Wir sind die verantwortlichen Männer, wir müssen die Entscheidungen treffen und wir müssen davor beschützt werden - ich zitiere Lippmann - 'von der verwirrten Herde, der Öffentlichkeit, niedergetrampelt zu werden'. In einem demokratischen Prozess sind wir Beteiligte, sie gucken zu. Und die Aufgabe der Intellektuellen, der Medien und so weiter, ist es sicherzustellen, dass sie still sind, geduckt und gehorsam. Das ist der Blick vom liberalen Ende des Spektrums."Sumir Lal beschreibt den Niedergang der indischen Zeitungen seit Mitte der achtziger Jahre: heute verkaufen sie ihre Anzeigenplätze an kommerzielle Kunden, nicht Neuigkeiten an Leser. Laut Lal gehört der Medienmogul Ravi Dhariwal (Times of India) zu den Verantwortlichen für diesen Niedergang und wenn man das Interview mit ihm liest, ist das nicht ganz unglaubwürdig. Paranjoy Guha Thakurta beklagt, dass die Korruption der indischen Medien inzwischen institutionalisiert ist: Zeitungen und Fernsehsender verbreiten für Geld Informationen, die als 'Neuigkeiten' ausgegeben werden, tatsächlich aber den Interessen einzelner Personen, Firmen oder Politiker dienen. Shashi Tharoor würde gern mehr über Politik statt Liebesaffären lesen. Vielleicht könnten die Medien von der Filmindustrie lernen, meint Amrita Shah. Roy Greenslade ist überzeugt, dass der Journalismus im Internet überleben wird, wenn er sich neu definiert.
New Yorker (USA), 01.11.2010
 Muss Amerika vor einem Cyber-Krieg Angst haben? Dieser Frage geht Seymour M. Hersh in seiner Recherche über mögliche Attacken nach, die über das Netz gesteuert werden. Die Befürchtungen werden allerdings oft übertrieben und beruhen oft auf "grundlegenden Verwechslung von Cyber-Spionage und Cyber-Kriegsführung", so Hersh. "Das verbreitetste Schreckensszenario betrifft das amerikanische Stromversorgungsnetz. Selbst der eifrigste Datenschützer würde nicht abstreiten, dass Verbesserungen zu dessen Sicherheit erforderlich sind. Allerdings gibt es keinen dokumentierten Fall einer durch eine Netzattacke erzwungenen Stromabschaltung. Und die cartoonartige Sichtweise, ein Hacker könnte per Knopfdruck im ganzen Land das Licht ausknipsen, ist schlicht falsch. Es gibt gar kein nationales Stromversorgungsnetz in den USA, sondern Hunderte öffentliche und private Anbieter mit eigenen Leitungen, Computersystemen und Sicherheitseinrichtungen."
Muss Amerika vor einem Cyber-Krieg Angst haben? Dieser Frage geht Seymour M. Hersh in seiner Recherche über mögliche Attacken nach, die über das Netz gesteuert werden. Die Befürchtungen werden allerdings oft übertrieben und beruhen oft auf "grundlegenden Verwechslung von Cyber-Spionage und Cyber-Kriegsführung", so Hersh. "Das verbreitetste Schreckensszenario betrifft das amerikanische Stromversorgungsnetz. Selbst der eifrigste Datenschützer würde nicht abstreiten, dass Verbesserungen zu dessen Sicherheit erforderlich sind. Allerdings gibt es keinen dokumentierten Fall einer durch eine Netzattacke erzwungenen Stromabschaltung. Und die cartoonartige Sichtweise, ein Hacker könnte per Knopfdruck im ganzen Land das Licht ausknipsen, ist schlicht falsch. Es gibt gar kein nationales Stromversorgungsnetz in den USA, sondern Hunderte öffentliche und private Anbieter mit eigenen Leitungen, Computersystemen und Sicherheitseinrichtungen."Besprochen wird das Buch "Overhaul" des Investors und Beraters des amerikanischen Finanzministers für die Automobilindustrie Steven Rattner, in dem er die Rettung von General Motors beschreibt.
Eurozine (Österreich), 18.10.2010
 Die Belgier sind bekanntlich zerstritten. Aber gegen die Burka stimmte das belgische Parlament wie ein Mann. Das findet Paul Doumouchel in der linkskatholischen Zeitschrift Esprit verdächtig. Sein Artikel wurde von Eurozine übernommen. "Auch die Assemblee nationale hat am 11. Mai einstimmig für das Verbot des Ganzkörperschleiers gestimmt. Normalerweise sind Abgeordnete zerstritten. Nur in ganz schweren Krisen legen sie ihre Streitigkeiten beiseite. So gesehen ist es recht amüsant zu sehen, dass westliche Demokratien ihre üblichen Auseinandersetzungen ruhen lassen und in eine Union sacree zusammenstehen, um eine Gefahr abzuwehren, die ganz Europa bedroht... ein paar verschleierte Frauen! Oder genauer: es wäre amüsant - wenn es nicht so berunruhigend wäre."
Die Belgier sind bekanntlich zerstritten. Aber gegen die Burka stimmte das belgische Parlament wie ein Mann. Das findet Paul Doumouchel in der linkskatholischen Zeitschrift Esprit verdächtig. Sein Artikel wurde von Eurozine übernommen. "Auch die Assemblee nationale hat am 11. Mai einstimmig für das Verbot des Ganzkörperschleiers gestimmt. Normalerweise sind Abgeordnete zerstritten. Nur in ganz schweren Krisen legen sie ihre Streitigkeiten beiseite. So gesehen ist es recht amüsant zu sehen, dass westliche Demokratien ihre üblichen Auseinandersetzungen ruhen lassen und in eine Union sacree zusammenstehen, um eine Gefahr abzuwehren, die ganz Europa bedroht... ein paar verschleierte Frauen! Oder genauer: es wäre amüsant - wenn es nicht so berunruhigend wäre."New York Review of Books (USA), 11.11.2010
 Die Historikerin Anne Applebaum würdigt ausführlich Timothy Snyders Studie "Bloodlands" über die Massenmorde in Osteuropa unter Hitler und Stalin. Eigentlich sollte man Genozid sagen, und zwar zu beidem, meint sie nach der begleitenden Lektüre von Norman M. Naimarks Buch "Stalin's Genocides". Bis vor kurzem "galt es im Westen als politisch inkorrekt zuzugeben, dass wir den einen genozidalen Diktator mit Hilfe des anderen besiegt haben. Erst jetzt, seit so viel Material aus sowjetischen und zentraleuropäischen Archiven publiziert wird, wird der Umfang der sowjetischen Massenmorde im Westen besser bekannt. In den letzten Jahren haben einige Länder aus dem früheren Einflussgebiet der Sowjetunion - vor allem die baltischen Staaten und die Ukraine - angefangen, das Wort 'Genozid' in offiziellen Dokumenten zu benutzen, um die sowjetischen Massentötungen zu beschreiben. Naimarks kurzes Buch ist ein polemischer Beitrag zu dieser Debatte. Auch wenn er die dubiose politische Geschichte der UN-Konvention kennt, argumentiert er weiter, dass selbst nach der jetzigen Definition Stalins Angriff auf die Kulaken und die ukrainischen Bauern als Genozid gewertet wrden sollte. Ebenso Stalins gezielte Kampagnen gegen einzelne ethnische Gruppen.
Die Historikerin Anne Applebaum würdigt ausführlich Timothy Snyders Studie "Bloodlands" über die Massenmorde in Osteuropa unter Hitler und Stalin. Eigentlich sollte man Genozid sagen, und zwar zu beidem, meint sie nach der begleitenden Lektüre von Norman M. Naimarks Buch "Stalin's Genocides". Bis vor kurzem "galt es im Westen als politisch inkorrekt zuzugeben, dass wir den einen genozidalen Diktator mit Hilfe des anderen besiegt haben. Erst jetzt, seit so viel Material aus sowjetischen und zentraleuropäischen Archiven publiziert wird, wird der Umfang der sowjetischen Massenmorde im Westen besser bekannt. In den letzten Jahren haben einige Länder aus dem früheren Einflussgebiet der Sowjetunion - vor allem die baltischen Staaten und die Ukraine - angefangen, das Wort 'Genozid' in offiziellen Dokumenten zu benutzen, um die sowjetischen Massentötungen zu beschreiben. Naimarks kurzes Buch ist ein polemischer Beitrag zu dieser Debatte. Auch wenn er die dubiose politische Geschichte der UN-Konvention kennt, argumentiert er weiter, dass selbst nach der jetzigen Definition Stalins Angriff auf die Kulaken und die ukrainischen Bauern als Genozid gewertet wrden sollte. Ebenso Stalins gezielte Kampagnen gegen einzelne ethnische Gruppen. Supermagnat Georges Soros fordert von der amerikanischen Regierung ein gewaltiges - von der Opposition allerdings verteufeltes - Konjunkturprogramm, das nicht den Konsum, sondern Investionen ankurbelt: "Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist überzeugt, dass die Regierung unfähig ist, Investitionen effizient zu managen. Dieser Einstellung ist nicht ganz ungerechtfertigt: 25 Jahre wurde die Regierung miesgemacht, jetzt haben wir eine miese Regierung. Aber die Behauptung, dass Staatsausgaben unausweichlich vergeudet sind, ist falsch."
Weiteres: Gar nichts hält Diane Ravitch von Davis Guggenheims Dokumentarfilm "Waiting for Superman", der davon erzählt, wie sehnsüchtig fünf Schüler darauf hoffen, es endlich von ihren öffentlichen Schulen zu einer halbprivaten Charter School zu schaffen. Cathleen Schine preist Jenniger Egans Roman "A Visit from the Goon Squad". Jonathan Mirsky würdigt Friedensnobelpreitsräger Liu Xiaobo. Und Daniel Mendelsohn liest Oscar Wilde.
Salon.com (USA), 24.10.2010
Mit großem Interesse hat Laura Miller ein Buch über westafrikanische Hexenlager gelesen. Soll niemand glauben, es handele sich um ein völlig abseitiges Thema: Allein im Lager von Gambaga, Ghana, leben 3.000 der Hexerei beschuldigter Frauen, die aus ihren Heimatorten vertrieben wurden. "Bei ihrer Recherche hat die kanadische Journalistin Karen Palmer festgestelllt, dass der Glaube an Hexerei oft ganz handfeste Gründe hat. Die Hexenlager sind "das Ergebnis einer Stammesgesellschaft auf der Suche nach einem Sündenbock. 'In Afrika sollte jedes Missgeschick - alles, was geschieht - einen Grund haben', erklärt ihr einer ihrer Übersetzer. Krankheit, Naturkatastrophen, Unfälle - all diese Dinge werden mit großer Wahrscheinlichkeit den schwächsten Mitgliedern der Dorfgemeinschaft angelastet: Frauen, die aus dem gebärfähigen Alter heraus sind und keine einflussreichen männlichen Verwandten haben. Andere Ziele sind ruppige oder hochnäsige Frauen, oder erfolgreiche. Eine der Angeklagten, mit denen sich Palmer unterhalten hat, hatte ihr guter Geschäftssinn ein kleines Vermögen eingebracht, das den Neid anderer Kleinhändler weckte. Als sie Geld verlieh und die unsympathische Eigenschaft zeigte, es von ihren Gläubigern zurückzufordern, war ihr Schicksal besiegelt."
Elet es Irodalom (Ungarn), 22.10.2010
 Der Journalist Benedek Varkonyi würdigt den im August verstorbenen britischen Tony Judt als einen Historiker, der wusste, dass das Vergangene nicht tot, sondern jeder seiner Momente in unserer Gegenwart präsent ist. Judt lebte an der Schnittstelle zwischen abgeschlossener Vergangenheit und lebendiger Welt - und somit an jenem neuralgischen Punkt, vor dem sich viele Historiker drücken, weil er so unangenehm ist, so Varkonyi: "Heute, nach den langen Debatten der Historiker über die Geschichte, wissen wir, dass es die 'einzige Vergangenheit' nicht gibt. Es gibt keine abgeschlossene Welt, sondern nur eine, die sich ständig verändert. Und Tony Judt zeigt uns solch ein sich stets veränderndes Bild von Europa. ... Er ist ein Historiker, dem die Vergangenheit dazu dient, etwas über die Gegenwart auszusagen. Wenn es eine philosophische Quintessenz seiner begeisterten und weitreichenden Arbeit geben würde, dann wäre dies die Frage, was die Geschichte von der Gegenwart erkennen lässt."
Der Journalist Benedek Varkonyi würdigt den im August verstorbenen britischen Tony Judt als einen Historiker, der wusste, dass das Vergangene nicht tot, sondern jeder seiner Momente in unserer Gegenwart präsent ist. Judt lebte an der Schnittstelle zwischen abgeschlossener Vergangenheit und lebendiger Welt - und somit an jenem neuralgischen Punkt, vor dem sich viele Historiker drücken, weil er so unangenehm ist, so Varkonyi: "Heute, nach den langen Debatten der Historiker über die Geschichte, wissen wir, dass es die 'einzige Vergangenheit' nicht gibt. Es gibt keine abgeschlossene Welt, sondern nur eine, die sich ständig verändert. Und Tony Judt zeigt uns solch ein sich stets veränderndes Bild von Europa. ... Er ist ein Historiker, dem die Vergangenheit dazu dient, etwas über die Gegenwart auszusagen. Wenn es eine philosophische Quintessenz seiner begeisterten und weitreichenden Arbeit geben würde, dann wäre dies die Frage, was die Geschichte von der Gegenwart erkennen lässt."Newsweek (USA), 24.10.2010
Digg.com, eine der erfolgreichsten Websites in den USA, verliert gerade massiv an Lesern (von 18 Millionen unique visitors auf 5,3 Millionen) und an Wert (von 130 auf 30 Millionen). Daniel Lyons überlegt, woran es liegen könnte. Die Konkurrenz durch Twitter? Bei Digg kann man über Artikel abstimmen. Mit Twitter kann man Artikel weiterverbreiten. Das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. "Aber so läuft das in der Technologie. Es geht fast nie um direkte Konkurrenz. Eher kommt von unerwarteter Seite etwas Neues und bietet einen neuen Weg an, etwas zu tun. Es hat viele Digg-Nachahmer gegeben, ohne dass es Digg sehr geschadet hätte. Und niemand hätte vorhersehen können, dass Twitter den Platz von Digg einnehmen würde, nicht einmal die Jungs, die Twitter geschaffen haben. Wahrscheinlich wird der Erfolg von Twitter ebenfalls von etwas unterbrochen, das sich nicht vorhersehen lässt. Das ist der Grund, warum Facebooks Mark Zuckerberg vor ein paar Monaten auf einer Konferenz erklärte, dass 'unser größter Konkurrent jemand ist, von dem wir noch nie gehört haben'."
Slate (USA), 21.10.2010
In Frankreich und in Großbritannien stehen schmerzhafte Reformen an. Die Briten reagieren, wie man es von Briten erwartet: mit stiff upper lip. Die Franzosen reagieren ganz nach Art der Franzosen: mit Revolutionsfestspielen. Wie kommt es, dass sich diese beiden Nationen verhalten wie Karikaturen ihrer selbst, fragt Anne Applebaum in Slate. Die Antwort liegt in der historischen Erfahrung der beiden Völker, meint sie: "Briten haben positive Erinnerungen an die Austerität in der Kriegszeit. Margaret Thatchers Budgetkürzungen leiteten echte Reformen und eine Periode des Wachstums ein. Die französische Neigung zu Streiks basiert ebenfalls auf echter Erfahrung. Streiks und Demonstrationen führten nicht nur 1789, sondern auch 1871, 1958 und in vielen anderen Momenten zu politischem Wandel. Die berühmten Streiks von 1968 leiteten in Frankreich echte Reformen und eine Periode des Wachstums und Wohlstands ein."
Magyar Narancs (Ungarn), 14.10.2010
 In der aktuellen Islamdebatte meldet sich der ungarische Islamwissenschaftler Robert Manyasz zu Wort. Er fragt sich, ob die demografischen Statistiken eher in die Richtung eines europäischen Islam weisen oder ob sich das Zukunftsbild eines islamischen Europas bewahrheiten wird. "Der Grund für die Ratlosigkeit angesichts der Herausforderung des Islams ist, dass wir die Antwort fast immer in Europa suchen. In Wahrheit handelt es sich aber um ein viel größeres, um ein globales Problem: um die allgemeine Krise des Islam. Darum, dass der Islam mit der Modernisierung seit zweihundert Jahren nichts anfangen kann und im Hinblick auf die Herausforderungen der Globalisierung vollkommen ratlos ist. [...] Das Ausbleiben der Modernisierung kann gesellschaftliche Kataklysmen im Nahen Osten auslösen, in deren Folge es zu einer weiteren Migrationswelle noch nie gesehenen Ausmaßes kommen könnte. Dann könnte die Prophezeiung der Pessimisten noch früher eintreten: Die Islamisierung Europas. Daher ist es das akute und langfristige Interesse Europas, dass die Modernisierung der muslimischen Gesellschaften vor Ort realisiert wird, doch kann dies kaum durch den unkritischen Export der europäischen liberalen Demokratie geschehen."
In der aktuellen Islamdebatte meldet sich der ungarische Islamwissenschaftler Robert Manyasz zu Wort. Er fragt sich, ob die demografischen Statistiken eher in die Richtung eines europäischen Islam weisen oder ob sich das Zukunftsbild eines islamischen Europas bewahrheiten wird. "Der Grund für die Ratlosigkeit angesichts der Herausforderung des Islams ist, dass wir die Antwort fast immer in Europa suchen. In Wahrheit handelt es sich aber um ein viel größeres, um ein globales Problem: um die allgemeine Krise des Islam. Darum, dass der Islam mit der Modernisierung seit zweihundert Jahren nichts anfangen kann und im Hinblick auf die Herausforderungen der Globalisierung vollkommen ratlos ist. [...] Das Ausbleiben der Modernisierung kann gesellschaftliche Kataklysmen im Nahen Osten auslösen, in deren Folge es zu einer weiteren Migrationswelle noch nie gesehenen Ausmaßes kommen könnte. Dann könnte die Prophezeiung der Pessimisten noch früher eintreten: Die Islamisierung Europas. Daher ist es das akute und langfristige Interesse Europas, dass die Modernisierung der muslimischen Gesellschaften vor Ort realisiert wird, doch kann dies kaum durch den unkritischen Export der europäischen liberalen Demokratie geschehen."New York Times (USA), 24.10.2010
 In einem Porträt der liberischen Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, erzählt Daniel Bergner auch von einem wenig bekannten Kapitel der Geschichte dieses Landes, das 1847 von freigelassen amerikanischen Sklaven gegründet wurde. Damit einher ging allerdings auch die Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung. Noch heute resultiert ein Teil der Gewalt, der sich in immer neuen Putschen äußert, die Liberia vollkommen ruiniert haben, aus der Kluft zwischen "Einheimischen" und "Americo-Liberianern". Samuel Doe, der sich 1980 an die Macht putschte und als erste Amtshandlung 13 Minister öffentlich foltern und hinrichten ließ, war der erste "einheimische" Präsident Liberias. "Seit den frühen Tagen der Republik schicken die Armen ihre Söhne und Töchter als Dienstboten zu den Bessergestellten, in der Hoffnung auf Schulunterricht und ein besseres Leben. Einheimische Kinder haben die Häuser der Einwanderer geputzt und Mahlzeiten für sie gekocht. Sie gehörten mehr oder weniger ihren Patenfamilien, Eine Mischung aus Sklaven und Pflegekindern, trugen sie in der Regel den Nachnamen ihrer Paten. Über Generationen hat diese Tradition die Standesunterschiede nicht ausgelöscht - der Schulunterricht war dürftig und die Chance auf Verbesserung minimal - aber doch aufgeweicht. In Sirleafs Fall fielen sie vollständig."
In einem Porträt der liberischen Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, erzählt Daniel Bergner auch von einem wenig bekannten Kapitel der Geschichte dieses Landes, das 1847 von freigelassen amerikanischen Sklaven gegründet wurde. Damit einher ging allerdings auch die Unterdrückung der einheimischen Bevölkerung. Noch heute resultiert ein Teil der Gewalt, der sich in immer neuen Putschen äußert, die Liberia vollkommen ruiniert haben, aus der Kluft zwischen "Einheimischen" und "Americo-Liberianern". Samuel Doe, der sich 1980 an die Macht putschte und als erste Amtshandlung 13 Minister öffentlich foltern und hinrichten ließ, war der erste "einheimische" Präsident Liberias. "Seit den frühen Tagen der Republik schicken die Armen ihre Söhne und Töchter als Dienstboten zu den Bessergestellten, in der Hoffnung auf Schulunterricht und ein besseres Leben. Einheimische Kinder haben die Häuser der Einwanderer geputzt und Mahlzeiten für sie gekocht. Sie gehörten mehr oder weniger ihren Patenfamilien, Eine Mischung aus Sklaven und Pflegekindern, trugen sie in der Regel den Nachnamen ihrer Paten. Über Generationen hat diese Tradition die Standesunterschiede nicht ausgelöscht - der Schulunterricht war dürftig und die Chance auf Verbesserung minimal - aber doch aufgeweicht. In Sirleafs Fall fielen sie vollständig."Außerdem: Elizabeth Rubin schildert in einer Reportage die nach wie vor entsetzliche Situation der Frauen in Afghanistan.
Kommentieren