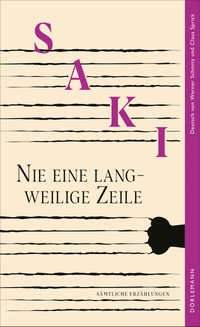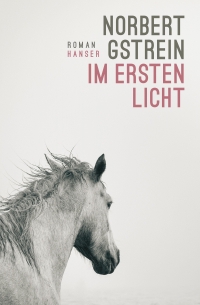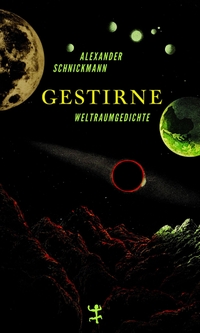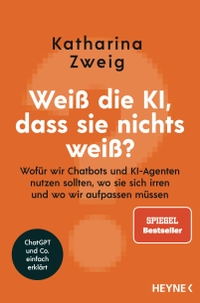Magazinrundschau
Frisch, kess, irisch
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
18.12.2012. Der New Yorker trifft auf einem Linguistenkongress die Nummer zwei der ukrainischen Terroristen. Prospect blickt staunend auf 400 Jahre Oper. Die LRB bewundert die zwei Lincolns in Daniel Day-Lewis. In Le Monde fordert Abdelwahab Meddeb die Muslime auf, den Islam vom Islamismus zu befreien. GQ macht Bekanntschaft mit einem Schläger von der Partei "Goldene Morgenröte". In Elet es Irodalom ruft der Theatermacher Árpád Schilling seinen Kollegen auf, ihr "feiges Schweigen" zu beenden. The Awl leidet gleich zwei Mal an Berlin. Humanities liest den Briefwechsel zwischen Bram Stoker und Walt Whitman.
New Republic (USA), 14.12.2012
Die Demokraten haben eine gute Chance, die Waffengesetze zu verschärfen, meint Nate Cohn. Allerdings nicht, weil die Stimmung der Bevölkerung sich gegen Waffen gewandt hätte, sondern schlicht, weil die Demokraten nicht mehr um die Stimmen der Waffenbefürworter zu werben brauchen - denn sie haben ihre Mehrheit auch jenseits davon: "In den Jahren 2000 und 2004 mögen die Demokraten noch geglaubt haben, dass sie diese Wähler brauchen um zu gewinen. Aber nun haben die Demokraten Wege gefunden, Wahlen zu gewinnen, ohne auf die Waffenfans aus West Virginia angewiesen zu sein: indem sie in den Städten und Suburbs noch stärker wurden, wo die Unterstzung für Gun Control wohl am stärksten ist. Das gilt sogar für Ohio, wo Obama zweimal gewann, indem er die Ergebnisse der Demokraten in Städten und Vorstädten noch verbesserte, statt wie Clinton oder Carter um konservative Wähler in Südost-Ohio zu werben."
In einem zweiten Artikel fragt Amy Sullivan, warum Massaker wie das Newtown immer häufiger werden: in diesem Jahr sind in den USA 140 Menschen bei Massakern umgekommen, doppelst so viel wie in den Jahren zuvor.
Paul Berman schreibt einen ausgreifenden Essay über Rushdies Erinnerungen an die Zeit der Fatwa und ist am Ende nicht ganz zufrieden mit dem Buch: "Seine Talente - Feuerwerke aus Wortspielen, Nachahmung von Dialekten, exotischer Glitter, großartige Landschaften, gelegentliche Geistesblitze - lassen sich nicht disziplinieren. Es sind nicht die Talente, die man für eine Chronik tatsächlicher Ereignisse gebrauchen kann. Schon der Titel 'Joseph Anton' drückt Rushdies Sehnsucht nach fiktionalen Charakteren aus, über die er lieber schreibt als über sich selbst. Wirklich, er hätte einen Roman schreiben sollen."
In einem zweiten Artikel fragt Amy Sullivan, warum Massaker wie das Newtown immer häufiger werden: in diesem Jahr sind in den USA 140 Menschen bei Massakern umgekommen, doppelst so viel wie in den Jahren zuvor.
Paul Berman schreibt einen ausgreifenden Essay über Rushdies Erinnerungen an die Zeit der Fatwa und ist am Ende nicht ganz zufrieden mit dem Buch: "Seine Talente - Feuerwerke aus Wortspielen, Nachahmung von Dialekten, exotischer Glitter, großartige Landschaften, gelegentliche Geistesblitze - lassen sich nicht disziplinieren. Es sind nicht die Talente, die man für eine Chronik tatsächlicher Ereignisse gebrauchen kann. Schon der Titel 'Joseph Anton' drückt Rushdies Sehnsucht nach fiktionalen Charakteren aus, über die er lieber schreibt als über sich selbst. Wirklich, er hätte einen Roman schreiben sollen."
HVG (Ungarn), 08.12.2012
 Völlig absurd findet der Publizist László Seres die Idee, die ungarische Jobbik-Partei zu verbieten - so wie es von einigen Stimmen mit Hinweis auf die deutsche Diskussion über die NPD gefordert wird: "Die Neonazipartei sitzt seit zwei Jahren im Parlament, ihre Legitimation hat sie von den Wählern erhalten. Würde man sie nun auf administrativem Wege abschaffen, wäre dies nicht eine Botschaft der aufgeklärten, antirassistischen Führer des Landes an die Gesellschaft, diese Schande nicht weiter auf sich sitzen zu lassen; die Botschaft würde vielmehr lauten, dass wir... dieser Erscheinung nun vollkommen hilflos gegenüberstehen, dass wir nichts gegen sie vermögen und dies auch von der Gesellschaft nicht erwarten. Und so hissen wir die weiße Flagge und unterschreiben die völlige Kapitulation."
Völlig absurd findet der Publizist László Seres die Idee, die ungarische Jobbik-Partei zu verbieten - so wie es von einigen Stimmen mit Hinweis auf die deutsche Diskussion über die NPD gefordert wird: "Die Neonazipartei sitzt seit zwei Jahren im Parlament, ihre Legitimation hat sie von den Wählern erhalten. Würde man sie nun auf administrativem Wege abschaffen, wäre dies nicht eine Botschaft der aufgeklärten, antirassistischen Führer des Landes an die Gesellschaft, diese Schande nicht weiter auf sich sitzen zu lassen; die Botschaft würde vielmehr lauten, dass wir... dieser Erscheinung nun vollkommen hilflos gegenüberstehen, dass wir nichts gegen sie vermögen und dies auch von der Gesellschaft nicht erwarten. Und so hissen wir die weiße Flagge und unterschreiben die völlige Kapitulation."Economist (UK), 15.12.2012
 Der Economist empfiehlt Lesern und Politikern gleichermaßen Alan Ryans "On Politics", eine Geschichte der politischen Philosophie von Herodes bis zur Gegenwart: "James Madison offeriert die besten Ratschläge für ägyptische Intellektuelle, die Mohammed Morsi darin hindern wollen, ihre Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln. John Stuart Mill bietet das beste Argument gegen Michael Bloomberg und die 'sanfte Diktatur', die seine Vorschriften gegen Softdrinks nach sich ziehen. Immanuel Kant hat den besten Einblick in die Debatte über die Schwulenehe - er behauptet, wenn man erst mal die Sentimentalitäten wegstreiche, sei die Ehe nicht mehr als eine Abmachung über den Gebrauch der jeweiligen Sexualorgane. Mr. Ryans historischer Zugang hilft uns zumindest, unsere Probleme unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten und vor allem, sich die Geschichte der klügsten Köpfe zunutze zu machen, die jemals über praktische Politik nachgedacht haben."
Der Economist empfiehlt Lesern und Politikern gleichermaßen Alan Ryans "On Politics", eine Geschichte der politischen Philosophie von Herodes bis zur Gegenwart: "James Madison offeriert die besten Ratschläge für ägyptische Intellektuelle, die Mohammed Morsi darin hindern wollen, ihre Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln. John Stuart Mill bietet das beste Argument gegen Michael Bloomberg und die 'sanfte Diktatur', die seine Vorschriften gegen Softdrinks nach sich ziehen. Immanuel Kant hat den besten Einblick in die Debatte über die Schwulenehe - er behauptet, wenn man erst mal die Sentimentalitäten wegstreiche, sei die Ehe nicht mehr als eine Abmachung über den Gebrauch der jeweiligen Sexualorgane. Mr. Ryans historischer Zugang hilft uns zumindest, unsere Probleme unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten und vor allem, sich die Geschichte der klügsten Köpfe zunutze zu machen, die jemals über praktische Politik nachgedacht haben."Außerdem: Das Szenario der Fiskalklippe, das sich in den USA für die kommenden Monate abzeichnet, ist so dramatisch, dass es dazu nicht kommen wird, wird man im Aufmacher beruhigt. Um weiterhin boomen zu können, sollte der umstrittene, für Apple tätige chinesische Fertigungsbetrieb Foxconn den eingeschlagenen Reformweg weiter verfolgen, rät dieser Artikel.
Le Monde (Frankreich), 16.12.2012
 Der große tunesische Essayist und Lyriker Abdelwahab Meddeb ruft gemäßigte Muslime dazu auf, den Islam vom Islamismus zu befreien. Dazu will er an vier Punkten ansetzen, an denen der saudische Wahabismus die islamische Doktrin versteifte. In Punkt 4 fordert Meddeb den "Anschluss unseres Diskurses an das moderne und postmoderne Denken, wie es sich seit dem 18. Jahrundert, seit Rousseau und Kant bis zu Karl Popper und Jacques Derrida über John Stuart Mill und viele andere entfaltet hat - an jenes Denken also, das Offenheit und Freiheit feiert, das die Waffe der Kritik nutzt und ein Erbe zu dekonstruieren weiß, denn es hat nur dann Geltung, wenn es als eine unablässig in Frage gestellte Spur weitergetragen wird."
Der große tunesische Essayist und Lyriker Abdelwahab Meddeb ruft gemäßigte Muslime dazu auf, den Islam vom Islamismus zu befreien. Dazu will er an vier Punkten ansetzen, an denen der saudische Wahabismus die islamische Doktrin versteifte. In Punkt 4 fordert Meddeb den "Anschluss unseres Diskurses an das moderne und postmoderne Denken, wie es sich seit dem 18. Jahrundert, seit Rousseau und Kant bis zu Karl Popper und Jacques Derrida über John Stuart Mill und viele andere entfaltet hat - an jenes Denken also, das Offenheit und Freiheit feiert, das die Waffe der Kritik nutzt und ein Erbe zu dekonstruieren weiß, denn es hat nur dann Geltung, wenn es als eine unablässig in Frage gestellte Spur weitergetragen wird."Foreign Policy (USA), 11.12.2012
 In einem bewegenden Essay schildert Amal Hanano das unaufhaltsame Sterben ihrer Heimatstadt Aleppo im syrischen Bügerkrieg: "Heute dient die Zitadelle nicht mehr dazu, Besucher zu beeindrucken. Sie ist keine geschützte Weltkulturerbestätte mehr. Sie hat ihre ursprüngliche Bestimmung wiedergefunden: als Festung, die in der Schlacht verteidigt und erobert wird. Hinter ihren schmalen Schlitzen, durch die einst Bogenschützen schossen, verstecken sich heute Heckenschützen. Der jahrhundertelang unberührte Kalkstein ist von frischen Einschusslöchern durchsetzt... Wie Sami, ein Aktivist aus Aleppo, sich ausdrückt: 'Wir sehen Ruinen zu Ruinen werden.'"
In einem bewegenden Essay schildert Amal Hanano das unaufhaltsame Sterben ihrer Heimatstadt Aleppo im syrischen Bügerkrieg: "Heute dient die Zitadelle nicht mehr dazu, Besucher zu beeindrucken. Sie ist keine geschützte Weltkulturerbestätte mehr. Sie hat ihre ursprüngliche Bestimmung wiedergefunden: als Festung, die in der Schlacht verteidigt und erobert wird. Hinter ihren schmalen Schlitzen, durch die einst Bogenschützen schossen, verstecken sich heute Heckenschützen. Der jahrhundertelang unberührte Kalkstein ist von frischen Einschusslöchern durchsetzt... Wie Sami, ein Aktivist aus Aleppo, sich ausdrückt: 'Wir sehen Ruinen zu Ruinen werden.'"Elet es Irodalom (Ungarn), 30.11.2012
 Die "in der Schweiz lebende deutschsprachige Schriftstellerin mit ostmitteleuropäischen Wurzeln", Ilma Rakusa, würde sich am liebsten als "europäische Schriftstellerin" bezeichnen. In ihrem Beitrag zu den Budapester "Europa-Gesprächen" bekennt sie sich zu ihrem Europa - das sie mit Vielfalt, Komplexität, komplizierter Widersprüchlichkeit verbindet: "Europa ist fraglos ein - aus eigener Schuld - lädierter Kontinent. Ein alter Kontinent dazu. Aber er dürfte im Laufe seiner wechselvollen Geschichte einiges gelernt haben. Zögern steht ihm gut. Nachdenklich zu sein, steht ihm gut. Sich nicht zum Weltpolizisten aufzuschwingen, steht ihm gut. Sich auf Bewährtes zurückzubesinnen, ohne den Wandel der Verhältnisse zu übersehen, steht ihm gut. Im Umgang mit Migranten großzügig zu sein, steht ihm gut. Ich wünsche mir für Europa keine Corporate Identity, denn sie ist undenkbar. Das vielfältige Europa muss in seinen Teilen beweglich bleiben, freilich ohne in Kleinstaaterei und Separatismus abzugleiten. Das klingt nach der Quadratur des Kreises, doch ist insofern Zuversicht am Platz, als Europa um seine Gefährdungen weiß."
Die "in der Schweiz lebende deutschsprachige Schriftstellerin mit ostmitteleuropäischen Wurzeln", Ilma Rakusa, würde sich am liebsten als "europäische Schriftstellerin" bezeichnen. In ihrem Beitrag zu den Budapester "Europa-Gesprächen" bekennt sie sich zu ihrem Europa - das sie mit Vielfalt, Komplexität, komplizierter Widersprüchlichkeit verbindet: "Europa ist fraglos ein - aus eigener Schuld - lädierter Kontinent. Ein alter Kontinent dazu. Aber er dürfte im Laufe seiner wechselvollen Geschichte einiges gelernt haben. Zögern steht ihm gut. Nachdenklich zu sein, steht ihm gut. Sich nicht zum Weltpolizisten aufzuschwingen, steht ihm gut. Sich auf Bewährtes zurückzubesinnen, ohne den Wandel der Verhältnisse zu übersehen, steht ihm gut. Im Umgang mit Migranten großzügig zu sein, steht ihm gut. Ich wünsche mir für Europa keine Corporate Identity, denn sie ist undenkbar. Das vielfältige Europa muss in seinen Teilen beweglich bleiben, freilich ohne in Kleinstaaterei und Separatismus abzugleiten. Das klingt nach der Quadratur des Kreises, doch ist insofern Zuversicht am Platz, als Europa um seine Gefährdungen weiß."New Yorker (USA), 31.12.2012
 "Utopisch für Anfänger" überschreibt Joshua Foer sein Porträt des Beamten und Amateur-Linguisten John Quijada, der in seiner Freizeit die "ideale" Kunstsprache "Ithkuil" entwickelt hat, über die er die Kontrolle zu verlieren droht. Per Internet wurden nämlich in Russland so genannte "Psychonetiker" darauf aufmerksam, die glauben, das Erlernen von Ithkuil "beschleunige das Gehirn". Auf einem Kongress in Kiew machten Foer und Quijada, dessen Sprache ein echtes Abenteuer wurde, überdies eine Begegnung der dritten Art. Ein Mann, der die Veranstaltung filmte und sich als Igor Garkavenko vorstellte, begann von der "transfomierenden Wirkung der Psychonetik auf sein politisches und philosophisches Bewusstsein" zu schwärmen: "Gegen Ende seines Vortrags brach unser Übersetzer plötzlich ab. Er war rot angelaufen. 'Ist Ihnen klar, wer der Kerl ist?', flüsterte er mir zu. 'Das ist die Nummer zwei der ukrainischen Terroristen.' Wir googelten ihn schnell ... und es stellte sich heraus, dass Garkavenko Gründer einer rechts-militanten nationalistischen Organisation namens Ukrainische Revolutionäre Volksarmee war. 1997 musste er wegen Brandanschlägen auf mehrere politische und kulturelle Organisationen der Ukraine für neun Jahre ins Gefängnis. Ich wandte mich an meinen Übersetzer. 'Was um alles in der Welt treibt dieser Kerl auf einem Linguisten-Kongress?' Ich beugte mich zu Quijada und erzählte ihm, was ich gerade gelesen hatte. Wir schauten uns im Raum um und sahen uns die im Publikum versammelten jungen Männer und Frauen an, und wurden plötzlich von einer Frage gepackt, die uns vermutlich früher hätte kommen sollen: Was trieben alle diese Leuten eigentlich hier?"
"Utopisch für Anfänger" überschreibt Joshua Foer sein Porträt des Beamten und Amateur-Linguisten John Quijada, der in seiner Freizeit die "ideale" Kunstsprache "Ithkuil" entwickelt hat, über die er die Kontrolle zu verlieren droht. Per Internet wurden nämlich in Russland so genannte "Psychonetiker" darauf aufmerksam, die glauben, das Erlernen von Ithkuil "beschleunige das Gehirn". Auf einem Kongress in Kiew machten Foer und Quijada, dessen Sprache ein echtes Abenteuer wurde, überdies eine Begegnung der dritten Art. Ein Mann, der die Veranstaltung filmte und sich als Igor Garkavenko vorstellte, begann von der "transfomierenden Wirkung der Psychonetik auf sein politisches und philosophisches Bewusstsein" zu schwärmen: "Gegen Ende seines Vortrags brach unser Übersetzer plötzlich ab. Er war rot angelaufen. 'Ist Ihnen klar, wer der Kerl ist?', flüsterte er mir zu. 'Das ist die Nummer zwei der ukrainischen Terroristen.' Wir googelten ihn schnell ... und es stellte sich heraus, dass Garkavenko Gründer einer rechts-militanten nationalistischen Organisation namens Ukrainische Revolutionäre Volksarmee war. 1997 musste er wegen Brandanschlägen auf mehrere politische und kulturelle Organisationen der Ukraine für neun Jahre ins Gefängnis. Ich wandte mich an meinen Übersetzer. 'Was um alles in der Welt treibt dieser Kerl auf einem Linguisten-Kongress?' Ich beugte mich zu Quijada und erzählte ihm, was ich gerade gelesen hatte. Wir schauten uns im Raum um und sahen uns die im Publikum versammelten jungen Männer und Frauen an, und wurden plötzlich von einer Frage gepackt, die uns vermutlich früher hätte kommen sollen: Was trieben alle diese Leuten eigentlich hier?"Weiteres: Von außen ist schwer zu entscheiden, ob die Politik der ägyptischen Muslimbrüder nun von Kalkül oder schierer Inkompetenz geprägt sei, meint Peter Hessler in einem Kommentar zu den neuen Unruhen in Kairo. David Denbby bespricht Kathryn Bigelows Thriller "Zero Dark Thirty" über die Jagd auf Osama Bin Laden und Judd Apatows Komödie "This Is Forty". Zu lesen ist außerdem die Erzählung "Shirley Temple Three" von Thomas Pierce.
Prospect (UK), 12.12.2012
 Voller Entzücken durchstreift Wendy Lesser mit Carolyn Abbates und Roger Parkers "400 Jahre Operngeschichte", die gleichzeitig die Geschichte einer "der sonderbarsten Unterhaltungsformen auf diesem Planeten" ist. "Ihre überzeichneten Figuren gleichen lebenden Menschen nur geringfügig und die Geschichten sind oft haarsträubend. Und doch verlangt die Oper von ihren Zuschauern echte Anteilnahme, wirkliche Sympathie, sogar echte Tränen. Mütter scheitern regelmäßig daran ihre Söhne, Schwestern daran ihre Brüder und Gatten daran ihre Gattinnen zu erkennen, doch von uns wird auf Distanz hunderter von Metern erwartet, all die dünnen Verkleidungen zu durchschauen. Frauen verkleiden sich als Männer, die als Frauen verkleidet sind - in erster Linie um mit anderen Frauen Liebe zu machen -, und keinen kümmert's. Und um es auf die Spitze zu treiben, singen alle ihre Zeilen: nicht so, wie du und ich singen würden, im Modus zwischen Schlaf- und Volkslied, sondern unmenschlich, extrem, mit einer sichtbaren Kenntnis ihrer eigenen, bemerkenswerten Leistung."
Voller Entzücken durchstreift Wendy Lesser mit Carolyn Abbates und Roger Parkers "400 Jahre Operngeschichte", die gleichzeitig die Geschichte einer "der sonderbarsten Unterhaltungsformen auf diesem Planeten" ist. "Ihre überzeichneten Figuren gleichen lebenden Menschen nur geringfügig und die Geschichten sind oft haarsträubend. Und doch verlangt die Oper von ihren Zuschauern echte Anteilnahme, wirkliche Sympathie, sogar echte Tränen. Mütter scheitern regelmäßig daran ihre Söhne, Schwestern daran ihre Brüder und Gatten daran ihre Gattinnen zu erkennen, doch von uns wird auf Distanz hunderter von Metern erwartet, all die dünnen Verkleidungen zu durchschauen. Frauen verkleiden sich als Männer, die als Frauen verkleidet sind - in erster Linie um mit anderen Frauen Liebe zu machen -, und keinen kümmert's. Und um es auf die Spitze zu treiben, singen alle ihre Zeilen: nicht so, wie du und ich singen würden, im Modus zwischen Schlaf- und Volkslied, sondern unmenschlich, extrem, mit einer sichtbaren Kenntnis ihrer eigenen, bemerkenswerten Leistung."Außerdem: Ehud Barak lobt die Zähigkeit der Bevölkerung in Israel und unterstreicht die Bedrohung des Landes durch einen nuklear aufgerüsteten Iran. Ganz Deutschland liegt Angela Merkel zu Füßen, erklärt Katinka Barysch ihren Lesern. Noch kann man die Erderwärmung aufhalten, mahnt Stanley Johnson.
London Review of Books (UK), 20.12.2012
 Michael Wood findet Steven Spielbergs neuen Film "Lincoln" ziemlich gut: Vor allem wegen Daniel Day-Lewis als Lincoln. "Wenn man sein Gesicht betrachtet, die intelligenten Augen, die freundlichen Fältchen des Makeups, die ständigen, aber diskreten Zeichen dafür, dass jemand hinter dieser Maske denkt, dann hat man den Eindruck, zwei ganz verschiedene Menschen zu sehen. Der eine ist der Abraham Lincoln der Legende, loyal reproduziert, der Mann, den man zu sehen erwartet - 'die Größe Napoleons, Cäsars oder Washingtons ist nur Mondlicht neben Lincolns Sonne', soll Tolstoi laut Goodwin gesagt haben - aber ruhig und bescheiden vor uns gestellt. Der andere ist ein Mann in diesem Mann, der sich fragt, ob 'Lincoln' nicht nur eine Karikatur ist, die Schaufensterseite eines schlauen Politikers und besorgten Vaters und Ehemanns, der Bildschirm für die notwendigen Projektionen. Ich meine damit nicht, dass Day-Lewis seine Rolle ironisch anlegt, auch wenn es ein oder zwei mal im Film kurz so aussieht. Ich meine, dass Lincoln seine Rolle ironisch sieht. Es ist eine außerordentliche Leistung, dies zu vermitteln, ohne die Ikone zu ruinieren."
Michael Wood findet Steven Spielbergs neuen Film "Lincoln" ziemlich gut: Vor allem wegen Daniel Day-Lewis als Lincoln. "Wenn man sein Gesicht betrachtet, die intelligenten Augen, die freundlichen Fältchen des Makeups, die ständigen, aber diskreten Zeichen dafür, dass jemand hinter dieser Maske denkt, dann hat man den Eindruck, zwei ganz verschiedene Menschen zu sehen. Der eine ist der Abraham Lincoln der Legende, loyal reproduziert, der Mann, den man zu sehen erwartet - 'die Größe Napoleons, Cäsars oder Washingtons ist nur Mondlicht neben Lincolns Sonne', soll Tolstoi laut Goodwin gesagt haben - aber ruhig und bescheiden vor uns gestellt. Der andere ist ein Mann in diesem Mann, der sich fragt, ob 'Lincoln' nicht nur eine Karikatur ist, die Schaufensterseite eines schlauen Politikers und besorgten Vaters und Ehemanns, der Bildschirm für die notwendigen Projektionen. Ich meine damit nicht, dass Day-Lewis seine Rolle ironisch anlegt, auch wenn es ein oder zwei mal im Film kurz so aussieht. Ich meine, dass Lincoln seine Rolle ironisch sieht. Es ist eine außerordentliche Leistung, dies zu vermitteln, ohne die Ikone zu ruinieren."Außerdem: Jackson Lears liest Ray Monks "superbe" und offenbar sehr detailierte Biografie über Robert Oppenheimer, einem der Väter der Atombombe. Dazu passend: Der emeritierte Physikprofessor Jeremy Bernstein erinnert sich, wie er in den 50ern voller Ehrfurcht einigen Atombombentests beiwohnte. Beim Lustwandeln durch die Ausstellung "Hollywood Costume" im Victoria & Albert Museum in London fühlt sich Marina Warner in eine "Anderswelt, in der sich Gespenster versammelt haben", versetzt. Weiterhin besprochen werden Adrian Forts Biografie über Lady Astor und Richard Bradfords Schilderung der Freundschaft zwischen Kingsley Amis und Philip Larkin.
Nepszabadsag (Ungarn), 10.12.2012
 Die ungarische Historikerin Mária M. Kovács hat kürzlich ein Buch über den Ursprung der immer stärkeren antisemitischen Ressentiments der heutigen Rechtsextremen im Land veröffentlicht ("Törvénytől sújtva", Verlag Napvilág Kiadó, Budapest). Eine besondere Aktualität gewinnt das Buch durch die kürzlich erhobene Forderung eines Jobbik-Abgeordneten, die ungarischen Juden registrieren zu lassen (mehr hier). Anna Székely fragte die Historikerin, ob man wirklich davon ausgehen könne, dass der Antisemitismus nie wieder ungarische Regierungspolitik beeinflusst. Kovács scheint es zu beweifeln: "Die Geschichte des Numerus-Clausus zeigt uns, dass es eine 'gemäßigte', 'sanfte' staatliche Diskriminierung, die man wie einen Wasserhahn nach Belieben auf- und zudrehen kann, nicht gibt. Jede Kategorisierung nach der Herkunft von Personen ist gefährlich. Diese neuerliche Aktion der Jobbik-Partei geschah nicht im luftleeren Raum. Durch die Rehabilitierung der Horthy-Ära wird auch jene, für die Zeit des Numerus-Clausus so typische und unreflektierte Rede rehabilitiert, in der, ob begründet oder nicht, bestimmte politische Ansichten und Präferenzen stets mit gewissen Herkunftsgruppen verknüpft wurden."
Die ungarische Historikerin Mária M. Kovács hat kürzlich ein Buch über den Ursprung der immer stärkeren antisemitischen Ressentiments der heutigen Rechtsextremen im Land veröffentlicht ("Törvénytől sújtva", Verlag Napvilág Kiadó, Budapest). Eine besondere Aktualität gewinnt das Buch durch die kürzlich erhobene Forderung eines Jobbik-Abgeordneten, die ungarischen Juden registrieren zu lassen (mehr hier). Anna Székely fragte die Historikerin, ob man wirklich davon ausgehen könne, dass der Antisemitismus nie wieder ungarische Regierungspolitik beeinflusst. Kovács scheint es zu beweifeln: "Die Geschichte des Numerus-Clausus zeigt uns, dass es eine 'gemäßigte', 'sanfte' staatliche Diskriminierung, die man wie einen Wasserhahn nach Belieben auf- und zudrehen kann, nicht gibt. Jede Kategorisierung nach der Herkunft von Personen ist gefährlich. Diese neuerliche Aktion der Jobbik-Partei geschah nicht im luftleeren Raum. Durch die Rehabilitierung der Horthy-Ära wird auch jene, für die Zeit des Numerus-Clausus so typische und unreflektierte Rede rehabilitiert, in der, ob begründet oder nicht, bestimmte politische Ansichten und Präferenzen stets mit gewissen Herkunftsgruppen verknüpft wurden."Gentlemen's Quarterly (USA), 01.12.2012
 Sean Flynn porträtiert den in Libyen ermordeten amerikanischen Botschafter J. Christopher Stevens, einen Kalifornier, der sich in die arabische Welt verliebte und in eine Europäerin namens Henrietta: "Er sagte, ihm habe mein Geruch gefallen. Chris war ein sinnlicher Mensch, er benutzte all seine Sinne, um die Welt zu erfahren. Für Menschen wie uns ist der Nahe Osten verlockend. Der Geruch des Kaffees mit Kardamon, und des Apfeltabaks in der Wasserpfeife, die Farbe und die Berührung von Teppichen und Stoffen, der Ton des Muezzin, der zum Gebet ruft, und die Energie des verrückten städtischen Verkehrs und der großen Wüstenlandschaften. Die Wärme der Menschen und der Klang ihrer Musik und Sprache. Wenn man das kombiniert mit einer analytischen Neugierde, die in das Verständnis der langen Geschichte der Region und der komplizierten Verstrickungen ihrer gegenwärtigen Politik investiert wird, dann ist der Nahe Osten ein Ort, dem man nicht widerstehen kann. Es ist nicht nur eine intellektuelle Anstrengung - man fühlt sich einfach vollkommen lebendig.'"
Sean Flynn porträtiert den in Libyen ermordeten amerikanischen Botschafter J. Christopher Stevens, einen Kalifornier, der sich in die arabische Welt verliebte und in eine Europäerin namens Henrietta: "Er sagte, ihm habe mein Geruch gefallen. Chris war ein sinnlicher Mensch, er benutzte all seine Sinne, um die Welt zu erfahren. Für Menschen wie uns ist der Nahe Osten verlockend. Der Geruch des Kaffees mit Kardamon, und des Apfeltabaks in der Wasserpfeife, die Farbe und die Berührung von Teppichen und Stoffen, der Ton des Muezzin, der zum Gebet ruft, und die Energie des verrückten städtischen Verkehrs und der großen Wüstenlandschaften. Die Wärme der Menschen und der Klang ihrer Musik und Sprache. Wenn man das kombiniert mit einer analytischen Neugierde, die in das Verständnis der langen Geschichte der Region und der komplizierten Verstrickungen ihrer gegenwärtigen Politik investiert wird, dann ist der Nahe Osten ein Ort, dem man nicht widerstehen kann. Es ist nicht nur eine intellektuelle Anstrengung - man fühlt sich einfach vollkommen lebendig.'" Ein Mann teilt aus: eine Frau kriegt den Inhalt seines Wasserglases, eine andere seine Fäuste ins Gesicht. Im Juni gingen die Bilder von dem Eklat in einer griechischen Talkshow um die Welt. Chris Heath hat für GQ mit den beteiligten Politikern - Rena Dourou, Liana Kanelli und den Fäuste schwingenden Ilias Kasidiaris - über den Vorfall gesprochen. Zu seinem Erstaunen hatte die Episode für Kasidiaris und seine rechtsextreme Partei "Goldene Morgenröte" keinerlei negative Auswirkungen: "'Insgesamt hat die Öffentlichkeit meine Reaktion gutgeheißen', sagt er mit kurzem, kaltem, selbstgefälligem Lächeln. 'Wir haben ganz bestimmt keine Stimmen verloren.' Es scheint ihn zu amüsieren, dass die drei mittlerweile im selben Parlamentsgebäude arbeiten. Ich frage ihn, was passiert, wenn sie sich in der Cafeteria begegnen. 'Wir werden uns nicht in der Cafeteria begegnen', sagt er mit hämischem Grinsen. 'Wir werden uns im Boxring begegnen.'"
Ein Mann teilt aus: eine Frau kriegt den Inhalt seines Wasserglases, eine andere seine Fäuste ins Gesicht. Im Juni gingen die Bilder von dem Eklat in einer griechischen Talkshow um die Welt. Chris Heath hat für GQ mit den beteiligten Politikern - Rena Dourou, Liana Kanelli und den Fäuste schwingenden Ilias Kasidiaris - über den Vorfall gesprochen. Zu seinem Erstaunen hatte die Episode für Kasidiaris und seine rechtsextreme Partei "Goldene Morgenröte" keinerlei negative Auswirkungen: "'Insgesamt hat die Öffentlichkeit meine Reaktion gutgeheißen', sagt er mit kurzem, kaltem, selbstgefälligem Lächeln. 'Wir haben ganz bestimmt keine Stimmen verloren.' Es scheint ihn zu amüsieren, dass die drei mittlerweile im selben Parlamentsgebäude arbeiten. Ich frage ihn, was passiert, wenn sie sich in der Cafeteria begegnen. 'Wir werden uns nicht in der Cafeteria begegnen', sagt er mit hämischem Grinsen. 'Wir werden uns im Boxring begegnen.'"Awl (USA), 11.12.2012
 Und noch zwei Artikel über Berlin. Vor knapp drei Wochen beschrieb der australische Musiker Robert F. Coleman in der NYT, wie schnell ihn das leichte Leben in dieser Stadt in Party und Lethargie versinken ließ, statt seiner Kreativität echten Aufschwung zu geben. In The Awl sieht der Deutsch-Kanadier Thomas Rogers, der einen Job in New York hinschmiss, um nach Berlin zu ziehen, das ähnlich: "Wie Coleman wollte ich meine neu gewonnene Freizeit dazu nutzen, an einem großen Projekt zu arbeiten, an einer Buchidee, über die ich schon seit Jahren nachdachte. Zuerst warf ich mich richtig ins Zeug: Ich ging für eine Reportage nach Prag, interviewte über Skype amerikanische Experten, lieh mir Bücher aus der Universitätsbibliothek aus. Aber wie meine Freundin Charlie, die seit fünf Jahren hier lebt, meint: 'Es ist immer lustig, wenn neue Leute hier ankommen, weil sie immer noch Energie und Ehrgeiz haben, den der Rest von uns wie die Vampire aussaugen kann. Aber keine Angst, schon bald bist du wie wir, lebst von den Neuankömmlingen."
Und noch zwei Artikel über Berlin. Vor knapp drei Wochen beschrieb der australische Musiker Robert F. Coleman in der NYT, wie schnell ihn das leichte Leben in dieser Stadt in Party und Lethargie versinken ließ, statt seiner Kreativität echten Aufschwung zu geben. In The Awl sieht der Deutsch-Kanadier Thomas Rogers, der einen Job in New York hinschmiss, um nach Berlin zu ziehen, das ähnlich: "Wie Coleman wollte ich meine neu gewonnene Freizeit dazu nutzen, an einem großen Projekt zu arbeiten, an einer Buchidee, über die ich schon seit Jahren nachdachte. Zuerst warf ich mich richtig ins Zeug: Ich ging für eine Reportage nach Prag, interviewte über Skype amerikanische Experten, lieh mir Bücher aus der Universitätsbibliothek aus. Aber wie meine Freundin Charlie, die seit fünf Jahren hier lebt, meint: 'Es ist immer lustig, wenn neue Leute hier ankommen, weil sie immer noch Energie und Ehrgeiz haben, den der Rest von uns wie die Vampire aussaugen kann. Aber keine Angst, schon bald bist du wie wir, lebst von den Neuankömmlingen."Jessa Crispin von Bookslut brach in New York alle Brücken ab, als sie nach Berlin kam, und war (ist?) hier totunglücklich. Ihr Artikel ist etwas wehleidig, dann aber doch interessant, weil sie ihre Situation mit der von Henry James' großem Bruder William vergleicht, der mit 25 Jahren in Berlin gestrandet war und auch nicht wusste, was aus ihm werden und was er mit dieser Stadt anfangen sollte: "Lieber Gott, was ist das mit mir und Männern und Willam James? Ich habe angefangen ihn zu lesen, weil ich in einen Jungen verknallt war. Einen Jungen, der ein geflochtenes Hanfhalsband trug. Meine romantische Entblößung kennt keine Grenzen. Eines Nachts verkündete er beim Abendessen, aus dem Blauen, dass 'Varieties of Religious Experience' sein Lieblingssachbuch aller Zeiten sei. Es war nicht die erste Erwähnung von James. Seit Monaten kam sein Name immer wieder auf. Er wurde in Büchern zitiert, die ich las, Freunde erwähnten ihn im Gespräch. Aber ich dachte immer, ooch, ein toter weißer Philosoph von der Ostküste? Der in Harvard lehrte? Nichts für mich. Es musste schon ein hübsches Gesicht (mit einem Hanfhalsband) kommen, bevor ich aufgab und die 'Varieties' las. Und damit änderte sich alles."
Elet es Irodalom (Ungarn), 14.11.2012
 Die meisten Künstler in Ungarn sind von der Politik angewidert und wollen sich, aus Prinzip, Bequemlichkeit oder Existenzangst, aus den parteipolitischen Grabenkämpfen heraushalten. Aber Künstler haben eine Verantwortung, ruft der Theatermacher Árpád Schilling empört seinen Kollegen zu: "Dieser Opportunismus ist inakzeptabel! Dieses feige Schweigen ist inakzeptabel! Die freie Meinungsäußerung ist in manchen Fällen nicht nur ein Grundrecht, sondern auch eine berufliche Pflicht. Wann verstehen Sie denn endlich, dass die aus Existenzangst vermiedene Stellungnahme gerade die Existenz unmöglich machen wird, die jene, die alles dulden, zu schützen meinen. Wenn wir uns nicht dazu äußern, dass die Maschine von Dilettanten betrieben wird, dann steht die Maschine früher oder später still. Wenn wir der Versuchung zu schweigen erliegen, werden wir unbemerkt zwischen den Zahnrädern eingeklemmt werden, und das letzte Zucken der Maschinerie wird zugleich unser aller Todesseufzer. Werden Sie doch endlich politisch!"
Die meisten Künstler in Ungarn sind von der Politik angewidert und wollen sich, aus Prinzip, Bequemlichkeit oder Existenzangst, aus den parteipolitischen Grabenkämpfen heraushalten. Aber Künstler haben eine Verantwortung, ruft der Theatermacher Árpád Schilling empört seinen Kollegen zu: "Dieser Opportunismus ist inakzeptabel! Dieses feige Schweigen ist inakzeptabel! Die freie Meinungsäußerung ist in manchen Fällen nicht nur ein Grundrecht, sondern auch eine berufliche Pflicht. Wann verstehen Sie denn endlich, dass die aus Existenzangst vermiedene Stellungnahme gerade die Existenz unmöglich machen wird, die jene, die alles dulden, zu schützen meinen. Wenn wir uns nicht dazu äußern, dass die Maschine von Dilettanten betrieben wird, dann steht die Maschine früher oder später still. Wenn wir der Versuchung zu schweigen erliegen, werden wir unbemerkt zwischen den Zahnrädern eingeklemmt werden, und das letzte Zucken der Maschinerie wird zugleich unser aller Todesseufzer. Werden Sie doch endlich politisch!"New York Review of Books (USA), 06.12.2012
Perry Link macht einen überraschenden Einwand gegen Mo Yan. Gerade der drastische Humor, mit dem Mo etwa Folterszenen in der Zeit des Maoismus schildert, so Link, hat etwas Anpasserisches und Entlastendes: "Verteidiger von Mo Yan, innerhalb und außerhalb des Nobelpreiskomitees halten ihm 'Schwarzen Humor' zu gute. Mag sein. Aber andere, auch Nachfahren von Opfern dieser Exzesse, fragen sich verständlicher Weise, was daran so komisch sein soll. Vom Standpunkt des Regimes ist diese Art des Schreibens nützlich, nicht nur weil sie von einem direkten Blick aufs Geschehen ablenkt, sondern auch wegen ihrer Funktion als Sicherheitsventil. Dies sind immer noch heikle, potenziell explosive Themen. Fürs Regime ist es vielleicht besser, sie als Witz zu behandeln, als sie einfach zu unterdrücken. In einem Artikel von 2004 mit dem Titel 'Der erotische Karneval in der jüngsten chinesischen Geschichte', schreibt Liu Xiaobo: 'Sarkasmus ist zu einer Art geistigen Botschaft geworden, die das Gewissen und das Gedächtnis der Menschen betäubt.'"
Humanities (USA), 01.12.2012
 Zu Bram Stokers Zeiten gab es noch keine Fan-Webseiten, die 24 Stunden am Tag um ihren Lieblingsvampir kreisten. Aber was ein Fan ist, wusste der spätere Dracula-Autor sehr wohl, meint Meredith Hindley. Der 22-jährige Ire Stoker verehrte nämlich einen ältlichen amerikanischen Dichter, den er als Student erst verlacht hatte. 1872 schrieb er ihm einen 2000 Worte langen Brief - die Art Brief, für die man sich den Rest seines Lebens schämt, wenn er nicht angenommen wird. Aber glücklicherweise war Walt Whitman nie hochnäsig und antwortete. "Jahre später erinnerte sich Horace Traubel an diesen Briefwechsel in seinem Buch 'Mit Walt Whitman in Camden': 'Er war ein frecher Teenager', sagte Whitman über Stoker. 'Es kam mir nie in den Sinn, die Briefe zu verbrennen. Warum zur Hölle sollte es mich kümmern, ob sie gehörig waren oder nicht? Er war frisch, kess, irisch: das war der Eintrittspreis und mehr - er war willkommen!' Whitman bemerkte auch, dass Stoker mehr an sich selbst geschrieben hatte als an den Dichter. 'Ich konnte nur warm und das heißt persönlich darauf antworten: mit meinem ganzen Herzen.'"
Zu Bram Stokers Zeiten gab es noch keine Fan-Webseiten, die 24 Stunden am Tag um ihren Lieblingsvampir kreisten. Aber was ein Fan ist, wusste der spätere Dracula-Autor sehr wohl, meint Meredith Hindley. Der 22-jährige Ire Stoker verehrte nämlich einen ältlichen amerikanischen Dichter, den er als Student erst verlacht hatte. 1872 schrieb er ihm einen 2000 Worte langen Brief - die Art Brief, für die man sich den Rest seines Lebens schämt, wenn er nicht angenommen wird. Aber glücklicherweise war Walt Whitman nie hochnäsig und antwortete. "Jahre später erinnerte sich Horace Traubel an diesen Briefwechsel in seinem Buch 'Mit Walt Whitman in Camden': 'Er war ein frecher Teenager', sagte Whitman über Stoker. 'Es kam mir nie in den Sinn, die Briefe zu verbrennen. Warum zur Hölle sollte es mich kümmern, ob sie gehörig waren oder nicht? Er war frisch, kess, irisch: das war der Eintrittspreis und mehr - er war willkommen!' Whitman bemerkte auch, dass Stoker mehr an sich selbst geschrieben hatte als an den Dichter. 'Ich konnte nur warm und das heißt persönlich darauf antworten: mit meinem ganzen Herzen.'"
Kommentieren