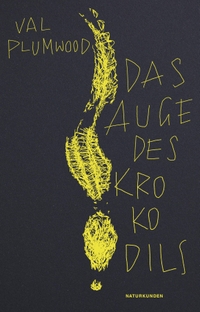Magazinrundschau
Entblößt von jedem wohligen Schmelz
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
07.09.2010. Kelek ist der Treitschke Bahners, lernen wir aus den Blättern. Auch in den goldenen Zeiten der Moderne hatten Schriftsteller es schwer, ermuntert Tom McCarthy angehende Schriftsteller im Guardian. In Le Monde kritisiert Andre Glucksmann die Ausweisung der Roma aus Frankreich. Das Magazin erzählt, wie man eine verrottende Kleinstadt wieder in Schwung bringt. In Elet es Irodalom feiert Laszlo Földenyi die Bilder des Malers Uri Asaf. In NZZ Folio blicken neun Schriftsteller in die Zukunft. Vanity Fair gruselt sich vor der griechischen Wirtschaft.
Blätter f. dt. u. int. Politik (Deutschland), 01.09.2010
 Auch Aufklärung ist eine Religion, meint der FAZ-Feuilletonchef Patrick Bahners, der in einer Berliner Rede auf die große Islam-Debatte des Perlentauchers vor drei Jahren eingeht. Und die Islamkritiker Ayaan Hirsi Ali, Necla Kelek und Ralph Giordano sind die heutigen Treitschkes, so Bahners weiter und zitiert den Historiker Heinrich von Treitschke, der 1879 verkündet hatte: "Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: die Juden sind unser Unglück!" Sein Kollege Theodor Mommsen erwiderte ihm ein Jahr später: "Herr von Treitschke ist ein redegewaltiger Mann; aber er selbst hat doch wohl kaum geglaubt, dass auf seine Allokution hin die Juden nun, wie er es ausdrückt, sämtlich deutsch werden würden. Und wenn nicht, was dann?" Genau diese Frage, findet Bahners, sollte man auch den heutigen Islamkritikern stellen: "Nicht wie aus einem Munde, aber immer lauter ertönt es heute: Der Islam ist das Problem. Was haben diejenigen gewollt, die diese Parole lancieren? Ralph Giordano und Henryk M. Broder sind redegewaltige Männer. Aber sie haben wohl kaum geglaubt, dass sämtliche Muslime deutscher Nationalität nach Lektüre der Autobiografie von Ayaan Hirsi Ali vom Glauben abfallen würden. Aber wenn nicht - was dann?"
Auch Aufklärung ist eine Religion, meint der FAZ-Feuilletonchef Patrick Bahners, der in einer Berliner Rede auf die große Islam-Debatte des Perlentauchers vor drei Jahren eingeht. Und die Islamkritiker Ayaan Hirsi Ali, Necla Kelek und Ralph Giordano sind die heutigen Treitschkes, so Bahners weiter und zitiert den Historiker Heinrich von Treitschke, der 1879 verkündet hatte: "Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: die Juden sind unser Unglück!" Sein Kollege Theodor Mommsen erwiderte ihm ein Jahr später: "Herr von Treitschke ist ein redegewaltiger Mann; aber er selbst hat doch wohl kaum geglaubt, dass auf seine Allokution hin die Juden nun, wie er es ausdrückt, sämtlich deutsch werden würden. Und wenn nicht, was dann?" Genau diese Frage, findet Bahners, sollte man auch den heutigen Islamkritikern stellen: "Nicht wie aus einem Munde, aber immer lauter ertönt es heute: Der Islam ist das Problem. Was haben diejenigen gewollt, die diese Parole lancieren? Ralph Giordano und Henryk M. Broder sind redegewaltige Männer. Aber sie haben wohl kaum geglaubt, dass sämtliche Muslime deutscher Nationalität nach Lektüre der Autobiografie von Ayaan Hirsi Ali vom Glauben abfallen würden. Aber wenn nicht - was dann?"London Review of Books (UK), 09.09.2010
 Jenny Turner hat "C" gelesen, den neuen Roman des furiosen Antirealisten Tom McCarthy, in dem dieser seinen Helden Serge Carrefax durch die Diskurse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schickt . Und wenngleich Turner im Wirbel aus Anspielungen und Verweisen nicht immer alles ohne weitere versteht - begeistert ist sie doch: "Sie werden inzwischen begriffen haben, dass ich eine großartige Zeit hatte bei der Lektüre, auf meinen Laptop gestützt, Wikipedia im einen Fenster, das Oxford English Dictionary im anderen Fenster immer geöffnet. Es war, als wäre ich zu Gast bei der Traumparty eines extrem belesenen Gastgebers: Dinge, die ich vor langer Zeit gelesen und mehr oder weniger vergessen, andere Dinge, die ich nie gelesen habe, jetzt aber auf jeden Fall lesen werden, nachdem mir McCarthy gezeigt hat, wie man sie brillant einsetzen kann. Er vergleicht seinen Job als Autor manchmal mit dem eines DJs oder Kurators, der ein Set ans andere fügt: die Analogie trifft, so lange sie einen nicht auf die falsche Idee bringt, das ganze habe mit Literatur wenig zu tun."
Jenny Turner hat "C" gelesen, den neuen Roman des furiosen Antirealisten Tom McCarthy, in dem dieser seinen Helden Serge Carrefax durch die Diskurse der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schickt . Und wenngleich Turner im Wirbel aus Anspielungen und Verweisen nicht immer alles ohne weitere versteht - begeistert ist sie doch: "Sie werden inzwischen begriffen haben, dass ich eine großartige Zeit hatte bei der Lektüre, auf meinen Laptop gestützt, Wikipedia im einen Fenster, das Oxford English Dictionary im anderen Fenster immer geöffnet. Es war, als wäre ich zu Gast bei der Traumparty eines extrem belesenen Gastgebers: Dinge, die ich vor langer Zeit gelesen und mehr oder weniger vergessen, andere Dinge, die ich nie gelesen habe, jetzt aber auf jeden Fall lesen werden, nachdem mir McCarthy gezeigt hat, wie man sie brillant einsetzen kann. Er vergleicht seinen Job als Autor manchmal mit dem eines DJs oder Kurators, der ein Set ans andere fügt: die Analogie trifft, so lange sie einen nicht auf die falsche Idee bringt, das ganze habe mit Literatur wenig zu tun."Weitere Artikel: Jonathan Steele erklärt im "Tagebuch", was man über die Taliban, die sich seit zehn Jahren fast komplett aus der westlichen Medienöffentlichkeit zurückgezogen haben, so alles nicht weiß. Tony Wood hat sich im sibirischen Yakutsk umgesehen und bringt Eindrücke vom Permafrost, Infomationen zur Wissenschaft der "Frozenology" ("Gefrierologie"?) und weit auseinandergehende Meinungen der russischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zur Klimaerwärmung mit. Michael Wood hat im Kino Bob Rafelsons Semiklassiker "Five Easy Pieces" wiedergesehen. Mary-Kay Wilmers schreibt zum Tod des Literaturwissenschaftlers und London-Review-Inspirators und -Autors Frank Kermode.
Guardian (UK), 04.09.2010
Der Literaturwissenschaftler Gabriel Josipovici, der jüngst die zeitgenössischen britischen Autoren wie Salman Rushdie, Ian McEwan und Martin Amis für überschätzt, arrogant und spießig erklärt hat, trauert in seinem Buch "What ever happened to Modernism?" um die Avantgarde, die es irgendwie nicht ins 21 Jahrhundert geschafft hat. Der Schriftsteller Tom McCarthy begrüßt Josipovicis Buch sehr: "Kulturell gesehen leben wir in zutiefst konservativen Zeiten. In vielen größeren Verlagshäusern müssen die Lektoren Inhaltsangaben von Romanen ausgewählten Lesergruppen vorlegen, bevor sie sie veröffentlichen dürfen; Literaturfestivals bieten Nachrichtensprecher und andere Medienprominente auf. Trotzdem sollten wir nicht glauben, dass die Dinge im Goldenen Zeitalter der Moderne so viel anders waren. Joyces 'Ulysses' wurde 1922 in Paris mit einer Auflage von 1000 Büchern auf einer privaten Druckerpresse [der Buchhändlerin Sylvia Beach] gedruckt; aus der kleinen Auflage von Kafkas 'Verwandlung' wurden 1915 elf Exemplare verkauft - zehn davon kaufte Kafka. Aber kann einer die erfolgreichen Middlebrow-Autoren der Jahre 1922 oder 1915 nennen? Natürlich nicht. Das sollte Josipovici trösten."
Außerdem: Alberto Manguel feiert Daniel Kehlmanns nun auch auf Englisch erschienenen Roman "Ruhm". Ohne große Freude liest der Autor Giles Goden V.S. Naipauls neues Buch "The Masque of Africa": "Nie schreibt er über Afrika mit etwas, was Liebe auch nur nahe käme." Stephen Moss räumt zähneknirschend ein, dass Norman Lebrechts Buch "Why Mahler?" nicht nur "packend und informativ" ist, sondern auch besser als vieles, was er selbst schreibt.
Außerdem: Alberto Manguel feiert Daniel Kehlmanns nun auch auf Englisch erschienenen Roman "Ruhm". Ohne große Freude liest der Autor Giles Goden V.S. Naipauls neues Buch "The Masque of Africa": "Nie schreibt er über Afrika mit etwas, was Liebe auch nur nahe käme." Stephen Moss räumt zähneknirschend ein, dass Norman Lebrechts Buch "Why Mahler?" nicht nur "packend und informativ" ist, sondern auch besser als vieles, was er selbst schreibt.
Le Monde (Frankreich), 01.09.2010
Die Roma sind Europäer, und Europäer haben Reisefreiheit, schreibt Andre Glucksmann zu den populistischen Ausweisungen von Zigeunern aus Frankreich: "Es gibt ein heiteres Bild der Entwurzelung - das sind die 300.000 französischen Expats, die sich in der City bereichern, wenn die Börse steigt. Und es gibt ein tragisches Bild - das sind jene fahrenden Leute, die man von einem wilden Zeltplatz zum anderen jagt und denen man auf diese Weise das Recht zu reisen und zu betteln nimmt, das bisher nur der Kommunismus mit Gewalt brechen wollte. Roma machen Angst. Wer Roma versteckt, versteckt unsere Brüder in der Entwurzelung, die ein unausweichlicher und beängstigender Teil unseres Schicksals sind. Die Angst vor den Roma ist eine uneingestandene Angst vor uns selbst."
Salon.eu.sk (Slowakei), 04.09.2010
 In Polen ist ein heftiger Streit um ein Kreuz entbrannt. Es wurde kurz nach dem Flugzeugunglück von Smolensk zur Erinnerung an Lech Kaczynski und die weiteren 95 Toten vor dem Präsidentenpalast aufgestellt. Eigentlich sollte es ein Provisorium sein, aber sogenannte "Kreuzritter" verhindern seitdem, dass es - wie ursprünglich vereint - in die St. Anna-Kirche gebracht wird (mehr dazu hier). "Willkommen in Polen, dem neuen Mittelalter", mit diesem Ausruf sollten wir künftig Touristen begrüßen, spottet Magdalena Sroda in Wprost (von Salon ins Englische übersetzt). In Polen gebe es kein Disneyland, sondern das echte, authentische Ding: "Das Erziehungsministerium hat - unter jeder Regierung, von links bis rechts - alles getan, um sicherzustellen, dass ein Zustand vollkommener Ignoranz in allen Fragen der Ethik und zeitgenössischer Moral aufrechterhalten wird. Gerade erst wurde ein neuer Sprecher für Bürgerrechte (für das neue Mittelalter) ernannt, der garantieren soll, dass die Lehrpläne für den Ethikunterricht mit der Katholischen Kirche abgestimmt werden. Neue Generationen werden aufwachsen in dem Wissen, dass nichts Böseres existiert als Abtreibung und Homosexualität und nichts Besseres als Johannes Paul II, denn das hat der Vatikan verfügt."
In Polen ist ein heftiger Streit um ein Kreuz entbrannt. Es wurde kurz nach dem Flugzeugunglück von Smolensk zur Erinnerung an Lech Kaczynski und die weiteren 95 Toten vor dem Präsidentenpalast aufgestellt. Eigentlich sollte es ein Provisorium sein, aber sogenannte "Kreuzritter" verhindern seitdem, dass es - wie ursprünglich vereint - in die St. Anna-Kirche gebracht wird (mehr dazu hier). "Willkommen in Polen, dem neuen Mittelalter", mit diesem Ausruf sollten wir künftig Touristen begrüßen, spottet Magdalena Sroda in Wprost (von Salon ins Englische übersetzt). In Polen gebe es kein Disneyland, sondern das echte, authentische Ding: "Das Erziehungsministerium hat - unter jeder Regierung, von links bis rechts - alles getan, um sicherzustellen, dass ein Zustand vollkommener Ignoranz in allen Fragen der Ethik und zeitgenössischer Moral aufrechterhalten wird. Gerade erst wurde ein neuer Sprecher für Bürgerrechte (für das neue Mittelalter) ernannt, der garantieren soll, dass die Lehrpläne für den Ethikunterricht mit der Katholischen Kirche abgestimmt werden. Neue Generationen werden aufwachsen in dem Wissen, dass nichts Böseres existiert als Abtreibung und Homosexualität und nichts Besseres als Johannes Paul II, denn das hat der Vatikan verfügt."Boston Globe (USA), 05.09.2010
Städte haben sich eigentlich immer nur um "smartes Wachstum" gekümmert. Aber erstmals in der Weltgeschichte nimmt die Stadtbevölkerung ab. Schlaue Städteplaner denken daher über "smartes Schrumpfen" nach. Nicht nur in Ostdeutschland, auch in Amerika!, verkündet Drake Bennett. "In den vergangenen 50 Jahren hat die Stadt Detroit mehr als die Hälfte seiner Einwohner verloren. Ebenso Cleveland. Und sie stehen nicht allein da: Acht der 1950 zehn größten Städte der USA, inklusive Boston, haben seitdem mindestens zwanzig Prozent ihrer Bevölkerung verloren. Doch während Boston in den letzten Jahren diesen Schwund ein wenig ausgleichen und sich selbst zum Hort einer blühender Angestellten-Ökonomie entwickeln konnte, zeigen die weitaus drastischen Verluste in Detroit, Youngstown, Ohio, oder Flint, Michigan - Verluste an Menschen, Jobs, Geld und sozialen Bindungen - keine Anzeichen einer Kehrtwende. Die Immobilienkrise hat diesen Prozess nur beschleunigt."
Das Magazin (Schweiz), 04.09.2010
 Peter Haffner schickt eine Reportage aus Braddock, einem kleinen Ort aus Pennsylvania, der nach dem Niedergang der Stahlindustrie verfiel. Immer mehr Leute zogen fort, die Häuser kamen herunter, die Drogen nahmen zu. Seit 2005 hat Braddock einen neuen Bürgermeister: John Fetterman, 2,11 Meter groß, 170 Kilo schwer, kahl rasierter Schädel, Ziegenbart, Sohn aus reichem Haus und Harvard Absolvent. "Heute macht Braddock von sich reden, weil Fetterman darin etwas sah, was andere nicht sahen. Statt zu beklagen, an was es allem fehlt, warb er mit dem, was es im Überfluss hat: Wohn- und Lebensraum für Künstler, die kein Geld haben, für Jungunternehmer, die sich das Startkapital vom Mund absparen müssen, für urbane Pioniere, die das Unfertige dem Fertigen vorziehen. Und für Außenseiter, die es bleiben wollen, wie Fetterman selber. 'Sie könnten mir nicht genug zahlen, nach Manhattan zu ziehen', sagt er. 'Ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, mein eigenes Nest auszupolstern.'"
Peter Haffner schickt eine Reportage aus Braddock, einem kleinen Ort aus Pennsylvania, der nach dem Niedergang der Stahlindustrie verfiel. Immer mehr Leute zogen fort, die Häuser kamen herunter, die Drogen nahmen zu. Seit 2005 hat Braddock einen neuen Bürgermeister: John Fetterman, 2,11 Meter groß, 170 Kilo schwer, kahl rasierter Schädel, Ziegenbart, Sohn aus reichem Haus und Harvard Absolvent. "Heute macht Braddock von sich reden, weil Fetterman darin etwas sah, was andere nicht sahen. Statt zu beklagen, an was es allem fehlt, warb er mit dem, was es im Überfluss hat: Wohn- und Lebensraum für Künstler, die kein Geld haben, für Jungunternehmer, die sich das Startkapital vom Mund absparen müssen, für urbane Pioniere, die das Unfertige dem Fertigen vorziehen. Und für Außenseiter, die es bleiben wollen, wie Fetterman selber. 'Sie könnten mir nicht genug zahlen, nach Manhattan zu ziehen', sagt er. 'Ich möchte nicht mein Leben damit verbringen, mein eigenes Nest auszupolstern.'" Auf der Webseite des Radiosender PBS erklärt Fetterman seine Politik im Videointerview. Eins seiner Projekte war übrigens eine Partnerschaft mit der Jeansfirma Levis, die Braddock als Hintergrund für eine Werbekampagne nutzte und dafür einen Teil des Gemeinschaftszentrum finanzierte. Der Film, in drei Teilen auf Youtube zu sehen, ist gar nicht so schlecht, man lernt einige Leute aus Braddock kennen. Hier der erste Teil:
Elet es Irodalom (Ungarn), 03.09.2010
 In der Budapester Galerie "Klauzal 13" werden derzeit die Bilder des israelischen Malers Uri Asaf gezeigt. Der Essayist Laszlo F. Földenyi steht vor dieser "verschwommenen Farbenwelt, mit ihren nebelhaften Ballungen und unbestimmten Konturen" und überlegt, warum ihn diese Bilder so anziehen. "Uri Asaf malt wie ein Mensch, dem wenig Zeit bleibt und der deshalb sofort zur Sache kommt: Ihn interessiert nur, was er existenziell für wichtig hält. Solch eine Haltung trifft einen stets unvorbereitet. Daher kommt es, dass seine Bilder einen nach so kurzer Zeit ansprechen. [...] Asaf versucht, das Nicht-Wahrnehmbare in den Kreis der wahrnehmbaren Dinge mit einzubeziehen. Als Maler fühlt er sich in der Sinnlichkeit wie zu Hause. Je mehr er jedoch ins Sinnliche eindringt, desto feiner und entrückter wird es auf seinen Bildern, bis sich herausstellt, dass die Grenze des Wahrnehmbaren ab einem gewissen Punkt das Nicht-Wahrnehmbare ist. Was das ist, weiß ich nicht. Ich könnte es geistig oder spirituell nennen, doch scheinen mir diese Begriffe zu schwach. Ich weiß nur, dass man auch in den Tiefen der sinnlichsten Phänomene früher oder später etwas entdeckt, was ich am ehesten noch mit den Begriffen 'Rätsel', und 'Mysterium' umschreiben könnte. Ich schaue mir die Bilder von Uri Asaf an und lasse mich von diesem Rätsel einsaugen."
In der Budapester Galerie "Klauzal 13" werden derzeit die Bilder des israelischen Malers Uri Asaf gezeigt. Der Essayist Laszlo F. Földenyi steht vor dieser "verschwommenen Farbenwelt, mit ihren nebelhaften Ballungen und unbestimmten Konturen" und überlegt, warum ihn diese Bilder so anziehen. "Uri Asaf malt wie ein Mensch, dem wenig Zeit bleibt und der deshalb sofort zur Sache kommt: Ihn interessiert nur, was er existenziell für wichtig hält. Solch eine Haltung trifft einen stets unvorbereitet. Daher kommt es, dass seine Bilder einen nach so kurzer Zeit ansprechen. [...] Asaf versucht, das Nicht-Wahrnehmbare in den Kreis der wahrnehmbaren Dinge mit einzubeziehen. Als Maler fühlt er sich in der Sinnlichkeit wie zu Hause. Je mehr er jedoch ins Sinnliche eindringt, desto feiner und entrückter wird es auf seinen Bildern, bis sich herausstellt, dass die Grenze des Wahrnehmbaren ab einem gewissen Punkt das Nicht-Wahrnehmbare ist. Was das ist, weiß ich nicht. Ich könnte es geistig oder spirituell nennen, doch scheinen mir diese Begriffe zu schwach. Ich weiß nur, dass man auch in den Tiefen der sinnlichsten Phänomene früher oder später etwas entdeckt, was ich am ehesten noch mit den Begriffen 'Rätsel', und 'Mysterium' umschreiben könnte. Ich schaue mir die Bilder von Uri Asaf an und lasse mich von diesem Rätsel einsaugen."Der Verfassungsrechtler Gabor Halmai hat kürzlich befürchtet, Ungarn werde sich unter der Leitung der neuen Regierung von der Rechtsstaatlichkeit verabschieden (mehr hier). Der Philosoph Attila Ara-Kovacs und der Rechtsanwalt Matyas Eörsi fanden diese Furcht übertrieben: Demokratie sei nun mal nichts fertiges, und aus jeder Krise könne man lernen (mehr hier). Der Literaturwissenschaftler Sandor Radnoti hoffte auf eine Hinwendung und Treue der Bevölkerung zu einer "unsichtbaren Verfassung", einem "Vaterland in der Höhe" (mehr hier). Der Politologe Zoltan Fleck muss wohl eher unter die Pessimisten eingereiht werden. Eine stabile Demokratie braucht eine stabile Zivilgesellschaft, und an der fehlt es in Ungarn, schreibt er. "Innerhalb zweier Jahrzehnte wurde der Satz 'wir sind Teil Europas' zu einem leeren Slogan und trotz aller institutionellen Kompatibilität ist diese Europäisierung in den Tiefen der Gesellschaft fragmentarisch geblieben. Die Flucht vor der Freiheit ist heute stärker als der Wunsch, ein europäischer Bürger zu werden. Letzteres erfordert nämlich zivile Aktivität, kritische Attitüde, den Geist der Freiheit und eine republikanische Moralität. Die Illusion, diese Werte könnten auf spontane Weise, auf der Basis unserer tausendjährigen Tradition entstehen, wurde von der jetzigen Regierung durch die Negation all dieser Werte ersetzt. Diese beiden konkurrierenden, einander stärkenden Strategien nehmen dem Land jede Chance, sich zu einer modernen Demokratie zu entwickeln."
Economist (UK), 03.09.2010
 In einem Dossier zur Titelgeschichte "Die neuen Mauern des Internets" untersucht der Economist aktuelle Trends und Tendenzen rund ums Internet. Es geht dabei unter anderem um die Hürden für die Konvergenz von Film, Internet und Fernsehen (als Gewinner dieses Zukunftsmarkts komme dabei vor allem das US-Unternehmen Netflix in Frage, das nicht mehr nur DVDs per Post verschickt, sondern Filme 'streamt'); um die Frage der Netzneutralität beziehungsweise allgemeiner gefasst: die Balkanisierung des zunächst als Macht der Vereinheitlichung und Verbindung auftretenden Netzes; und - vielleicht am interessantesten - um die ziemlich alptraumhaften Möglichkeiten, die sich mit Hilfe neuer Techniken der Datenauswertung bieten: "Die Ausweitung des 'Data Mining' auf die sozialen Netzwerke eröffnet ganz neue Horizonte: Die Modellierung sozialer Beziehungen ähnelt der Erstellung eines 'Indexes der Macht', meint der Netzwerkexperte Stephen Borgatti. In manchen Unternehmen nützen die Chefs automatische Analysen des E-Mail-Verkehr fürs bessere Management. Angestellte, die oft um Rat gefragt werden, könnten, nur zum Beispiel, gute Kandidaten für eine Beförderung sein... Oder jemand, der sich um einen Kredit bewirbt, könnte ein Risiko oder gar ein Betrüger sein, wenn er ein Geschäft starten will, das keine Verbindung zu seinem sozialen Netzwerk, zu seiner Ausbildung, früheren Unternehmungen oder seiner Reisegeschichte hat - alles Daten, die man anhand der Kreditkartenabrechnungen ermitteln kann... Manche Versicherungen verlangen inzwischen geringere Gebühren von Banken, die sich solcher Software bedienen."
In einem Dossier zur Titelgeschichte "Die neuen Mauern des Internets" untersucht der Economist aktuelle Trends und Tendenzen rund ums Internet. Es geht dabei unter anderem um die Hürden für die Konvergenz von Film, Internet und Fernsehen (als Gewinner dieses Zukunftsmarkts komme dabei vor allem das US-Unternehmen Netflix in Frage, das nicht mehr nur DVDs per Post verschickt, sondern Filme 'streamt'); um die Frage der Netzneutralität beziehungsweise allgemeiner gefasst: die Balkanisierung des zunächst als Macht der Vereinheitlichung und Verbindung auftretenden Netzes; und - vielleicht am interessantesten - um die ziemlich alptraumhaften Möglichkeiten, die sich mit Hilfe neuer Techniken der Datenauswertung bieten: "Die Ausweitung des 'Data Mining' auf die sozialen Netzwerke eröffnet ganz neue Horizonte: Die Modellierung sozialer Beziehungen ähnelt der Erstellung eines 'Indexes der Macht', meint der Netzwerkexperte Stephen Borgatti. In manchen Unternehmen nützen die Chefs automatische Analysen des E-Mail-Verkehr fürs bessere Management. Angestellte, die oft um Rat gefragt werden, könnten, nur zum Beispiel, gute Kandidaten für eine Beförderung sein... Oder jemand, der sich um einen Kredit bewirbt, könnte ein Risiko oder gar ein Betrüger sein, wenn er ein Geschäft starten will, das keine Verbindung zu seinem sozialen Netzwerk, zu seiner Ausbildung, früheren Unternehmungen oder seiner Reisegeschichte hat - alles Daten, die man anhand der Kreditkartenabrechnungen ermitteln kann... Manche Versicherungen verlangen inzwischen geringere Gebühren von Banken, die sich solcher Software bedienen."Liberation (Frankreich), 03.09.2010
Während Deutschland strikt mit seinen eigenen Debatten um die Immigration und die Muslime befasst ist, geht in Frankreich die maßgeblich von Bernard-Henri Levy befeuerte Kampagne gegen die geplante Steinigung der Iranerin Sakineh Ashtiani weiter. Für Liberation interviewt Levy per Mobiltelefon den Sohn Ashtianis, Sajjad, einen Busschaffner, der von neuen Schikanen gegen seine Mutter berichtet. Und dann folgt diese Passage:
"Sajjad: Meiner Mutter, die nichts getan hat, droht Steinigung. Während der wirkliche Mörder, Taheri [er soll den Ehemann Ashtianis ermordet haben, mehr hier], frei herumläuft...
Levy: Weil Sie ihm verziehen haben...
Sajjad: Ja. Er ist Vater einer kleinen Tochter von drei Jahren. Er hat im Gespräch mit uns viel geweint. Meine Schwester und ich wollten nicht schuld sein an seiner Hinrichtung." Der Vollzug der Hinrichtung Ashtianis ist vorerst ausgesetzt. Gleichzeitig meldet Liberation aber, dass Ashtiani zusätzlich zu 99 Peitschenhieben verurteilt worden sei.
Levys Blog La regle du jeu setzt unterdes seine Kampagne mit Briefen Prominenter an Ashtiani fort. Geschrieben haben unter anderem Isabelle Huppert und Roberto Saviano.
"Sajjad: Meiner Mutter, die nichts getan hat, droht Steinigung. Während der wirkliche Mörder, Taheri [er soll den Ehemann Ashtianis ermordet haben, mehr hier], frei herumläuft...
Levy: Weil Sie ihm verziehen haben...
Sajjad: Ja. Er ist Vater einer kleinen Tochter von drei Jahren. Er hat im Gespräch mit uns viel geweint. Meine Schwester und ich wollten nicht schuld sein an seiner Hinrichtung." Der Vollzug der Hinrichtung Ashtianis ist vorerst ausgesetzt. Gleichzeitig meldet Liberation aber, dass Ashtiani zusätzlich zu 99 Peitschenhieben verurteilt worden sei.
Levys Blog La regle du jeu setzt unterdes seine Kampagne mit Briefen Prominenter an Ashtiani fort. Geschrieben haben unter anderem Isabelle Huppert und Roberto Saviano.
Folio (Schweiz), 06.09.2010
 NZZ Folio hatte die wunderbare Idee, neun Schriftsteller um eine Geschichte über die Zukunft zu bitten. Mit dabei: Yoko Tawada, Milena Moser, Judith Hermann, Wilhelm Genazino, Dorothee Elmiger, Anton Grünberg, Leon de Winter (alle Links hier). Und diese zwei:
NZZ Folio hatte die wunderbare Idee, neun Schriftsteller um eine Geschichte über die Zukunft zu bitten. Mit dabei: Yoko Tawada, Milena Moser, Judith Hermann, Wilhelm Genazino, Dorothee Elmiger, Anton Grünberg, Leon de Winter (alle Links hier). Und diese zwei:In Brigitte Kronauers Geschichte empfangen die Herren Franz, Hans und Heinz abends zum Schachspiel die Zukunft in Gestalt eines Herrn Fendle. Hier der Anfang der Geschichte: "Manchmal muss sich Herr Fritzle, Fritzle mit den Hochstammrosen nahe der Unterführung, beim Schachspielen mächtig zusammenreissen. Noch eben saß er friedlich zu einem Gläschen Genever mit den Freunden und einem Gast am Tisch, tut es immer noch, aber seine Gelassenheit ist dahin. Fritzle hat plötzlich das Gefühl, dass jemand draußen steht und durch die Scheiben beäugt, wie sie vier sich behaglich fühlen. Der Jemand tut ihnen nichts, aber er starrt sie schändlich an. Fritzle, das ist das Unheimliche, sieht auf einmal sich, die beiden Freunde und den redlichen Gadow mit den hungrigen Augenlöchern des Beobachters draußen an und wie grausig sie drinnen entblößt sind von jedem wohligen Schmelz. Fritzle wird diesen Jemand, diesen Schädling, das steht für ihn fest, niemals einlassen, und wenn der sich die Nase am Fenster blutig drückt! Natürlich hütet sich Fritzle, eine Silbe davon zu verraten. Er atmet nur tief auf, wenn die Musterung aus der Nacht für diesmal vorüber ist."
Lars Gustafssons Ich-Erzähler und Doktor Pecus sind mit dem Rad unterwegs zu einem Kloster, wo ein mysteriöses, altes Schaufelrad entdeckt wurde. Sie denken über dessen mögliche Erfinder nach: "'Ich glaube', murmelte ich zu Dr. Pectus hin, der sich immer noch über seinen Lenker beugte, als suche er nach einer defekten Stelle am Vorderreifen, 'ich glaube, was uns von den Alten trennt, ist, dass die Zeit für sie ganz und gar zusammenhängend gewirkt haben muss. Sie sahen offenbar Zeit und Raum als ein Kontinuum.' - 'Du hast so recht, mein Junge. Ja, so sahen sie es. Zweifellos.' - 'Sie haben keinen Zeitrutsch, keine Senkungen und Lawinen erlebt.' - 'Oder', sagte Dr. Pectus, der jetzt eher bemüht schien, das Gespräch zu beenden, um in seine eigenen Überlegungen zu flüchten, 'als sie zu verstehen begannen, war es leider eigentlich schon zu spät.' Die Alten hatten die kompliziertesten mathematischen Beweise den Maschinen überlassen. Irgendwann unterwegs war diese Unsicherheit entstanden. Was sie tatsächlich erfunden oder eher entdeckt hatten, war viel mehr, als sie selbst begreifen konnten. Ein Riss im dichten Gewebe der Zeit."
Magyar Narancs (Ungarn), 26.08.2010
 Die Geheimdienste sind seit dem 11. September in vieler Hinsicht zu den Praktiken des Kalten Krieges zurückgekehrt, stellt der Philosoph Attila Ara-Kovacs fest. Als Antwort darauf sei in vielen westlichen Staaten die Bestrebung zu beobachten, die innenpolitischen Folgen dieser Politik abzuwenden. Doch das gehe manchmal schief, so Ara-Kovacs, und nennt als Beispiel die jüngsten Enthüllungen von Wikileaks: "Mit diesem Experiment wollen die Kinder und Enkelkinder der einstigen Popgeneration dem Staat erneut sein Recht absprechen, nach Kräften alles zum Schutz der Gesellschaft zu unternehmen. Schließlich veröffentlicht Julian Assange, der Vater von Wikileaks, nur die geheimen Dokumente der Selbstverteidigung des Westens - über die islamistischen Beziehungen der türkischen oder pakistanischen Führung, über die Atompläne Teherans, über die zutiefst korrupten wirtschaftlichen Machenschaften und Folterungen bei der iranischen Islamischen Revolutionsgarde, oder über die geheimen Waffenpläne Putins im Kaukasus oder in der Arktis verliert er aber kein einziges Wort. Da unterscheidet sich Assange kaum von jenen - um einen Ausdruck Lenins zu benutzen - 'nützlichen Idioten', die zwischen den 1920er und 1950er Jahren ihre Geheimnisse nicht ihren eigenen demokratischen Staaten, sondern der Sowjetunion, dem unmenschlichen Objekt ihrer Illusionen, mitgeteilt hatten, und dies auch dann noch als gerechtfertigt empfanden, als die Folgen jede Illusion zunichte machten."
Die Geheimdienste sind seit dem 11. September in vieler Hinsicht zu den Praktiken des Kalten Krieges zurückgekehrt, stellt der Philosoph Attila Ara-Kovacs fest. Als Antwort darauf sei in vielen westlichen Staaten die Bestrebung zu beobachten, die innenpolitischen Folgen dieser Politik abzuwenden. Doch das gehe manchmal schief, so Ara-Kovacs, und nennt als Beispiel die jüngsten Enthüllungen von Wikileaks: "Mit diesem Experiment wollen die Kinder und Enkelkinder der einstigen Popgeneration dem Staat erneut sein Recht absprechen, nach Kräften alles zum Schutz der Gesellschaft zu unternehmen. Schließlich veröffentlicht Julian Assange, der Vater von Wikileaks, nur die geheimen Dokumente der Selbstverteidigung des Westens - über die islamistischen Beziehungen der türkischen oder pakistanischen Führung, über die Atompläne Teherans, über die zutiefst korrupten wirtschaftlichen Machenschaften und Folterungen bei der iranischen Islamischen Revolutionsgarde, oder über die geheimen Waffenpläne Putins im Kaukasus oder in der Arktis verliert er aber kein einziges Wort. Da unterscheidet sich Assange kaum von jenen - um einen Ausdruck Lenins zu benutzen - 'nützlichen Idioten', die zwischen den 1920er und 1950er Jahren ihre Geheimnisse nicht ihren eigenen demokratischen Staaten, sondern der Sowjetunion, dem unmenschlichen Objekt ihrer Illusionen, mitgeteilt hatten, und dies auch dann noch als gerechtfertigt empfanden, als die Folgen jede Illusion zunichte machten."Vanity Fair (USA), 01.10.2010
 Ziemlich erschüttert berichtet Michael Lewis über die Lage in Griechenland. An der Misere, so sein Schluss, ist das Land selbst schuld: "'Unsere Leuten konnten nicht glauben, was sie sahen, sagte mir ein höherer Beamter vom IWF kurz nach seiner ersten Griechenlandmission: 'Wie sie über ihre Finanzen Buch führten - sie wussten, auf welche Ausgaben sie sich geeinigt hatten, aber es gab keine Hinweise auf ihre tatsächlichen Ausgaben. Es war nicht nicht, was man eine sich entwickelnde Ökonomie nennt. Es war eine Drittwelt-Ökonomie.' Was die Griechen tun wollten, wenn die Lichter ausgingen und sie allein im Dunkeln mit Bergen von geborgtem Geld dastünden, war, so stellte sich heraus, ihre Regierung in eine Pinata zu verwandeln, gefüllt mit fantastischen Summen, und so vielen Bürgern wie möglich einen Schlag auf sie zu gewähren. Allein in der letzten Dekade haben sich die Lohnkosten im öffentlichen Sektor verdoppelt, und zwar real, wobei diese Zahlen nicht die Schmiergelder beinhalten, die öffentliche Angestellte einsammeln. Eine Stelle im öffentlichen Dienst wird fast dreimal höher bezahlt als im privaten Sektor. Bei der staatlichen Eisenbahn stehen im Jahr 100 Millionen Euro Einnahmen gegen jährliche Gehaltskosten von 400 Millionen, plus 300 Millionen Euro andere Ausgaben. Im Durchschnitt verdient ein Bahnangestellter 65.000 Euro im Jahr."
Ziemlich erschüttert berichtet Michael Lewis über die Lage in Griechenland. An der Misere, so sein Schluss, ist das Land selbst schuld: "'Unsere Leuten konnten nicht glauben, was sie sahen, sagte mir ein höherer Beamter vom IWF kurz nach seiner ersten Griechenlandmission: 'Wie sie über ihre Finanzen Buch führten - sie wussten, auf welche Ausgaben sie sich geeinigt hatten, aber es gab keine Hinweise auf ihre tatsächlichen Ausgaben. Es war nicht nicht, was man eine sich entwickelnde Ökonomie nennt. Es war eine Drittwelt-Ökonomie.' Was die Griechen tun wollten, wenn die Lichter ausgingen und sie allein im Dunkeln mit Bergen von geborgtem Geld dastünden, war, so stellte sich heraus, ihre Regierung in eine Pinata zu verwandeln, gefüllt mit fantastischen Summen, und so vielen Bürgern wie möglich einen Schlag auf sie zu gewähren. Allein in der letzten Dekade haben sich die Lohnkosten im öffentlichen Sektor verdoppelt, und zwar real, wobei diese Zahlen nicht die Schmiergelder beinhalten, die öffentliche Angestellte einsammeln. Eine Stelle im öffentlichen Dienst wird fast dreimal höher bezahlt als im privaten Sektor. Bei der staatlichen Eisenbahn stehen im Jahr 100 Millionen Euro Einnahmen gegen jährliche Gehaltskosten von 400 Millionen, plus 300 Millionen Euro andere Ausgaben. Im Durchschnitt verdient ein Bahnangestellter 65.000 Euro im Jahr."David Kirkpatrick blickt in einem Porträt bewundernd auf das Internet-Genie Sean Parker, der sich bereits mit 16 Jahren in die Rechner etlicher Großkonzerne eingehackt hatte, mit 19 half, Napster zu gründen, und 2004, mit 24 Jahren Facebook mit aufbaute. David Fincher hat einen Film über ihn gedreht, "The Social Network", mit Justin Timberlake in der Hauptrolle. "In der Darstellung von Drehbuchautor Aaron Sorkin, kommt Parker als aggressiver, gieriger - und, ja, visionärer - Stratege daher. 'Ein Million Dollar ist nicht cool', sagt Parker an einer Stelle des Films. 'Weißt Du, was cool ist? Eine Milliarde.' Zuckerberg, gespielt von Jesse Eisenberg kommt als großspurig, wütend und irgendwie sexbesessen rüber." In Wirklichkeit, so Kirkpatrick, ist Parker viel komplexer!
Christopher Hitchens stellt klar, dass er selbst auf die wohlmeinendsten Gebete für seine Gesundung nicht viel Hoffnung setzt, aber für medizinische Hilfe von hervorragenden Wissenschaftlern wie dem überzeugten Christen Francis Collins sehr dankbar ist.
Kommentieren