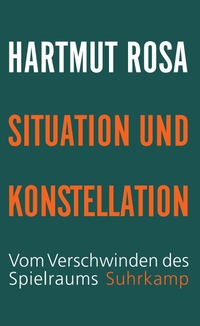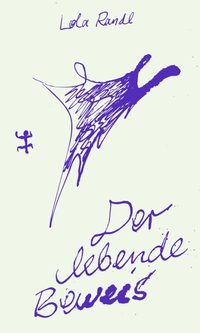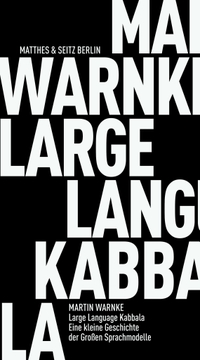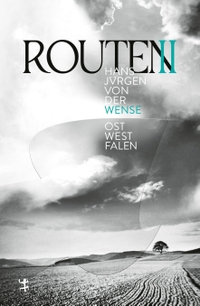Magazinrundschau
Symphonie der Solidarität
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
01.09.2020. Der New Yorker studiert am Beispiel Floridas, wie die Republikaner versuchen, die Wahlen über Zugangsbeschränkungen zu manipulieren. Im New York Magazine erklärt der Statistiker David Shor, welche Fehler die Demokraten machen. Im New Statesman fürchtet Christopher Clark aus historischen Gründen einen Krieg in Libyen. Wer den Preis der Dekolonialisierung wissen will, muss Albert Memmi lesen, ruft die London Review. Van lässt sich von dem Philosophen Timothy Morton die Freundlichkeit der Quantentheorie erklären.
New Yorker (USA), 07.09.2020
 In der neuen Ausgabe des Magazins befasst sich Dexter Filkins mit der Rolle Floridas bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA: "Für die Kandidaten ist Florida eine einzigartige Chance und eine lästige Herausforderung zugleich. Während andere große Staaten wie Texas und Kalifornien sicher entweder an die Republikaner oder an die Demokraten gehen, bleibt Florida unberechenbar. Umfragen legen nahe, dass Joe Biden dort verlieren, aber die Bundeswahl gewinnen könnte, obgleich Floridas 29 Wählerstimmen einen Sieg für ihn leichter machen würden. Trump kann laut Analysen ohne sie schlicht nicht gewinnen … Auch wenn Florida politisch gespalten ist, dominieren die Republikaner die staatliche Politik. Seit 1999 kontrollieren sie das Repräsentantenhaus und den Senat sowie den Gouverneurssitz. Ein Geheimnis ihres Erfolgs ist die Zugangsbeschränkung zu den Wahlen. Weniger Wähler, vor allem weniger schwarze Wähler, kamen ihnen meist zugute." Um schwarze Wähler am Wählen zu hindern, ist ihnen fast jedes Mittel recht: Frühes Wählen in den Kirchen oder Wählen der Studenten an den Universitäten wird mit den obskursten Mitteln verhindert. "Zuletzt verabschiedete die von den Republikanern dominierte Legislative ein Gesetz, wonach ehemalige Straftäter nur wählen können, wenn sie vorher all ihre Schulden, Gebühren und Strafen bezahlt haben, die im Zusammenhang mit ihrer Straftat stehen. Das Gesetz betrifft etwa 770.000 Einwohner von Florida, die Hälfte von ihnen schwarz. In vielen Fällen belaufen sich die ausstehenden Zahlungen auf Tausende von Dollars."
In der neuen Ausgabe des Magazins befasst sich Dexter Filkins mit der Rolle Floridas bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA: "Für die Kandidaten ist Florida eine einzigartige Chance und eine lästige Herausforderung zugleich. Während andere große Staaten wie Texas und Kalifornien sicher entweder an die Republikaner oder an die Demokraten gehen, bleibt Florida unberechenbar. Umfragen legen nahe, dass Joe Biden dort verlieren, aber die Bundeswahl gewinnen könnte, obgleich Floridas 29 Wählerstimmen einen Sieg für ihn leichter machen würden. Trump kann laut Analysen ohne sie schlicht nicht gewinnen … Auch wenn Florida politisch gespalten ist, dominieren die Republikaner die staatliche Politik. Seit 1999 kontrollieren sie das Repräsentantenhaus und den Senat sowie den Gouverneurssitz. Ein Geheimnis ihres Erfolgs ist die Zugangsbeschränkung zu den Wahlen. Weniger Wähler, vor allem weniger schwarze Wähler, kamen ihnen meist zugute." Um schwarze Wähler am Wählen zu hindern, ist ihnen fast jedes Mittel recht: Frühes Wählen in den Kirchen oder Wählen der Studenten an den Universitäten wird mit den obskursten Mitteln verhindert. "Zuletzt verabschiedete die von den Republikanern dominierte Legislative ein Gesetz, wonach ehemalige Straftäter nur wählen können, wenn sie vorher all ihre Schulden, Gebühren und Strafen bezahlt haben, die im Zusammenhang mit ihrer Straftat stehen. Das Gesetz betrifft etwa 770.000 Einwohner von Florida, die Hälfte von ihnen schwarz. In vielen Fällen belaufen sich die ausstehenden Zahlungen auf Tausende von Dollars."In einem anderen Beitrag macht sich Jill Lepore Gedanken über unser neues, altes Leben in den eigenen vier Wänden und wie wir es am besten gestalten: "Bereits vor der Pandemie und der Quarantäne verbrachten Amerikaner und Europäer neunzig Prozent ihrer Zeit drinnen, wie Joseph G. Allen und John D. Macomber in ihrem Buch 'Healthy Buildings: How Indoor Spaces Drive Performance and Productivity' feststellen. Wohnhäuser, Autos, Gefängnisse, Schulen, Busse, Fabriken, Züge, Flugzeuge, Büros, Museen, Krankenhäuser, Geschäfte, Restaurants: Wie viel deiner Lebenszeit verbringst du drinnen, ohne die Quarantäne? Multipliziere dein Alter mit 0,9. Wenn du 40 bist, hast du 36 Jahre drinnen verbracht, ein Drittel davon schlafend, aber immerhin. Die meisten Amerikaner und Europäer verbringen mehr Zeit drinnen als einige Walarten unter Wasser."
New York Magazine (USA), 17.07.2020
 Der Statistiker David Shor, der in Obamas Wahlkampfteam für Nathan Silver arbeitete, wurde über Nacht berühmt, als ihn sein Arbeitgeber Civis Analytics kürzlich wegen eines Tweets entließ, in dem Shor auf eine Studie aufmerksam machte, wonach 1968 gewaltlose Demonstrationen erfolgreicher darin waren, die öffentliche Meinung nach links zu schieben, als gewalttätige. Wenn sie die kommende Präsidentschaftswahl gewinnen wollen, müssen sich die Demokraten einer sehr unangenehmen Tatsache stellen, meint Shor in einem epischen, aber sehr lesenswerten (wenn man sich für Wahlkampftaktiken interessiert) Interview. Die weiße Arbeiterklasse ist in ihrer Mehrheit wirtschaftlich links, aber gesellschaftlich rechts. Aber auch in der schwarzen Arbeiterklasse gibt Strömungen hin zu den Republikanern. "Bildung korrelliert in hohem Maße mit der Offenheit für neue Erfahrungen", sagt Shor. "Als die europäischen Staaten das schulpflichtige Alter von 16 auf 18 Jahre anhoben, hatte die erste Generation von Schülern, die länger in der Schule blieb, wesentlich liberalere Ansichten zur Einwanderung als ihre unmittelbaren Vorgänger. Und dann sind Menschen mit College-Abschluss auch eher bereit, fremdes Essen zu probieren oder ins Ausland zu reisen. Es scheint also wirklich so zu sein, dass Bildung die Menschen offener für neue Erfahrungen macht. Politisch manifestiert sich dies bei der Einwanderung. Und das ist in Stein gemeißelt. Man kann sich die Meinungsumfragen aus den 1940er Jahren anschauen, ob Amerika jüdische Flüchtlinge aufnehmen sollte: Menschen mit College-Ausbildung waren dafür, Menschen ohne College-Ausbildung dagegen. Es ist länderübergreifend so: Südafrikaner aus der Arbeiterklasse sind gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Simbabwe, während die Südafrikaner mit College-Abschluss die Aufnahme befürworten."
Der Statistiker David Shor, der in Obamas Wahlkampfteam für Nathan Silver arbeitete, wurde über Nacht berühmt, als ihn sein Arbeitgeber Civis Analytics kürzlich wegen eines Tweets entließ, in dem Shor auf eine Studie aufmerksam machte, wonach 1968 gewaltlose Demonstrationen erfolgreicher darin waren, die öffentliche Meinung nach links zu schieben, als gewalttätige. Wenn sie die kommende Präsidentschaftswahl gewinnen wollen, müssen sich die Demokraten einer sehr unangenehmen Tatsache stellen, meint Shor in einem epischen, aber sehr lesenswerten (wenn man sich für Wahlkampftaktiken interessiert) Interview. Die weiße Arbeiterklasse ist in ihrer Mehrheit wirtschaftlich links, aber gesellschaftlich rechts. Aber auch in der schwarzen Arbeiterklasse gibt Strömungen hin zu den Republikanern. "Bildung korrelliert in hohem Maße mit der Offenheit für neue Erfahrungen", sagt Shor. "Als die europäischen Staaten das schulpflichtige Alter von 16 auf 18 Jahre anhoben, hatte die erste Generation von Schülern, die länger in der Schule blieb, wesentlich liberalere Ansichten zur Einwanderung als ihre unmittelbaren Vorgänger. Und dann sind Menschen mit College-Abschluss auch eher bereit, fremdes Essen zu probieren oder ins Ausland zu reisen. Es scheint also wirklich so zu sein, dass Bildung die Menschen offener für neue Erfahrungen macht. Politisch manifestiert sich dies bei der Einwanderung. Und das ist in Stein gemeißelt. Man kann sich die Meinungsumfragen aus den 1940er Jahren anschauen, ob Amerika jüdische Flüchtlinge aufnehmen sollte: Menschen mit College-Ausbildung waren dafür, Menschen ohne College-Ausbildung dagegen. Es ist länderübergreifend so: Südafrikaner aus der Arbeiterklasse sind gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Simbabwe, während die Südafrikaner mit College-Abschluss die Aufnahme befürworten."Elet es Irodalom (Ungarn), 28.08.2020
 Zum Nationalfeiertag am 20. August wurde anlässlich des hundertsten Jahrestages des Friedensvertrags von Trianon (bei dem Ungarn zwei Drittel seines Territoriums und ein Drittel seiner Bevölkerung verlor) in der Nähe des Parlaments ein neues Trianon-Denkmal errichtet, worauf alle Ortsnamen des historischen Ungarn eingraviert wurden. Das verwendete Ortsverzeichnis stammt aus dem Jahre 1913, als die zwanghafte Hungarisierung durch den damaligen Staat betrieben wurde. Viele der angegebenen Ortschaften waren und sind Siedlungen in denen nie Ungarn gelebt haben, wie Historiker kritisieren, schreibt Gábor Gyáni. "Bekanntlich wurde die Einheit des ungarischen Nationalstaates im Jahre 1867 auf das Prinzip 'es gibt nur eine politische Nation in dieser Heimat und die ist ungarisch' gegründet. Das Trianon-Denkmal erinnert somit nicht an den ungarischen Staat, sondern an die damalige Idee des historischen ungarischen Nationalstaates und damit ruft es die zwanghafte Hungarisierung in Erinnerung."
Zum Nationalfeiertag am 20. August wurde anlässlich des hundertsten Jahrestages des Friedensvertrags von Trianon (bei dem Ungarn zwei Drittel seines Territoriums und ein Drittel seiner Bevölkerung verlor) in der Nähe des Parlaments ein neues Trianon-Denkmal errichtet, worauf alle Ortsnamen des historischen Ungarn eingraviert wurden. Das verwendete Ortsverzeichnis stammt aus dem Jahre 1913, als die zwanghafte Hungarisierung durch den damaligen Staat betrieben wurde. Viele der angegebenen Ortschaften waren und sind Siedlungen in denen nie Ungarn gelebt haben, wie Historiker kritisieren, schreibt Gábor Gyáni. "Bekanntlich wurde die Einheit des ungarischen Nationalstaates im Jahre 1867 auf das Prinzip 'es gibt nur eine politische Nation in dieser Heimat und die ist ungarisch' gegründet. Das Trianon-Denkmal erinnert somit nicht an den ungarischen Staat, sondern an die damalige Idee des historischen ungarischen Nationalstaates und damit ruft es die zwanghafte Hungarisierung in Erinnerung."Forward (USA), 01.09.2020
 In Forward stellt Batya Ungar-Sargon eine Handvoll afroamerikanischer Intellektueller vor, die gegen den Rassenbegriff, wie er von Black Lives Matter und anderen Aktivisten benutzt wird, argumentieren. Dazu gehören John McWhorter, Professor für Linguistik an der Columbia University, der Autor und Journalist Thomas Chatterton Williams, Kmele Foster, Mitbegründer von Freethink und Mitstreiter im Podcast The Fifth Column, Chloe Valdary, Gründerin des Startups Theory of Enchantment, Glenn Loury, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Brown Universität, sowie Coleman Hughes, Mitarbeiter am Manhattan Institute und Redakteur beim City Journal. "Jeder trägt zu einer starken Gegenerzählung bei, und als Folge davon explodieren die Zahlen ihrer Twitter-Follower und Podcast-Downloads. Diese Intellektuellen, die die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, schwarz in Amerika zu sein (auch wenn sich nicht alle als 'schwarz' beschreiben) und die anti-woke sind, durchkreuzen die rassischen Linien der heutigen Debatte, sprechen für viele, die zu viel Angst haben, ihre Meinung zu äußern - und stellen sich in ihrem Namen dem Mob. 'Wenn ich gecancelt werde', sagte Williams kürzlich zu mir, 'werde ich von einem weißen Anti-Rassisten gecancelt. Das glaube ich wirklich.' Es wäre falsch, die Ähnlichkeiten zwischen diesen Denkern überzubewerten. Sie sind keineswegs eine kohärente Gruppe, und sie sind sich über viele, wenn nicht sogar die meisten Themen uneinig. Foster ist ein Anarcho-Libertär. Williams unterstützt linke Politik, und McWhorter bezeichnet sich als liberal. Valdary gründete ein Start-up-Unternehmen, das einen Lehrplan für Charakterbildung und spirituelle Lösungen zur Überwindung von Widrigkeiten anbietet (Offenlegung: Ich bin im Vorstand und sie ist eine Freundin). Loury ist eher konservativ, und Hughes ist vielleicht am bekanntesten dafür, dass er vor dem Kongress gegen Reparationen ausgesagt hat. Was sie zu einer im Entstehen begriffenen und zunehmend einflussreichen Intelligenz vereint, ist ihre Ablehnung des rassischen Essentialismus, den sie in diesem Moment als aufsteigend betrachten - die Idee, dass man der Rasse Vorrang vor allem anderen geben muss, um den Rassismus zu bekämpfen. 'Rassischer Essentialismus ist sehr reduktiv und eigentlich bedrückend', sagte Valdary zu mir. 'Ironischerweise reduziert er uns als Individuen auf unsere unveränderlichen Eigenschaften, was genau das ist, wogegen wir eigentlich kämpfen sollten.'"
In Forward stellt Batya Ungar-Sargon eine Handvoll afroamerikanischer Intellektueller vor, die gegen den Rassenbegriff, wie er von Black Lives Matter und anderen Aktivisten benutzt wird, argumentieren. Dazu gehören John McWhorter, Professor für Linguistik an der Columbia University, der Autor und Journalist Thomas Chatterton Williams, Kmele Foster, Mitbegründer von Freethink und Mitstreiter im Podcast The Fifth Column, Chloe Valdary, Gründerin des Startups Theory of Enchantment, Glenn Loury, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Brown Universität, sowie Coleman Hughes, Mitarbeiter am Manhattan Institute und Redakteur beim City Journal. "Jeder trägt zu einer starken Gegenerzählung bei, und als Folge davon explodieren die Zahlen ihrer Twitter-Follower und Podcast-Downloads. Diese Intellektuellen, die die Erfahrung gemacht haben, was es bedeutet, schwarz in Amerika zu sein (auch wenn sich nicht alle als 'schwarz' beschreiben) und die anti-woke sind, durchkreuzen die rassischen Linien der heutigen Debatte, sprechen für viele, die zu viel Angst haben, ihre Meinung zu äußern - und stellen sich in ihrem Namen dem Mob. 'Wenn ich gecancelt werde', sagte Williams kürzlich zu mir, 'werde ich von einem weißen Anti-Rassisten gecancelt. Das glaube ich wirklich.' Es wäre falsch, die Ähnlichkeiten zwischen diesen Denkern überzubewerten. Sie sind keineswegs eine kohärente Gruppe, und sie sind sich über viele, wenn nicht sogar die meisten Themen uneinig. Foster ist ein Anarcho-Libertär. Williams unterstützt linke Politik, und McWhorter bezeichnet sich als liberal. Valdary gründete ein Start-up-Unternehmen, das einen Lehrplan für Charakterbildung und spirituelle Lösungen zur Überwindung von Widrigkeiten anbietet (Offenlegung: Ich bin im Vorstand und sie ist eine Freundin). Loury ist eher konservativ, und Hughes ist vielleicht am bekanntesten dafür, dass er vor dem Kongress gegen Reparationen ausgesagt hat. Was sie zu einer im Entstehen begriffenen und zunehmend einflussreichen Intelligenz vereint, ist ihre Ablehnung des rassischen Essentialismus, den sie in diesem Moment als aufsteigend betrachten - die Idee, dass man der Rasse Vorrang vor allem anderen geben muss, um den Rassismus zu bekämpfen. 'Rassischer Essentialismus ist sehr reduktiv und eigentlich bedrückend', sagte Valdary zu mir. 'Ironischerweise reduziert er uns als Individuen auf unsere unveränderlichen Eigenschaften, was genau das ist, wogegen wir eigentlich kämpfen sollten.'"New Statesman (UK), 26.08.2020
 Sehr häufig war Libyen die Katzenpfote, die geopolitisch schlechtes Wetter ankündigte, erinnert der Historiker Christopher Clark und beobachtet mit mulmigem Gefühl, wie die Türkei und Ägypten, Frankreich, Russland und die Emirate im Bürgerkrieg mitmischen: "1911 griffen die Italiener, ermutigt von Briten und Franzosen, die drei osmanischen Provinzen an, die das heutige Libyen bilden, um sich eine Kolonie in Nordafrika zu sichern. Der italienisch-libysche Krieg, der heute selbst in Italien fast völlig vergessen ist, war der erste in der Weltgeschichte, in dem Luftangriffe geflogen wurden. Handgefertigte Bomben wurden von Doppeldeckern auf osmanische Truppen geworfen, sie verbreiteten Schrecken und Verwirrung. Ohne schlagkräftige Marine und vom britisch kontrollierten Ägypten am Truppentransport gehindert, konnten die Osmanen ihre Bodentruppen in dem Land weder versorgen noch verstärken. Der libysche Widerstand war jedoch unerwartet heftig. Die Italiener konnten nicht ins Hinterland vorrücken und sahen sich an der Küste eingeschlossen. Die Auswirkung dieses nicht provozierten Angriffs auf drei Provinzen des Osmanischen Reiches in Afrika waren gewaltig. Die italienische Jagd auf osmanische Seestreitkräfte führte zur wiederholten Schließung der türkischen Meerengen, wodurch die Passage russischer Getreide-Transporte blockiert und die russische Ökonomie ernsthaft geschädigt wurde. In der Folge brachen eine Reihe von Krisen in Südosteuropa aus, 1912 und 1913 gar zwei größere Kriege, und die Arrangements, die bis dahin die Balkankonflikte von einer Eskalation abhielten, wurden hinfällig. Kurz gesagt, der Krieg um Libyen erwies sich als Meilenstein auf dem Weg zu dem Konflikt, der 1914 ausbrach."
Sehr häufig war Libyen die Katzenpfote, die geopolitisch schlechtes Wetter ankündigte, erinnert der Historiker Christopher Clark und beobachtet mit mulmigem Gefühl, wie die Türkei und Ägypten, Frankreich, Russland und die Emirate im Bürgerkrieg mitmischen: "1911 griffen die Italiener, ermutigt von Briten und Franzosen, die drei osmanischen Provinzen an, die das heutige Libyen bilden, um sich eine Kolonie in Nordafrika zu sichern. Der italienisch-libysche Krieg, der heute selbst in Italien fast völlig vergessen ist, war der erste in der Weltgeschichte, in dem Luftangriffe geflogen wurden. Handgefertigte Bomben wurden von Doppeldeckern auf osmanische Truppen geworfen, sie verbreiteten Schrecken und Verwirrung. Ohne schlagkräftige Marine und vom britisch kontrollierten Ägypten am Truppentransport gehindert, konnten die Osmanen ihre Bodentruppen in dem Land weder versorgen noch verstärken. Der libysche Widerstand war jedoch unerwartet heftig. Die Italiener konnten nicht ins Hinterland vorrücken und sahen sich an der Küste eingeschlossen. Die Auswirkung dieses nicht provozierten Angriffs auf drei Provinzen des Osmanischen Reiches in Afrika waren gewaltig. Die italienische Jagd auf osmanische Seestreitkräfte führte zur wiederholten Schließung der türkischen Meerengen, wodurch die Passage russischer Getreide-Transporte blockiert und die russische Ökonomie ernsthaft geschädigt wurde. In der Folge brachen eine Reihe von Krisen in Südosteuropa aus, 1912 und 1913 gar zwei größere Kriege, und die Arrangements, die bis dahin die Balkankonflikte von einer Eskalation abhielten, wurden hinfällig. Kurz gesagt, der Krieg um Libyen erwies sich als Meilenstein auf dem Weg zu dem Konflikt, der 1914 ausbrach."Novinky.cz (Tschechien), 31.08.2020
London Review of Books (UK), 13.08.2020
 Adam Shatz empfiehlt dringend den kürzlich verstorbenen Albert Memmi zu lesen, der außerhalb Frankreichs wenig wahrgenommen wurde, dabei einer der bedeutendsten Autoren der Dekolonialisierung war. Er unterstützte Algerien und Tunesien im Kampf um die Unabhängigkeit, obwohl er wusste, das sie ihn - als Sohn tunesischer Juden - zur Emigration zwingen würde. Doch im Gegensatz zu Aimé Césaire oder Frantz Fanon konnte er nicht an die befreiende Kraft der Revolution glauben. Memmi hatte einen enormen Sinn für die Tragik, die dem antikolonialen Kampf innewohnte, meint Shatz: "Ihm war klar, dass es jenseits von Recht und Unrecht ausweglose historische Situationen gab. Gerade diese Ausweglosigkeit weigerten sich, wie er meinte, seine Genossen der tunesischen Linken - viele von ihnen Juden italienischer Herkunft und privilegierter als er selbst - anzuerkennen. 'Die Linke setzt darauf, dass sich die neuen Nationalismen weder in einen fremdenfeindlichen Chauvinismus noch in Faschismus oder in Rassismus verwandeln werden... Das ist eine gefährliche Wette. Denn der Abstand zwischen Nationalismus und Faschismus ist geringer als der zwischen Nationalismus und Revolution.' Memmi sah darin jedoch keinen Grund, seine Unterstützung für die Befreiung der nordafrikanischen Muslime von französischer Herrschaft zurückzuziehen. Es sei unfair, von Menschen, die als Nicht-Europäer und Nicht-Christen abgelehnt wurden, zu verlangen, dass sie Nicht-Muslime und Nicht-Afrikaner in ihre Arme schließen.' Aber man dürfe sich keine Illusionen über den Preis eines solchen Engagements machen: Wir müssen den Nordafrikanern helfen, ihre Freiheit zu gewinnen, selbst wenn diese Freiheit uns nicht zugute kommen wird, uns sogar verwundbar macht. Historische Verantwortung und Interessen fallen nicht immer in eins. Alles andere wäre infantil.' Memmi, der sich im Umfeld der Kommunistischen Partei bewegte, aber selbst kein Kommunist war, erkannte das Paradox des Marxismus für linke arabische Juden: Während der proletarische Internationalismus sie den muslimischen Massen näher brachte, verstärkte er zugleich, als eine säkulare westliche Ideologie, ihre Europäisierung und damit ihre kulturelle Entfremdung."
Adam Shatz empfiehlt dringend den kürzlich verstorbenen Albert Memmi zu lesen, der außerhalb Frankreichs wenig wahrgenommen wurde, dabei einer der bedeutendsten Autoren der Dekolonialisierung war. Er unterstützte Algerien und Tunesien im Kampf um die Unabhängigkeit, obwohl er wusste, das sie ihn - als Sohn tunesischer Juden - zur Emigration zwingen würde. Doch im Gegensatz zu Aimé Césaire oder Frantz Fanon konnte er nicht an die befreiende Kraft der Revolution glauben. Memmi hatte einen enormen Sinn für die Tragik, die dem antikolonialen Kampf innewohnte, meint Shatz: "Ihm war klar, dass es jenseits von Recht und Unrecht ausweglose historische Situationen gab. Gerade diese Ausweglosigkeit weigerten sich, wie er meinte, seine Genossen der tunesischen Linken - viele von ihnen Juden italienischer Herkunft und privilegierter als er selbst - anzuerkennen. 'Die Linke setzt darauf, dass sich die neuen Nationalismen weder in einen fremdenfeindlichen Chauvinismus noch in Faschismus oder in Rassismus verwandeln werden... Das ist eine gefährliche Wette. Denn der Abstand zwischen Nationalismus und Faschismus ist geringer als der zwischen Nationalismus und Revolution.' Memmi sah darin jedoch keinen Grund, seine Unterstützung für die Befreiung der nordafrikanischen Muslime von französischer Herrschaft zurückzuziehen. Es sei unfair, von Menschen, die als Nicht-Europäer und Nicht-Christen abgelehnt wurden, zu verlangen, dass sie Nicht-Muslime und Nicht-Afrikaner in ihre Arme schließen.' Aber man dürfe sich keine Illusionen über den Preis eines solchen Engagements machen: Wir müssen den Nordafrikanern helfen, ihre Freiheit zu gewinnen, selbst wenn diese Freiheit uns nicht zugute kommen wird, uns sogar verwundbar macht. Historische Verantwortung und Interessen fallen nicht immer in eins. Alles andere wäre infantil.' Memmi, der sich im Umfeld der Kommunistischen Partei bewegte, aber selbst kein Kommunist war, erkannte das Paradox des Marxismus für linke arabische Juden: Während der proletarische Internationalismus sie den muslimischen Massen näher brachte, verstärkte er zugleich, als eine säkulare westliche Ideologie, ihre Europäisierung und damit ihre kulturelle Entfremdung."La regle du jeu (Frankreich), 25.08.2020
 Bernard-Henri Lévy hat in Vilnius die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja getroffen, die sagt, sie hätte aus Liebe zu ihrem Mann agiert, der eigentlich für die Präsidentschaftswahlen 2020 kandidieren wollte und von Alexander Lukaschenko in Isolationshaft gehalten wird. Auszug aus dem Gespräch:
Bernard-Henri Lévy hat in Vilnius die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja getroffen, die sagt, sie hätte aus Liebe zu ihrem Mann agiert, der eigentlich für die Präsidentschaftswahlen 2020 kandidieren wollte und von Alexander Lukaschenko in Isolationshaft gehalten wird. Auszug aus dem Gespräch: "- Hatten Sie keine Angst entführt und eingesperrt zu werden wie Ihr Mann?
- Doch. Die ganze Zeit. Ich bin jeden Morgen aufgestanden und jeden Abend zu Bett gegangen mit der Angst im Nacken.
- Und?
- Dann dachte ich an ihn. Meinen Mann. Er gab mir Mut und die Inspiration, die ich brauchte.
- Haben Sie mit ihm gesprochen, konnten Sie kommunizieren?
- Nein, er ist ja isoliert, in einer Zelle von sechs Quadratmetern, zu klein für den großen Kerl, der er ist. Aber wir müssen nicht sprechen, um verbunden zu sein.
- Und heute?
- Es bleibt so. Gestern hatte er Geburtstag. Seine Anhänger haben sich unter den Gittern seiner Zelle versammelt, damit er spürte, dass er nicht allein ist. Aber die Polizei hatte es vorausgesehen und ihn am Vortag in eine andere Zelle gebracht."
Intercept (USA), 30.08.2020
 Auf Amerika könnte eine neue Finanzkrise zukommen, ausgelöst von Privatkrediten, die im Zeichen der Coronakrise aufgenommen wurden und die von "Fintechs" zu teilweise exoribitanten Zinsen gewährt werden. Hintergrund sind einige Liberalisierungen im Finanzmarkt noch unter Obama und später unter Trump, die es diesen Online-Banken, die als schicke Apps daherkommen, erlauben, solche Zinsen zu fordern, obwohl sie eigentlich als Wucher gelten, schreibt Alyssa Katz. "Es geht darum, das Look and Feel so einfach zu machen wie alles andere in Ihrem Leben", zitiert Katz einen Experten und konstatiert: "In ihrer Suche nach neuen Schuldnern gehen Fintechs über die Grenzen dessen hinaus, was die Konsumenten überhaupt bezahlen können. Die Parallelen zur Subprime-Kreditkrise von 2008 sind zu offensichtlich, als dass man sie ignorieren könnte, sagt Diane Standaert vom Hope Policy Institute und Vizepräsidentin des Center for Responsible Lending: 'Es ist, als würden wir Geschichte wiederholen.'"
Auf Amerika könnte eine neue Finanzkrise zukommen, ausgelöst von Privatkrediten, die im Zeichen der Coronakrise aufgenommen wurden und die von "Fintechs" zu teilweise exoribitanten Zinsen gewährt werden. Hintergrund sind einige Liberalisierungen im Finanzmarkt noch unter Obama und später unter Trump, die es diesen Online-Banken, die als schicke Apps daherkommen, erlauben, solche Zinsen zu fordern, obwohl sie eigentlich als Wucher gelten, schreibt Alyssa Katz. "Es geht darum, das Look and Feel so einfach zu machen wie alles andere in Ihrem Leben", zitiert Katz einen Experten und konstatiert: "In ihrer Suche nach neuen Schuldnern gehen Fintechs über die Grenzen dessen hinaus, was die Konsumenten überhaupt bezahlen können. Die Parallelen zur Subprime-Kreditkrise von 2008 sind zu offensichtlich, als dass man sie ignorieren könnte, sagt Diane Standaert vom Hope Policy Institute und Vizepräsidentin des Center for Responsible Lending: 'Es ist, als würden wir Geschichte wiederholen.'"168 ora (Ungarn), 27.08.2020
 Im Interview mit Zsuzsanna Sándor spricht der Schriftsteller István Kerékgyártó unter anderem über die Verengung des kulturellen Raumes im gegenwärtigen Ungarn. "Sie ist auch spürbar durch die extrem rechte Verschiebung der Macht und die zunehmende gesellschaftliche Angst. Solche Angst gab es in den Achtzigern nicht mehr. Aber es ist sowieso schwierig, die zwei Äras miteinander zu vergleichen. Ich wurde 1953 geboren und - abgesehen von der Zeit nach 1956, als ich ein Kind war - spürte ich stets, dass ich zunehmend freier wurde. Der politische Druck nahm ab und immer mehr schwappte aus der kulturpolitischen Kategorie des Verbotenen in das Geduldete. In den letzten zehn Jahren jedoch ist der öffentliche Raum wesentlich geschrumpft und die Zentralisierung nahm zu. (...) Über mich wird nur noch in der abnehmenden Oppositionspresse berichtet. Darüber hinaus ist es so, als würde ich nicht existieren."
Im Interview mit Zsuzsanna Sándor spricht der Schriftsteller István Kerékgyártó unter anderem über die Verengung des kulturellen Raumes im gegenwärtigen Ungarn. "Sie ist auch spürbar durch die extrem rechte Verschiebung der Macht und die zunehmende gesellschaftliche Angst. Solche Angst gab es in den Achtzigern nicht mehr. Aber es ist sowieso schwierig, die zwei Äras miteinander zu vergleichen. Ich wurde 1953 geboren und - abgesehen von der Zeit nach 1956, als ich ein Kind war - spürte ich stets, dass ich zunehmend freier wurde. Der politische Druck nahm ab und immer mehr schwappte aus der kulturpolitischen Kategorie des Verbotenen in das Geduldete. In den letzten zehn Jahren jedoch ist der öffentliche Raum wesentlich geschrumpft und die Zentralisierung nahm zu. (...) Über mich wird nur noch in der abnehmenden Oppositionspresse berichtet. Darüber hinaus ist es so, als würde ich nicht existieren."VAN (Deutschland), 25.08.2020
 Sehr bewegend ist der Bericht des Dirigenten Vitali Alekseenok, der die Wahlen in Belarus und die sich daran entflammende, immer energischer und selbstbewusster auftretende Protestbewegung aus nächster Nähe - vom Wahlabend über die flächendeckende Netzblockade bis zum Protest auf den Straßen - miterlebt hat. Vor allem auch die Künstler stellten sich auf die Hinterbeine, etwa im Projekt "'Symphonie der Solidarität', eine Collage von musikalischen Klängen, die von Dutzenden unterschiedlichster Musiker:innen aufgenommen wurden, zusammen mit den Originalklängen der Autos, der Polizei und der Zivilbevölkerung während der Proteste. ... In der ganzen Zeit der Proteste haben Belarussen kein einziges Schaufenster zerstört, keine Gewalt initiiert. Menschen bringen für ihre Mitstreiter Wasser und Essen, warten bei Rot an der Ampel, skandieren 'Aufräumen!', wenn sie einen Versammlungsort verlassen. Noch nie habe ich das belarussische Volk als eine Gruppe so intelligenter, höflicher und hilfsbereiter Menschen erlebt. Selbst wenn der Wendepunkt noch nicht in den nächsten Tagen kommt, wird es nicht mehr lange dauern. Jeden Tag begegnen wir der menschlichen Würde, welche ich so intensiv noch nie erfahren habe. Jetzt brauchen wir eine Regierung, die unserer würdig ist."
Sehr bewegend ist der Bericht des Dirigenten Vitali Alekseenok, der die Wahlen in Belarus und die sich daran entflammende, immer energischer und selbstbewusster auftretende Protestbewegung aus nächster Nähe - vom Wahlabend über die flächendeckende Netzblockade bis zum Protest auf den Straßen - miterlebt hat. Vor allem auch die Künstler stellten sich auf die Hinterbeine, etwa im Projekt "'Symphonie der Solidarität', eine Collage von musikalischen Klängen, die von Dutzenden unterschiedlichster Musiker:innen aufgenommen wurden, zusammen mit den Originalklängen der Autos, der Polizei und der Zivilbevölkerung während der Proteste. ... In der ganzen Zeit der Proteste haben Belarussen kein einziges Schaufenster zerstört, keine Gewalt initiiert. Menschen bringen für ihre Mitstreiter Wasser und Essen, warten bei Rot an der Ampel, skandieren 'Aufräumen!', wenn sie einen Versammlungsort verlassen. Noch nie habe ich das belarussische Volk als eine Gruppe so intelligenter, höflicher und hilfsbereiter Menschen erlebt. Selbst wenn der Wendepunkt noch nicht in den nächsten Tagen kommt, wird es nicht mehr lange dauern. Jeden Tag begegnen wir der menschlichen Würde, welche ich so intensiv noch nie erfahren habe. Jetzt brauchen wir eine Regierung, die unserer würdig ist."Kathrin Bellmann hat für ihre Doktorarbeit erforscht, was vom Probespiel zu halten ist, mit dem sich Orchester ihren Nachwuchs rekrutieren. Nicht so wahnsinnig viel, erklärt sie im Gespräch: Die Reliabilität fehle, "also die Zuverlässigkeit in der individuellen Bewertung, das heißt: Jemand bewertet ein und dieselbe Performance beim ersten Mal hören anders als beim zweiten Mal. ... Ein ganz bekannter Messfehler ist der Halo-Effekt: Mangels Bewertungskriterien hänge ich mich an einem Detail auf. Im Falle des Probespiels sagt dann die eine: 'Dieser Triller, der war brillant, wir müssen den haben in unserem Orchester.' Und ein anderer meint: 'Der hat das c viel zu tief gespielt, den können wir auf keinen Fall nehmen.' Man muss sich eben der Tatsache stellen, dass die menschliche Bewertung sehr fehleranfällig ist, und einen möglichst guten Weg finden, damit umzugehen. Das kann funktionieren, wenn man im Vorfeld Bewertungskriterien wie Intonation, Artikulation, Rhythmus, Phrasierung, … festlegt und diese beim Bewerten auch nutzt, beispielsweise in Form einer Ratingskala."
Mitunter ins unfreiwillig Komische driftet ein Gespräch mit Timothy Morton ab, der als "Star der neuen Philosoph:innen" vorgestellt wird und seine Ideen in enger Wechselwirkung mit Musik entwickelt. Zumindest im Interview beschleicht einen allerdings der Eindruck, man könne hier den Niedergang der Dekonstruktion zur Esoterik beobachten: Die Art, wie Zeit gemessen wird, sei eine "koloniale Ideologie" zum Zwecke der Unterwerfung, lesen wir. Fakten helfen nicht weiter bei der Gestaltung der Zukunft, Gefühle hingegen schon, denn die seien selbst "aus der Zukunft", auch habe alles Lebendige "eine spezifische Schwingung", entsprechend sei "Quantentheorie freundlich, sie verbindet uns mit allem Lebendigen, sie ist also eigentlich politisch sehr fortschrittlich." Und überhaupt "kann uns Kunst als Erfahrung dabei helfen, unsere Beziehung zum Nichtmenschlichen zu verstehen. Wenn ich heute Musik höre, die mich im Innersten bewegt, dann habe ich morgen vielleicht Mitgefühl mit einem Seevogel oder einem Igel im Garten."
Kommentieren