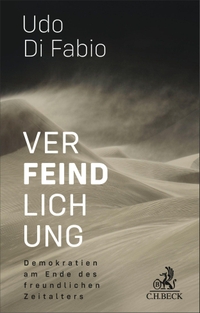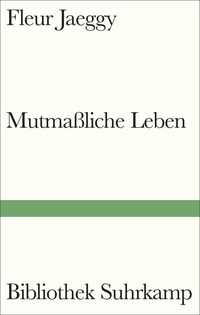Magazinrundschau
Verklemmt, aber glücklich
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
02.09.2008. Die New York Review of Books erzählt, wie Putin den Ukrainern und Balten eine Botschaft zukommen ließ. In Le Point verleiht Bernard-Henri Levy Putin dafür eine Goldmedaille. Prospect lernt die beste und gerechteste Gesellschaft der Welt kennen. Rue89 fragt, ob Frankreich in Ruanda einen revolutionären Krieg geführt hat. Elet es Irodalom fordert eine Operation Paprika für Ungarns Theater. Die Gazeta Wyborcza erinnert an die polnischen Danziger. Folio geht auf Traumreisen. The Nation schildert, wie New Orleans beinahe wieder die Segregation eingeführt hätte.
New York Review of Books (USA), 25.09.2008
 Putins Georgien-Feldzug hat die Kräfteverhältnisse im Kaukasus nicht verändert, meint George Friedman, dies sei schon lange vorher geschehen. "Aber noch wichtiger ist, dass Putins Invasion ein offenes Geheimnis enthüllt. Solange die USA im Mittleren Osten gebunden sind, haben ihre Garantien keinen Wert. Diese Lektion ist nicht für die Amerikaner bestimmt. Sie soll, vom russischen Standpunkt aus betrachtet, von den Ukrainern, den Balten und den Tschechen verdaut werden. Im Juli unterzeichnete die tschechische Regierung ein Abkommen mit den USA über die Installierung einer ballistischen Raketenabwehr, im August, nur Tage nach Beginn des Konflikts in Georgien kündigte die polnische Regierung an, dass sie den Amerikanern erlauben wird, Anti-Raketen-Basen in Polen zu bauen... Die Russen wussten, dass die USA den Angriff verurteilen würden. Das spielt ihnen nur in die Hände. Je lautstärker amerikanische Politiker auftreten, umso größer der Kontrast zu ihrer Untätigkeit. Und die Russen wollten klar machen, dass amerikanische Versprechen leeres Gerede sind."
Putins Georgien-Feldzug hat die Kräfteverhältnisse im Kaukasus nicht verändert, meint George Friedman, dies sei schon lange vorher geschehen. "Aber noch wichtiger ist, dass Putins Invasion ein offenes Geheimnis enthüllt. Solange die USA im Mittleren Osten gebunden sind, haben ihre Garantien keinen Wert. Diese Lektion ist nicht für die Amerikaner bestimmt. Sie soll, vom russischen Standpunkt aus betrachtet, von den Ukrainern, den Balten und den Tschechen verdaut werden. Im Juli unterzeichnete die tschechische Regierung ein Abkommen mit den USA über die Installierung einer ballistischen Raketenabwehr, im August, nur Tage nach Beginn des Konflikts in Georgien kündigte die polnische Regierung an, dass sie den Amerikanern erlauben wird, Anti-Raketen-Basen in Polen zu bauen... Die Russen wussten, dass die USA den Angriff verurteilen würden. Das spielt ihnen nur in die Hände. Je lautstärker amerikanische Politiker auftreten, umso größer der Kontrast zu ihrer Untätigkeit. Und die Russen wollten klar machen, dass amerikanische Versprechen leeres Gerede sind."Prospect (UK), 01.09.2008
 Wie sehr Russland sich um jeden Preis als Großmacht fühlen will, das lässt sich vor allem an der Erinnerungspolitik ablesen. Und über die kann man viel in dem von Wladimir Putin angestoßenen, abgesegneten und propagierten neuen Geschichtsbuch für russische Schüler lernen, wie Arkady Ostrovsky in der Titelgeschichte erläutert: "'Die Sowjetunion', erklärt das neue Lehrbuch, 'war keine Demokratie, aber sie war für Millionen Menschen auf der Welt das Beispiel für die beste und gerechteste Gesellschaft.' Darüber hinaus vermochte es die UdSSR, 'eine gigantische Supermacht, der eine gesellschaftliche Revolution gelang und die den brutalsten aller Kriege gewann', westliche Länder so unter Druck zu setzen, dass auch in ihnen die Menschenrechte beachtet wurden. Im frühen 21. Jahrundert freilich, fährt das Lehrbuch fort, war der Westen Russland gegenüber feindselig und selbstgerecht." All das ist kein Zufall, setzt Ostrovsky hinzu: Von einer liberalen Gesellschaft ist im gegenwärtigen Russland kaum eine Spur, dafür wird Stalin allerorten verteidigt, wenn nicht gefeiert.
Wie sehr Russland sich um jeden Preis als Großmacht fühlen will, das lässt sich vor allem an der Erinnerungspolitik ablesen. Und über die kann man viel in dem von Wladimir Putin angestoßenen, abgesegneten und propagierten neuen Geschichtsbuch für russische Schüler lernen, wie Arkady Ostrovsky in der Titelgeschichte erläutert: "'Die Sowjetunion', erklärt das neue Lehrbuch, 'war keine Demokratie, aber sie war für Millionen Menschen auf der Welt das Beispiel für die beste und gerechteste Gesellschaft.' Darüber hinaus vermochte es die UdSSR, 'eine gigantische Supermacht, der eine gesellschaftliche Revolution gelang und die den brutalsten aller Kriege gewann', westliche Länder so unter Druck zu setzen, dass auch in ihnen die Menschenrechte beachtet wurden. Im frühen 21. Jahrundert freilich, fährt das Lehrbuch fort, war der Westen Russland gegenüber feindselig und selbstgerecht." All das ist kein Zufall, setzt Ostrovsky hinzu: Von einer liberalen Gesellschaft ist im gegenwärtigen Russland kaum eine Spur, dafür wird Stalin allerorten verteidigt, wenn nicht gefeiert.Weitere Artikel: Richard Dowden erklärt, warum westliche Demokratiemodelle sich in Afrika als problematisch erweisen, und schlägt vor, dass auch bei Wahlen Unterlegene, statt reine Opposition zu sein, in die Regierung eingebunden werden sollten. Alexander Fiske-Harrison glaubt unter der Überschrift "Ein edler Tod", gute Argumente für seine Liebe zum Stierkampf auf seiner Seite zu haben. Über Sinn und Unsinn der in Mode gekommenen Verhaltensökonomik streiten Pete Lunn und Tim Harford. Sally Laird weiß, warum die glücklichen Dänen von heute mit den aus "Hamlet" bekannten rein gar nichts zu tun haben.
Point (Frankreich), 28.08.2008
Nachdem er unlängst für seinen Bericht aus dem Kriegsgebiet in Georgien und seinen Beitrag mit Andre Glucksmann in Liberation scharf kritisiert worden war (mehr hier), listet Bernard-Henri Levy in seinen Bloc-Notes die notwendigen Schlüsse auf, die aus den "Aggressionen dieses Sommers" zu ziehen seien und stellt sich noch einmal entschieden auf die Seite der Georgier. An der russischen Regierung empört ihn am meisten "diese unvorstellbare Dreistigkeit dieser Leute. Zum Beispiel ihre Art, wie sie 'den Kosovo' als Präzedenzfall anführen: Als ließen sich der Fall einer von einer grauenvollen ethnischen Säuberung bedrängten, gemarterten und zerstörten serbischen Provinz und die Situation eines Ossetien als Opfer eines 'Genozids? über einen Kamm scheren, der nach jüngsten Meldungen (laut Human Rights Watch) 47 Tote gefordert haben soll... Die Goldmedaille für Monsieur Putin bei den Olympischen Spielen der Sinnverzerrung und des Zynismus."
Rue89 (Frankreich), 27.08.2008
In Rue89 ist ein kleines Dossier zu dem Anfang August veröffentlichten Abschlussbericht der Mucyo Commission zu lesen (hier als pdf), welche die französische Rolle beim Völkermord 1994 in Ruanda untersuchen sollte. In einem Beitrag stellen Gabriel Peries und David Servenay diesen Bericht in Auszügen vor, zu dem Frankreich bisher offiziell nicht Stellung nahm. Beim Außenministerium war nur von "unannehmbaren Anschuldigungen" die Rede.
In einem Folgebeitrag untersuchen die Autoren, inwiefern Frankreich zwischen 1990 und 1994 in Form einer indirekten Strategie tatsächlich einen heimlichen Krieg geführt habe, der sich an eine in der Militärführung wohlbekannte Doktrin des revolutionären Krieges anlehnt, die auf einen französischen Offizier im Indochinakrieg 1953 zurückgeht. "Was das alles mit Ruanda zu tun hat, fragen Sie? Die Parallelen sind so zahlreich, dass sie über den Status harmloser Zufälle hinausgehen... Die französischen Soldaten haben ihr Wissen nie verloren. Trotz eines Verbots, diese Doktrin im französischen Mutterland zu lehren, was De Gaulle nach dem putsch des generaux (1961 in Algerien) verfügt hatte, trotz politischer Alternativen hielten die Elitekorps (Truppen der Marine, der Legion und der Polizei) an dieser Errungenschaft fest, vor allem in Afrika." In einem dritten Artikel schließlich untersuchen sie die "intellektuelle Matrix" dieser Kriegsdoktrin und werden dabei unter anderem bei dem Buch "Der totale Krieg" des deutschen Militärs, Putschisten und NS-Reichstagsabgeordneten Erich Ludendorff von 1934 fündig.
Ein weiterer Beitrag geht der Frage nach, ob nach dem Vorpreschen Silvio Berlusconis, der Gaddafi fünf Milliarden Dollar zur Begleichung einer italienischen "Kolonialschuld" zusagte, nun auch auf Frankreich und andere Länder mögliche Entschädigungszahlungen zukommen. Vorläufiges Fazit: "Eine Büchse der Pandora"
In einem Folgebeitrag untersuchen die Autoren, inwiefern Frankreich zwischen 1990 und 1994 in Form einer indirekten Strategie tatsächlich einen heimlichen Krieg geführt habe, der sich an eine in der Militärführung wohlbekannte Doktrin des revolutionären Krieges anlehnt, die auf einen französischen Offizier im Indochinakrieg 1953 zurückgeht. "Was das alles mit Ruanda zu tun hat, fragen Sie? Die Parallelen sind so zahlreich, dass sie über den Status harmloser Zufälle hinausgehen... Die französischen Soldaten haben ihr Wissen nie verloren. Trotz eines Verbots, diese Doktrin im französischen Mutterland zu lehren, was De Gaulle nach dem putsch des generaux (1961 in Algerien) verfügt hatte, trotz politischer Alternativen hielten die Elitekorps (Truppen der Marine, der Legion und der Polizei) an dieser Errungenschaft fest, vor allem in Afrika." In einem dritten Artikel schließlich untersuchen sie die "intellektuelle Matrix" dieser Kriegsdoktrin und werden dabei unter anderem bei dem Buch "Der totale Krieg" des deutschen Militärs, Putschisten und NS-Reichstagsabgeordneten Erich Ludendorff von 1934 fündig.
Ein weiterer Beitrag geht der Frage nach, ob nach dem Vorpreschen Silvio Berlusconis, der Gaddafi fünf Milliarden Dollar zur Begleichung einer italienischen "Kolonialschuld" zusagte, nun auch auf Frankreich und andere Länder mögliche Entschädigungszahlungen zukommen. Vorläufiges Fazit: "Eine Büchse der Pandora"
Elet es Irodalom (Ungarn), 29.08.2008
 Der niederländische Kulturattache und Organisator des holländischen LOW-Kulturfestivals in Ungarn, Jan Kennis, stellt fest, dass die ungarische Kulturszene im Vergleich mit der niederländischen kaum vom Fleck kommt. Dies liege vor allem daran, dass die Kultur in Ungarn zu sehr im eigenen Saft schmore und die innovativen Initiativen nicht den Weg zueinander fänden. Was Ungarn fehle, sei eine "Operation Paprika", ähnlich der "Aktion Tomate", mit der Studenten 1969 in Amsterdam eine Neuaufstellung des Theaters verlangt hätten: "Verglichen mit jener stickigen Atmosphäre, in der sich die Niederlande gegen Ende der 60er Jahre befand, ist Budapest viel besser gestellt. Der internationalen kulturellen Elite müsste aber die Stadt ihre Tore öffnen. Für die ungarischen Institutionen müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, mit ähnlich gearteten ausländischen Institutionen zu kooperieren... Mich als Außenstehenden würde interessieren, wie diese Situation entstanden ist. Ist sie ein Ergebnis bewusst gewählter Politik? Oder des schlichten Desinteresses?"
Der niederländische Kulturattache und Organisator des holländischen LOW-Kulturfestivals in Ungarn, Jan Kennis, stellt fest, dass die ungarische Kulturszene im Vergleich mit der niederländischen kaum vom Fleck kommt. Dies liege vor allem daran, dass die Kultur in Ungarn zu sehr im eigenen Saft schmore und die innovativen Initiativen nicht den Weg zueinander fänden. Was Ungarn fehle, sei eine "Operation Paprika", ähnlich der "Aktion Tomate", mit der Studenten 1969 in Amsterdam eine Neuaufstellung des Theaters verlangt hätten: "Verglichen mit jener stickigen Atmosphäre, in der sich die Niederlande gegen Ende der 60er Jahre befand, ist Budapest viel besser gestellt. Der internationalen kulturellen Elite müsste aber die Stadt ihre Tore öffnen. Für die ungarischen Institutionen müsste es eine Selbstverständlichkeit sein, mit ähnlich gearteten ausländischen Institutionen zu kooperieren... Mich als Außenstehenden würde interessieren, wie diese Situation entstanden ist. Ist sie ein Ergebnis bewusst gewählter Politik? Oder des schlichten Desinteresses?"Folio (Schweiz), 01.09.2008
 Zur Nachbereitung der Urlaubssaison widmet die Redaktion diese Ausgabe der Traumreise. Peter Haffner porträtiert den New Yorker Explorers Club, dessen weltweit 3000 Mitglieder etwas mehr vorweisen müssen als ein Abo beim Club Med. "Eine Vitrine, dem jüngst verstorbenen Himalaya-Bezwinger und Ehrenpräsidenten Edmund Hillary gewidmet, informiert darüber, dass jede britische Expedition seit 1933 mit Ovomaltine ausgerüstet war, während eine nächste eine Ansammlung von Schädeln und Büchern zur Schau stellt mit Titeln wie 'Six Came Back'. Über der Tür des Vortragssaals hängt der Schlitten der Nordpolexpedition von Matthew Henson und Robert Peary von 1909; Clubmitglieder auch sie aus einer Epoche, die der Epilog zum Zeitalter der Entdeckungen war. Noch gab es Orte, die nie ein menschlicher Fuß betreten hatte. Es waren Clubmitglieder, die das besorgten - Peary am Nordpol, Roald Amundsen am Südpol, Edmund Hillary auf dem Everest, Jacques Piccard und Don Walsh im Marianengraben, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins auf dem Mond."
Zur Nachbereitung der Urlaubssaison widmet die Redaktion diese Ausgabe der Traumreise. Peter Haffner porträtiert den New Yorker Explorers Club, dessen weltweit 3000 Mitglieder etwas mehr vorweisen müssen als ein Abo beim Club Med. "Eine Vitrine, dem jüngst verstorbenen Himalaya-Bezwinger und Ehrenpräsidenten Edmund Hillary gewidmet, informiert darüber, dass jede britische Expedition seit 1933 mit Ovomaltine ausgerüstet war, während eine nächste eine Ansammlung von Schädeln und Büchern zur Schau stellt mit Titeln wie 'Six Came Back'. Über der Tür des Vortragssaals hängt der Schlitten der Nordpolexpedition von Matthew Henson und Robert Peary von 1909; Clubmitglieder auch sie aus einer Epoche, die der Epilog zum Zeitalter der Entdeckungen war. Noch gab es Orte, die nie ein menschlicher Fuß betreten hatte. Es waren Clubmitglieder, die das besorgten - Peary am Nordpol, Roald Amundsen am Südpol, Edmund Hillary auf dem Everest, Jacques Piccard und Don Walsh im Marianengraben, Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins auf dem Mond."Der Kosmonaut Sergei Krikaljow beschreibt Ulrich Schmid, wie das All riecht: "Unvergleichlich. Nichts auf der Erde riecht so. Verstehen Sie mich richtig: Ich spreche nicht vom Geruch der Kapsel, nicht vom Raumanzug. Ich spreche vom All. Ich weiss, das ist eigentlich unmöglich. Man kann das Vakuum des Weltraums nicht riechen. Aber eigenartigerweise geht es allen Kosmonauten so. Wir sehnen uns nach diesem seltsamen, metallischen Geruch. Ich kann es nur schwer beschreiben. Vielleicht sind es bestimmte Gase, bestimmte Ionen, die im Vakuum ihre Struktur ändern. Es ist faszinierend.
Weiteres: Eric Weiner hat die zehn glücklichsten Länder der Welt bereist. Die Schweiz ist auch dabei, wie Lukas Egli und Mikael Krogerus im Interview erfahren. "Auf den ersten Blick seid ihr Schweizer verklemmt. Auf den zweiten Blick verklemmt, aber glücklich." Desweiteren sucht Arnon Grünberg sein Traumziel im Irak, und Rohland Schuknecht erzählt, wie es war, als DDR-Bürger nach der Wende nach Kenia zu fahren.
Luca Turin geht in seiner Duftnote diesmal nicht auf einen weiteren Wohlgeruch ein, sondern warnt vor toten Tintenfischen, wie er aus seiner Zeit als Hilfswissenschaftler im Aquarium von Neapel weiß, wo Tintenfische als Versuchstiere dienten. "Manchmal verstarb eines dieser armen Geschöpfe und rächte sich an uns (mir oblag auch die Reinigung der Becken) durch Absonderung des bestialischsten Geruchs der Welt, eines so atemberaubend ekligen Gestanks, dass wir minutenlang nach Luft schnappten."
Gazeta Wyborcza (Polen), 30.08.2008
 Alina Kilian erinnert an das Schicksal der polnischen Danziger, die auch auf Polnisch so heißen: Vor 1945 diskriminiert und von den Nazis offen verfolgt, wurden sie danach von vielen polnischen Neuankömmlingen als "Volksdeutsche" verachtet, und suchten nicht selten die Flucht - nach Deutschland: "Ihre gedruckten Erlebnisberichte wurden in Polen kaum wahrgenommen. Das heutige Wissen über Vorkriegsdanzig stammt zum größten Teil aus Günter Grass' Büchern. Dieser hat in seinen Danziger Werken nie sein kleinbürgerliches Milieu verlassen, und die polnischen Bewohner in keinem Interview erwähnt. Die 'Danziger' wurden aus der Erinnerung getilgt".
Alina Kilian erinnert an das Schicksal der polnischen Danziger, die auch auf Polnisch so heißen: Vor 1945 diskriminiert und von den Nazis offen verfolgt, wurden sie danach von vielen polnischen Neuankömmlingen als "Volksdeutsche" verachtet, und suchten nicht selten die Flucht - nach Deutschland: "Ihre gedruckten Erlebnisberichte wurden in Polen kaum wahrgenommen. Das heutige Wissen über Vorkriegsdanzig stammt zum größten Teil aus Günter Grass' Büchern. Dieser hat in seinen Danziger Werken nie sein kleinbürgerliches Milieu verlassen, und die polnischen Bewohner in keinem Interview erwähnt. Die 'Danziger' wurden aus der Erinnerung getilgt".Der Politologe Pawel Swieboda gewinnt dem herrischen Auftreten Russlands im Georgien-Konflikt auch etwas Positives ab: "Europa brauchte immer eine Krise, um über seinen Schatten zu springen. Jetzt kann es seine Mission und sein Selbstbewusstsein wiederfinden", schreibt der Autor im Hinblick auf den EU-Gipfel. "Jetzt hat die EU die Chance, geschlossen gegenüber Moskau aufzutreten, und sie - und nicht etwa die USA - kann auch Russland dabei helfen, von dem hohen Ross runterzukommen, auf das es sich begeben hat."
Espresso (Italien), 28.08.2008
 Das Feuer unter dem Schmelztiegel New York ist schon lange erloschen, meint der indische Autor Suketu Mehta. Die heutigen Einwanderer leben in Gemeinschaften, die sich selbst genügen und nur wenige Verbindungen zur Außenwelt haben. "Die Einwanderer sehen heute keine Notwendigkeit mehr, einen wie auch immer imaginären und idealisierten amerikanischen Way of Life anzunehmen, sie können in Amerika mehr oder weniger so leben wie vor ihrer Auswanderung. Geht man an einem kalten Januarmorgen über die Brücke von Manhattan, kann es einem passieren, dass man auf Hunderte junger Mexikaner trifft, die mit einem Bild von Jesus herumlaufen, auf den T-Shirts prangt der Heilige ihres Heimatortes Puebla. Dieser rituelle Umzug heißt Antocha und ist ursprünglich ein Pilgerzug von Mexiko-Stadt nach Puebla zu Ehren des Heiligen, nur dass diese jungen Menschen von Zentrum Manhattans zu einer Kirche in Brooklyn laufen, wo ein lebensechtes Abbild des verehrten Heiligen ihrer Heimat steht."
Das Feuer unter dem Schmelztiegel New York ist schon lange erloschen, meint der indische Autor Suketu Mehta. Die heutigen Einwanderer leben in Gemeinschaften, die sich selbst genügen und nur wenige Verbindungen zur Außenwelt haben. "Die Einwanderer sehen heute keine Notwendigkeit mehr, einen wie auch immer imaginären und idealisierten amerikanischen Way of Life anzunehmen, sie können in Amerika mehr oder weniger so leben wie vor ihrer Auswanderung. Geht man an einem kalten Januarmorgen über die Brücke von Manhattan, kann es einem passieren, dass man auf Hunderte junger Mexikaner trifft, die mit einem Bild von Jesus herumlaufen, auf den T-Shirts prangt der Heilige ihres Heimatortes Puebla. Dieser rituelle Umzug heißt Antocha und ist ursprünglich ein Pilgerzug von Mexiko-Stadt nach Puebla zu Ehren des Heiligen, nur dass diese jungen Menschen von Zentrum Manhattans zu einer Kirche in Brooklyn laufen, wo ein lebensechtes Abbild des verehrten Heiligen ihrer Heimat steht."Nouvel Observateur (Frankreich), 28.08.2008
Mit seinem Buch "La Revolution française n'est pas terminee" kratzt der Sozialist und ehemalige Europaabgeordnete Vincent Peillon an einem französischen Nationalheiligtum, dem Historiker und Spezialisten für das Thema Französische Revolution, Francois Furet. In einem Gespräch mit dessen Schüler Philippe Raynaud begründet und verteidigt er seine Thesen. "Unsere noch immer dominante historische Erzählung ist eine, die uns daran hindert, zu unserer Gegenwart zu gelangen. [Francois Furet] hat unsere nationale Erzählung entlang einer Reihe von Oppositionspaaren geschrieben: Freiheit/Gleichheit, Katholizismus/Protestantismus, Individuum/Staat, II. Republik/III. Republik, gute Revolution von 1789/schlechte Revolution von 1793, Liberalismus/Sozialismus. Ich widerspreche gleichermaßen seiner historischen Lektüre, den philosophischen Grundlagen, auf die sie sich stützt, und den politischen Schlussfolgerungen, die er daraus zieht. (...) Zu sagen, die Revolution sei beendet, hieße, dass es keine Umstürze, Gewaltakte, letztendlich keine Debatte mehr gäbe."
Al Ahram Weekly (Ägypten), 28.08.2008
 Ägypten versucht seit einiger Zeit, seine Bürger zum Lesen zu bringen. Ob mit Erfolg, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, berichtet Dina Ezzat. "Die Schätzungen zur Anzahl derer, die öffentliche Leseeinrichtungen besuchen, variieren stark. Einige Beamte geben an, dass jedes Jahr etwa 20 Millionen Menschen vom Netzwerk der öffentlichen Bibliotheken und der 'Reading for All'-Kampagne profitieren, während andere überzeugt sind, dass es nicht mehr als drei Millionen sind. Im staatlichen Fernsehen und Radio wird Lesen ausgiebig beworben. Suzanne Mubarak ruft etwa in Spots jedes einzelne Familienmitglied auf, der Initiative beizutreten. Filmgrößen und Sportstars werben ebenfalls. Nichtsdestotrotz sind die meisten öffentlichen Büchereien, insbesondere die Mubarak-Bibliotheken - bald werden es zwölf in ganz Ägypten sein - und die Kulturzentren nach wie vor für viele in erster Linie ein Ort, um Sprachen zu lernen und Sommerprogramme zu besuchen, als ernsthaft zu lesen."
Ägypten versucht seit einiger Zeit, seine Bürger zum Lesen zu bringen. Ob mit Erfolg, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, berichtet Dina Ezzat. "Die Schätzungen zur Anzahl derer, die öffentliche Leseeinrichtungen besuchen, variieren stark. Einige Beamte geben an, dass jedes Jahr etwa 20 Millionen Menschen vom Netzwerk der öffentlichen Bibliotheken und der 'Reading for All'-Kampagne profitieren, während andere überzeugt sind, dass es nicht mehr als drei Millionen sind. Im staatlichen Fernsehen und Radio wird Lesen ausgiebig beworben. Suzanne Mubarak ruft etwa in Spots jedes einzelne Familienmitglied auf, der Initiative beizutreten. Filmgrößen und Sportstars werben ebenfalls. Nichtsdestotrotz sind die meisten öffentlichen Büchereien, insbesondere die Mubarak-Bibliotheken - bald werden es zwölf in ganz Ägypten sein - und die Kulturzentren nach wie vor für viele in erster Linie ein Ort, um Sprachen zu lernen und Sommerprogramme zu besuchen, als ernsthaft zu lesen." Guardian (UK), 30.08.2008
 Der Autor und London-Experte Iain Sinclair erzählt die faszinierende, umwegreiche Geschichte eines vergessenen, ja verschwundenen Schriftstellers der fünfziger Jahre namens Roland Camberton. Genauer gesagt: Er berichtet, wie er durch obsessives Nachforschen und Glück herausfand, dass Camberton in Wahrheit Henry Cohen hieß, ein Jude aus dem East End war und alles wollte, nur nicht berühmt sein. Es tauchen William Somerset Maugham und William Burroughs in der Geschichte auf, besonders fasziniert ist Sinclair vom in Hackney angesiedelten zweiten (und letzten) Roman Cambertons: "Rain on the Pavements" von 1951. Das Credo der Hauptfigur - die einen Roman mit dem Titel "Scheitern" schreibt - könnte, so Sinclair, sein eigenes sein: "Man musste jeden Seitenweg kennen und jede Sackgasse, jeden Durchgang, jede Passage; jede Schule, jedes Krankenhaus, jede Kirche, jede Synagoge; jedes Polizeirevier, jede Post, jede Toilette; jeden seltsamen Ladennamen, jede Gang, jedes Versteck, jeden vor sich hin brabbelnden alten Mann."
Der Autor und London-Experte Iain Sinclair erzählt die faszinierende, umwegreiche Geschichte eines vergessenen, ja verschwundenen Schriftstellers der fünfziger Jahre namens Roland Camberton. Genauer gesagt: Er berichtet, wie er durch obsessives Nachforschen und Glück herausfand, dass Camberton in Wahrheit Henry Cohen hieß, ein Jude aus dem East End war und alles wollte, nur nicht berühmt sein. Es tauchen William Somerset Maugham und William Burroughs in der Geschichte auf, besonders fasziniert ist Sinclair vom in Hackney angesiedelten zweiten (und letzten) Roman Cambertons: "Rain on the Pavements" von 1951. Das Credo der Hauptfigur - die einen Roman mit dem Titel "Scheitern" schreibt - könnte, so Sinclair, sein eigenes sein: "Man musste jeden Seitenweg kennen und jede Sackgasse, jeden Durchgang, jede Passage; jede Schule, jedes Krankenhaus, jede Kirche, jede Synagoge; jedes Polizeirevier, jede Post, jede Toilette; jeden seltsamen Ladennamen, jede Gang, jedes Versteck, jeden vor sich hin brabbelnden alten Mann."Vor knapp zwei Jahren starb Alexander Litwinenko in einem Londoner Krankenhaus an einer Vergiftung durch das radioaktive Polonium. Wer es denn nun gewesen ist, kann auch Alan Cowell in seiner "forensischen" Untersuchung auf 448 Seiten nicht klären, bedauert David Hearst. Am Ende sind mehr Fragen offen als beantwortet. "Aber Cowell gelingen auch Enthüllungen. Er legt die Rolle eines Polizisten offen, der an Litwinenkos Bett stand; er beschreibt, wie ein Toxikologe realisierte, dass der Patient nicht die klassischen Symptome einer Thallium-Vergiftung zeigte und den Urinbeutel zu den Nuklearwaffenexperten nach Aldermaston schickte. Er beschreibt, wie das Attentat verpfuscht wurde und wie es zuvor schon mehrere Versuche gegeben hatte."
Außerdem: Der Linguist Peter K. Austin - Autor eines Buches mit dem Titel "1000 Languages" - stellt die zehn wichtigsten vom Aussterben bedrohten Sprachen vor. Besprechungen gibt es zu Mark Thompsons "meisterlicher" Geschichte der italienischen Front im Ersten Weltkrieg, Francis Becketts Porträt von Mick Costello, Englands bekanntester Kommunist, und Kenan Maliks "schicker" Polemik zur Rassenfrage.
Times Literary Supplement (UK), 29.08.2008
 "Stellen Sie sich vor, wie Balanchine ein paar Cheerleader beobachtet. Das ist dieses Buch in einem Satz", schreibt Clive James in seiner Besprechung von Joseph Horowitz' Untersuchung über den Aufprall europäischer Exilkünstler auf amerikanischen Kulturboden, "Artists in Exile". Schönberg, der Ping Pong mit seinem Nachbar Gershwin spielte, ist ein Paradebeispiel: "Er musste sich ziemlich anstrengen, um unpopulär zu bleiben. Er verfluchte sich jedesmal, wenn er vom Atonalen abkam und etwas schuf, was ein Laienpublikum hätte mögen können. Nicht einmal die harten Fälle konnten behaupten, dass sie in den USA unter die Philister geraten waren. Sie waren nur auf einem Markt gelandet, der größer und wettbewerbsorientierter war als jener, aus dem sie vertrieben worden waren. Und auch jene, die keinen Erfolg hatten, hätten ihn gerne gehabt. Korngolds Erfolg erschien vielleicht albern, und Weills trügerisch, aber die Möglichkeiten waren da: mehr Möglichkeiten, als die meisten vertrugen."
"Stellen Sie sich vor, wie Balanchine ein paar Cheerleader beobachtet. Das ist dieses Buch in einem Satz", schreibt Clive James in seiner Besprechung von Joseph Horowitz' Untersuchung über den Aufprall europäischer Exilkünstler auf amerikanischen Kulturboden, "Artists in Exile". Schönberg, der Ping Pong mit seinem Nachbar Gershwin spielte, ist ein Paradebeispiel: "Er musste sich ziemlich anstrengen, um unpopulär zu bleiben. Er verfluchte sich jedesmal, wenn er vom Atonalen abkam und etwas schuf, was ein Laienpublikum hätte mögen können. Nicht einmal die harten Fälle konnten behaupten, dass sie in den USA unter die Philister geraten waren. Sie waren nur auf einem Markt gelandet, der größer und wettbewerbsorientierter war als jener, aus dem sie vertrieben worden waren. Und auch jene, die keinen Erfolg hatten, hätten ihn gerne gehabt. Korngolds Erfolg erschien vielleicht albern, und Weills trügerisch, aber die Möglichkeiten waren da: mehr Möglichkeiten, als die meisten vertrugen."The Nation (USA), 15.09.2008
 Nichts ist in Ordnung in New Orleans - ganz unabhängig von "Gustav". Lizzy Ratner berichtet über die Versuche der Reichen und Weißen, vor allem der reichen Weißen, unter sich zu bleiben: "Kaum zwei Monate nach Beginn des Wiederaufbaus hat der Stadtteilrat von St. Bernard ein für ein Jahr gültiges Verbot für die 'Wiedererrichtung und Entwicklung' von Mehrfamilienhäusern erlassen - und so die Rekonstruktion erschwinglicher Häuser-Komplexe untersagt. Mit einem Gesetz, das, wie Kritiker meinen, legalisierter Segregation gefährlich nahe kam, übertraf sich der Rat 2006 noch einmal selbst... Der 'Blutverwandtschaftserlass' verbot Hausbesitzern die Vermietung ihres Wohneigentums an jeden, der nicht mit ihnen blutsverwandt ist; das wäre überall hoch problematisch, ist es aber ganz besonders in St. Bernard, wo 93 Prozent des Hausbesitzes vor Katrina in weißer Hand war." Ganz aktuell auf der Website übrigens ein Brief von Michael Moore an Gott, den aktuellen Hurrikan betreffend.
Nichts ist in Ordnung in New Orleans - ganz unabhängig von "Gustav". Lizzy Ratner berichtet über die Versuche der Reichen und Weißen, vor allem der reichen Weißen, unter sich zu bleiben: "Kaum zwei Monate nach Beginn des Wiederaufbaus hat der Stadtteilrat von St. Bernard ein für ein Jahr gültiges Verbot für die 'Wiedererrichtung und Entwicklung' von Mehrfamilienhäusern erlassen - und so die Rekonstruktion erschwinglicher Häuser-Komplexe untersagt. Mit einem Gesetz, das, wie Kritiker meinen, legalisierter Segregation gefährlich nahe kam, übertraf sich der Rat 2006 noch einmal selbst... Der 'Blutverwandtschaftserlass' verbot Hausbesitzern die Vermietung ihres Wohneigentums an jeden, der nicht mit ihnen blutsverwandt ist; das wäre überall hoch problematisch, ist es aber ganz besonders in St. Bernard, wo 93 Prozent des Hausbesitzes vor Katrina in weißer Hand war." Ganz aktuell auf der Website übrigens ein Brief von Michael Moore an Gott, den aktuellen Hurrikan betreffend.Weitere Artikel: William Deresiewicz bespricht Salman Rushdies neuesten Roman "The Enchantress of Florence", Alexander Provan hat das Buch des Statistikers John Zogby "The Way We'll Be" über den Wandel amerikanischer Werte gelesen.
Kommentieren