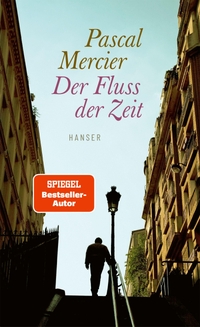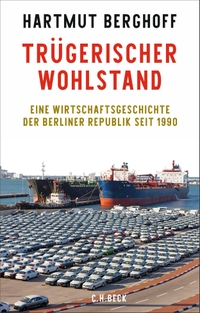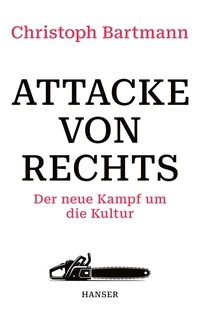Magazinrundschau
Unvergänglich attraktiv
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
26.11.2013. Prospect erzählt, wie das FBI undercover bei Jean-Paul Sartre und Albert Camus in die Schule ging. Im New Yorker beklagt der Großgalerist David Zwirner das Florieren seiner Branche. In The Nation befasst sich David Rieff mit Margarete von Trottas in den USA sehr heiß diskutierten Film über Hannah Arendt. Atlantic schickt uns als Spielfiguren in die neue Arbeitswelt. In den Blättern geißelt András Bruck die Diktatur der Unehrlichkeit in Ungarn. In Le Point verteidigt Bernhard-Henri Levy die Steuern gegen das gemeine bretonische Volk. Das TLS feiert die Furchtlosigkeit der italienischen Autorin Elena Ferrante. Aeon kämpft mit rosa Nashörnern gegen Halluzinationen.
Prospect (UK), 19.11.2013
 Andy Martin hat die freigegebenen FBI- und CIA-Akten über Jean-Paul Sartre und Albert Camus einem genauerem Blick unterzogen und dabei Bemerkenswertes festgestellt: Um sicherzugehen, dass es sich bei Existenzialismus und der Idee des Absurden nicht um codierte Umschriften kommunistischer Basistexte handelt, gerieten die Schnüffelbeamten im undercover besuchten Seminar selbst ins Philosophieren und wurden zu so etwas wie Neo-Existenzialisten: "Der Erzählkunst, der Philosophie und der Spionage ist ein gemeinsamer Ursprung eigen: Sie entstandenen aus einem Mangel an Informationen. Sartres Erwartung einer Welt der totalen Information hätte sie allesamt mit einem Schlag erledigt. An FBI, Schriftstellern oder französischen Philosophen bestünde kein Bedarf mehr. Existenzialismus und die Idee des Absurden bestehen auf einer Asymmetrie zwischen dem Sein und der Information. Agent James M. Underhill, der heldenhaft den sich entziehenden 'Albert Canus' verfolgte, brachte die Theorie mit einer klingenden Phrase auf den Punkt: 'Die Akte kommt zu keinem endgültigen Beschluss.'"
Andy Martin hat die freigegebenen FBI- und CIA-Akten über Jean-Paul Sartre und Albert Camus einem genauerem Blick unterzogen und dabei Bemerkenswertes festgestellt: Um sicherzugehen, dass es sich bei Existenzialismus und der Idee des Absurden nicht um codierte Umschriften kommunistischer Basistexte handelt, gerieten die Schnüffelbeamten im undercover besuchten Seminar selbst ins Philosophieren und wurden zu so etwas wie Neo-Existenzialisten: "Der Erzählkunst, der Philosophie und der Spionage ist ein gemeinsamer Ursprung eigen: Sie entstandenen aus einem Mangel an Informationen. Sartres Erwartung einer Welt der totalen Information hätte sie allesamt mit einem Schlag erledigt. An FBI, Schriftstellern oder französischen Philosophen bestünde kein Bedarf mehr. Existenzialismus und die Idee des Absurden bestehen auf einer Asymmetrie zwischen dem Sein und der Information. Agent James M. Underhill, der heldenhaft den sich entziehenden 'Albert Canus' verfolgte, brachte die Theorie mit einer klingenden Phrase auf den Punkt: 'Die Akte kommt zu keinem endgültigen Beschluss.'"Außerdem philosophiert AC Grayling über Dimensionen und Definitionen der Armut und Charlotte McCann steht für die Skater im Gewölbe unter der Londoner Southbank ein, die dort einer weiteren Erschließung des Gebiets weichen sollen. Hier eine Kampagnenseite auf Facebook und eine automatisierte Bildstrecke auf flickr.
New Yorker (USA), 02.12.2013
 Nick Paumgarten porträtiert den Galeristen David Zwirner, der zu den maßgeblichen und erfolgreichsten Kunsthändlern weltweit zählt und dessen New Yorker Galerie Kunststars wie Isa Genzken, Chris Ofili, Daniel Richter und Thomas Ruff vertrat und vertritt. Er bezeichnet den gegenwärtigen Kunstmarkt als "höchstflorierende Branche", keine andere verkaufe derzeit in dieser Frequenz so viel "teures Zeug". Warum Menschen so viel Geld für Kunst ausgeben? Zwirner, der das Verkaufsgeschäft auf den großen Kunstmessen "fast pervers" findet, meint: "'Es wird auch deshalb so viel über Geld geredet, weil das viel einfacher ist, als über Kunst zu sprechen'. Man begegnet in der Kunstwelt vielen, die diese Fixierung aufs Geld und seine Dominanz entsetzt und fertig macht. Es lenkt vom Werk ab, sagen sie. Es deformiert kuratorische Instinkte, kritische Beurteilungen und die Karrieren junger Künstler. Es schreckt Leute ab, sie beginnen, Kunst in einen Topf mit anderen Auswüchsen zu werfen und sie als ein weiteres protziges Spielzeug der Reichen abzutun. Natürlich machen sich viele von denen, die das beklagen - Händler, Künstler, Kuratoren -, zu Komplizen. Die Kulturindustrie, die ihnen auf die eine oder andere Weise Schützenhilfe leistet und die vor einer Generation so noch gar nicht existierte, lebt von dem ganzen Geld - überwiegend von der Großzügigkeit und Verrücktheit begüterter Kunstliebhaber, gleich, ob deren Motive nun erhaben oder falsch sind."
Nick Paumgarten porträtiert den Galeristen David Zwirner, der zu den maßgeblichen und erfolgreichsten Kunsthändlern weltweit zählt und dessen New Yorker Galerie Kunststars wie Isa Genzken, Chris Ofili, Daniel Richter und Thomas Ruff vertrat und vertritt. Er bezeichnet den gegenwärtigen Kunstmarkt als "höchstflorierende Branche", keine andere verkaufe derzeit in dieser Frequenz so viel "teures Zeug". Warum Menschen so viel Geld für Kunst ausgeben? Zwirner, der das Verkaufsgeschäft auf den großen Kunstmessen "fast pervers" findet, meint: "'Es wird auch deshalb so viel über Geld geredet, weil das viel einfacher ist, als über Kunst zu sprechen'. Man begegnet in der Kunstwelt vielen, die diese Fixierung aufs Geld und seine Dominanz entsetzt und fertig macht. Es lenkt vom Werk ab, sagen sie. Es deformiert kuratorische Instinkte, kritische Beurteilungen und die Karrieren junger Künstler. Es schreckt Leute ab, sie beginnen, Kunst in einen Topf mit anderen Auswüchsen zu werfen und sie als ein weiteres protziges Spielzeug der Reichen abzutun. Natürlich machen sich viele von denen, die das beklagen - Händler, Künstler, Kuratoren -, zu Komplizen. Die Kulturindustrie, die ihnen auf die eine oder andere Weise Schützenhilfe leistet und die vor einer Generation so noch gar nicht existierte, lebt von dem ganzen Geld - überwiegend von der Großzügigkeit und Verrücktheit begüterter Kunstliebhaber, gleich, ob deren Motive nun erhaben oder falsch sind."Weitere Artikel: Kelefa Sanneh beleuchtet anhand der Frage "Wer braucht schon Hits?" die Bestseller-Industrie des Buchmarkts. Und David Denby sah im Kino den zweiten Teil der "Tribute von Panem"-Verfilmung "Catching Fire" von Francis Lawrence und Alec Gibneys Dokumentation "The Armstrong Lie" über den Doping-Radprofi Lance Armstrong.
The Atlantic (USA), 01.12.2013
 In einem riesigen Report untersucht Don Peck die Mechanismen der Arbeitswelt. Aller psychologisch unterfütterten Personalpolitik zum Trotz herrsche noch immer eine Regel: Große Männer und schöne Frauen werden leichter eingestellt und schneller befördert, wer kompetent aussieht, wird besser bezahlt. Jetzt dienen sich Firmen wie Knack als Lösung und preisen Big Data als Lösung, beziehungsweise ihre Computerspiele: "Diese Spiele sind nicht zum Spaß da: Sie wurden von einer Gruppe von Neurologen, Psychologen und Datenspezialisten entwickelt, um das menschliche Potenzial zu erkunden. Wer nur 20 Minuten spielt, erklärt Knack-Gründer Guy Halfteck, generiert mehrere Megabyte Daten, exponentiell mehr als alles, was Aufnahmeprüfungen oder Bewerbungstests herausfinden. Wie lange man zögert, bevor man handelt, die Vielzahl der Handlungen, die Art der Problemlösung - all diese Faktoren und noch viel mehr werden beim Spielen gespeichert und dann genutzt, um Kreativität und Ausdauer zu ermitteln, soziale Intelligenz und Persönlichkeit, die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen oder Prioritäten zu setzen. Das Ergebnis ist laut Halfteck ein hochauflösenden Porträt unserer Psyche und unseres Intellekts, ein Test für unsere Anlagen als Führungspersönlichkeit und Innovator."
In einem riesigen Report untersucht Don Peck die Mechanismen der Arbeitswelt. Aller psychologisch unterfütterten Personalpolitik zum Trotz herrsche noch immer eine Regel: Große Männer und schöne Frauen werden leichter eingestellt und schneller befördert, wer kompetent aussieht, wird besser bezahlt. Jetzt dienen sich Firmen wie Knack als Lösung und preisen Big Data als Lösung, beziehungsweise ihre Computerspiele: "Diese Spiele sind nicht zum Spaß da: Sie wurden von einer Gruppe von Neurologen, Psychologen und Datenspezialisten entwickelt, um das menschliche Potenzial zu erkunden. Wer nur 20 Minuten spielt, erklärt Knack-Gründer Guy Halfteck, generiert mehrere Megabyte Daten, exponentiell mehr als alles, was Aufnahmeprüfungen oder Bewerbungstests herausfinden. Wie lange man zögert, bevor man handelt, die Vielzahl der Handlungen, die Art der Problemlösung - all diese Faktoren und noch viel mehr werden beim Spielen gespeichert und dann genutzt, um Kreativität und Ausdauer zu ermitteln, soziale Intelligenz und Persönlichkeit, die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen oder Prioritäten zu setzen. Das Ergebnis ist laut Halfteck ein hochauflösenden Porträt unserer Psyche und unseres Intellekts, ein Test für unsere Anlagen als Führungspersönlichkeit und Innovator."Der kanadische Theoretiker und Politiker Michael Ignatieff bricht eine Lanze für Machiavellis politisches Traktat "Der Fürst", das seit seinem Erscheinen vor fünfhundert Jahren ein anhaltender Skandal ist: "Machiavelli glaubte nicht, dass sich Politiker grämen sollten, wenn sie sich die Hände schmutzig gemacht haben. Seiner Meinung nach verdienten sie kein Lob für moralische Skrupel oder Gewissensbisse. Er hätte es mit den Sopranos gehalten: Manchmal tut man, was man tun muss. Aber 'Der Fürst' hätte nicht solange überlebt, wenn es nur eine Apologie des Gangstertums wäre. Bei Gangstern ist unnötige Grausamkeit effizient, während sie in der Politik, das verstand Machivelli sehr gut, schlimmer ist als ein Verbrechen. Nämlich ein Fehler."
Foreign Policy (USA), 19.11.2013
 Ralph Langner analysiert noch einmal die Aufgaben und Wirkungsweisen von Stuxnet, einem Computervirus, der - vermutlich aus den Laboren der NSA - in die iranischen Atomanlagen eingespeist wurde, und hält ihn für ausgeklügelter als bisher gedacht: "Es ist viel darüber geschrieben worden, dass es Stuxnet nicht gelungen sei, eine erhebliche Zahl der Zentrifugen zu zerstören oder die iranische Urananreicherung bedeutend zu drosseln. Das ist zwar fraglos richtig, aber es scheint auch nicht das Ziel der Saboteure gewesen zu sein. Hätte Stuxnet katastrophalen Schaden angerichtet, wäre es eher ein Unfall als Absicht gewesen. Die Angreifer hätten ihrem Opfer das Genick brechen können, doch sie entschieden sich für anhaltendes regelmäßiges Würgen. Stuxnet zielte darauf ab, die Lebensdauer der Zentrifugen zu verringern und den iranischen Ingenieuren den Eindruck zu vermitteln, sie würden ihr komplexes Kontrollsystem selbst nicht durchschauen."
Ralph Langner analysiert noch einmal die Aufgaben und Wirkungsweisen von Stuxnet, einem Computervirus, der - vermutlich aus den Laboren der NSA - in die iranischen Atomanlagen eingespeist wurde, und hält ihn für ausgeklügelter als bisher gedacht: "Es ist viel darüber geschrieben worden, dass es Stuxnet nicht gelungen sei, eine erhebliche Zahl der Zentrifugen zu zerstören oder die iranische Urananreicherung bedeutend zu drosseln. Das ist zwar fraglos richtig, aber es scheint auch nicht das Ziel der Saboteure gewesen zu sein. Hätte Stuxnet katastrophalen Schaden angerichtet, wäre es eher ein Unfall als Absicht gewesen. Die Angreifer hätten ihrem Opfer das Genick brechen können, doch sie entschieden sich für anhaltendes regelmäßiges Würgen. Stuxnet zielte darauf ab, die Lebensdauer der Zentrifugen zu verringern und den iranischen Ingenieuren den Eindruck zu vermitteln, sie würden ihr komplexes Kontrollsystem selbst nicht durchschauen."Blätter f. dt. u. int. Politik (Deutschland), 01.11.2013
 Viel zu verzagt findet András Bruck, wie Linke und Intellektuelle in Ungarn gegen Viktor Orbán aufbegehren. Denn dessen Regierung, meint Bruck, hat den Ungarn ihr Land geraubt und eine besonders hässliche Diktatur errichtet: "Eine Diktatur ist niemals schön, aber diese jetzige ungarische Version ist besonders widerlich. Nicht ihre Brutalität ist es, die wirklich erschüttert, sondern ihre Unehrlichkeit. Denn ohne jeglichen Ehrenkodex gibt es keine Politik, keinen Politiker, und eine Demokratie erst recht nicht. Im Gegensatz zu Kádárs System, dessen Grundlage die pure Kraft war, die Gewalt, die unter Zwang fremden Interessen dienen musste, besteht die Basis diesmal in Manipulation, Lüge und Betrug ... Kádárs Diktatur hat zwar mehr verboten, sie hat gröber und tiefer in unser Leben eingegriffen, trotzdem war sie korrekter als die von Orbán. Das damalige System war identisch mit sich selbst, das heutige ist es nicht. Damals wurde mir der Pass abgenommen, an der Grenze wurde ich durchsucht, der Parteisekretär machte mich schriftlich auf meine 'nachlässige Körperhaltung' auf der Produktionsversammlung aufmerksam, was ich lächerlich und grauenvoll zugleich fand, und trotzdem, im Vergleich zu dem hier waren die damals Ehrenmänner."
Viel zu verzagt findet András Bruck, wie Linke und Intellektuelle in Ungarn gegen Viktor Orbán aufbegehren. Denn dessen Regierung, meint Bruck, hat den Ungarn ihr Land geraubt und eine besonders hässliche Diktatur errichtet: "Eine Diktatur ist niemals schön, aber diese jetzige ungarische Version ist besonders widerlich. Nicht ihre Brutalität ist es, die wirklich erschüttert, sondern ihre Unehrlichkeit. Denn ohne jeglichen Ehrenkodex gibt es keine Politik, keinen Politiker, und eine Demokratie erst recht nicht. Im Gegensatz zu Kádárs System, dessen Grundlage die pure Kraft war, die Gewalt, die unter Zwang fremden Interessen dienen musste, besteht die Basis diesmal in Manipulation, Lüge und Betrug ... Kádárs Diktatur hat zwar mehr verboten, sie hat gröber und tiefer in unser Leben eingegriffen, trotzdem war sie korrekter als die von Orbán. Das damalige System war identisch mit sich selbst, das heutige ist es nicht. Damals wurde mir der Pass abgenommen, an der Grenze wurde ich durchsucht, der Parteisekretär machte mich schriftlich auf meine 'nachlässige Körperhaltung' auf der Produktionsversammlung aufmerksam, was ich lächerlich und grauenvoll zugleich fand, und trotzdem, im Vergleich zu dem hier waren die damals Ehrenmänner."Nepszabadsag (Ungarn), 23.11.2013
 Anita Pethő stellt Lajos Parti Nagys Novellenband "Mi történt avagy sem" (Was passierte oder nicht) vor, der die realen Verhältnisse des Landes leicht ins Unwirkliche verschiebt: "Die Novellen des Bandes sind für solche Menschen, denen politischer Anstand oder Toleranz nicht nur bekannt sind, sondern auch zu befolgende Werte. Zugleich geht es um hier um Menschen, für die diese Ideen nicht mal in Form der Verneinung existieren, um Situationen, in denen solche Ideen keinen Wert haben und in denen der andere nur die Sprache der Gewalt kennt. Fehlender Respekt gegenüber anderen Menschen und Grausamkeit gehen in den Novellen Hand in Hand... Aus welchem Blickwinkel auch immer betrachtet, die Welt in diesem Band ist weder schön noch gut."
Anita Pethő stellt Lajos Parti Nagys Novellenband "Mi történt avagy sem" (Was passierte oder nicht) vor, der die realen Verhältnisse des Landes leicht ins Unwirkliche verschiebt: "Die Novellen des Bandes sind für solche Menschen, denen politischer Anstand oder Toleranz nicht nur bekannt sind, sondern auch zu befolgende Werte. Zugleich geht es um hier um Menschen, für die diese Ideen nicht mal in Form der Verneinung existieren, um Situationen, in denen solche Ideen keinen Wert haben und in denen der andere nur die Sprache der Gewalt kennt. Fehlender Respekt gegenüber anderen Menschen und Grausamkeit gehen in den Novellen Hand in Hand... Aus welchem Blickwinkel auch immer betrachtet, die Welt in diesem Band ist weder schön noch gut."Ervin Tamás empört sich über die Besetzung des Direktorenpostens des Budapester Theaters Vígszínház, die nach der neuen Ausschreibung auf 18 Monate beschränkt werden soll: "Wir möchten Béla Hamvas glauben, der sagte: 'Wen ich belüge, der verachtet mich weniger, als ich den verachte, der sich von mir belügen lässt.'"
Elet es Irodalom (Ungarn), 25.11.2013
 Der Politiker György Giczy beklagt die wachsende Skepsis gegenüber der EU in Ungarn: "Das nüchterne nationale Bewusstsein wurde gegen die Selbstüberschätzung eingetauscht: Unsere Regierung belehrt den Westen über 'die Idee von Europa'. Keine Nation auf diesem Kontinent hat aber ein Privileg hierauf, denn 'die europäische Idee' besteht in der Anerkennung der Gemeinschaft der hier lebenden Völker... Die Europaskeptiker dagegen leiten seit der Wirtschaftskrise ihre kritische Haltung nicht aus den Mängeln der europäischen Idee ab - soweit geht nur unsere Regierung! -, sondern aus der Kraftlosigkeit der Gemeinschaft … Selbstverständlich kann man das mangelnde europäische Engagement im Westen kritisieren und nicht nur ökonomisch, sondern auch geistig die Zeichen des Untergangs deuten ... Es ist möglich, aber es lohnt sich nicht. Denn unsere Aufgabe ist es nicht, eine idealisierte europäische Vergangenheit vom heutigen Europa einzufordern, sondern das zukünftige Europa aufzubauen."
Der Politiker György Giczy beklagt die wachsende Skepsis gegenüber der EU in Ungarn: "Das nüchterne nationale Bewusstsein wurde gegen die Selbstüberschätzung eingetauscht: Unsere Regierung belehrt den Westen über 'die Idee von Europa'. Keine Nation auf diesem Kontinent hat aber ein Privileg hierauf, denn 'die europäische Idee' besteht in der Anerkennung der Gemeinschaft der hier lebenden Völker... Die Europaskeptiker dagegen leiten seit der Wirtschaftskrise ihre kritische Haltung nicht aus den Mängeln der europäischen Idee ab - soweit geht nur unsere Regierung! -, sondern aus der Kraftlosigkeit der Gemeinschaft … Selbstverständlich kann man das mangelnde europäische Engagement im Westen kritisieren und nicht nur ökonomisch, sondern auch geistig die Zeichen des Untergangs deuten ... Es ist möglich, aber es lohnt sich nicht. Denn unsere Aufgabe ist es nicht, eine idealisierte europäische Vergangenheit vom heutigen Europa einzufordern, sondern das zukünftige Europa aufzubauen."József Mélyi feiert die Ausstellung "Fragmente" des Malers und Bildhauers István Geller in der Budapester Galerie 2B. Sie zeigt Fragmente einer Stadt: "Alles hier ist: Fossilien, Grundrissfragmente, enigmatische Zeichen. Den Bildern und den feinen Reliefs fehlt eine Sache: Die Lebendigkeit der Geschichte."
Point (Frankreich), 21.11.2013
Superpathetisch und très républicain wird BHL angesichts der Demos in der Bretagne, wo gegen Steuern - also gegen den in Frankreich alles steuernden (und eventuell gegen die Wand fahrenden) Zentralstaat - protestiert wird: "Der Souverän selbst, das souveräne Volk, so wie es nach Jahrhunderten die philosophische Reflexion definierte, wird sich in den trüben Wassern einer Gesellschaft auflösen, in der der Mensch des Menschen Wolf wird, wie Hobbes sie fürchtete und mit ihm fast das gesamte moderne politische Denken. Was ist Populismus? Der Pöbel, der sich an die Stelle des Vokes setzt."
Slate.fr (Frankreich), 25.11.2013
Louise Tourret stellt Olivier Peyons Dokumentarfilm "Comment j'ai détesté les maths" (Ich verabscheue Mathe) über Macht und Elend der Mathematik vor. Einerseits ist es populär, mit mathematischer Ignoranz zu kokettieren: "Wie es Cédric Villlani (der 2010 mit der Fields-Mdeaille ausgezeichnet wurde) sagt: 'Es gibt soviele Leute, die behaupten, sie seien die letzten in Mathe gewesen, dass man sich fragt, wie es so viele letzte geben kann." Andererseits beschwört der Film angesichts der Finanzkrise die Verantwortung der Mathematiker: "Früher konnte man Mathe in aller Ruhe verabscheuen. Heute müssen wir verstehen, welche Risiken damit verbunden sind."
Times Literary Supplement (UK), 22.11.2013
 Elena Ferrante hat sich hierzulande nie ganz durchsetzen können. Catharine Morris feiert sie als eine von Italiens wunderbarsten Autorinnen und stellt ihren neuen Roman vor, der im Englischen unter dem Titel "The Story of a New Name" erschienen ist: "Eine von Ferrantes größten Stärken ist die Beharrlichkeit, mit der sie Gedanken offenlegt, die normalerweise unausgesprochen bleiben. Wie auch die Furchtlosigkeit, mit der sie sie niederschreibt. 'Ich fühle mich so leer, dass es mich ganz fertig macht', gesteht die schwangere Lila (ihrer Freundin) Elena. 'Ich weiß, dass ich mir schöne Dinge vorstellen sollte. Ich weiß, dass ich mich zurückstellen muss, aber ich kann es nicht. Ich sehe keinen Grund für Verzicht und keinen für Schönheit.' Ferrante ist auch eine Meisterin des inneren Konflikts, der Momente der Selbsterkenntnis und der Veränderung."
Elena Ferrante hat sich hierzulande nie ganz durchsetzen können. Catharine Morris feiert sie als eine von Italiens wunderbarsten Autorinnen und stellt ihren neuen Roman vor, der im Englischen unter dem Titel "The Story of a New Name" erschienen ist: "Eine von Ferrantes größten Stärken ist die Beharrlichkeit, mit der sie Gedanken offenlegt, die normalerweise unausgesprochen bleiben. Wie auch die Furchtlosigkeit, mit der sie sie niederschreibt. 'Ich fühle mich so leer, dass es mich ganz fertig macht', gesteht die schwangere Lila (ihrer Freundin) Elena. 'Ich weiß, dass ich mir schöne Dinge vorstellen sollte. Ich weiß, dass ich mich zurückstellen muss, aber ich kann es nicht. Ich sehe keinen Grund für Verzicht und keinen für Schönheit.' Ferrante ist auch eine Meisterin des inneren Konflikts, der Momente der Selbsterkenntnis und der Veränderung." Carmine Di Biase verehrt in aller Ausführlichkeit den Schriftsteller und Partisanen Italo Calvino, von dem gleich mehrere Bände mit Interviews und Briefen auf Englisch erschienen sind: "Nicht auf das Ego kam es ihm an, sondern auf das, was man für andere tut. Das war für Calvino ein moralischer Imperativ. Er glaubte ganz ernsthaft daran, wie er 1979 in einem Interview erklärte, dass man nicht mit dem Recht zu Sein geboren wird: man muss es sich verdienen durch 'quel che si fa', das heißt, durch 'das, was man tut'."
New Republic (USA), 09.12.2013
 David Thomson jubelt: Paolo Sorrentino ist sogar noch grandioser als der cineastische Großmeister Federico Fellini. Schon bald werde "La Grande Belezza" als neue Version von "Achteinhalb" gelten, glaubt er. Was zu großen Teilen auch das Verdienst von Toni Servillo sei, der darin einen gealterten Schriftsteller in der Schaffenskrise spielt. "Das Leben, so versucht er zu sagen, ist zu umfangreich, zu unordentlich, zu stetig, um auf 250 Seiten gebannt werden zu können. All das wird transportiert von Servillos elastischem Gesicht: sorgenvoll, sympathisch und niemals unfreundlich oder kalt, begierig darauf amüsiert zu werden, nicht schön, aber unvergänglich attraktiv. Er beobachtet das Leben, aber er entscheidet sich dazu, es als Traum zu behandeln."
David Thomson jubelt: Paolo Sorrentino ist sogar noch grandioser als der cineastische Großmeister Federico Fellini. Schon bald werde "La Grande Belezza" als neue Version von "Achteinhalb" gelten, glaubt er. Was zu großen Teilen auch das Verdienst von Toni Servillo sei, der darin einen gealterten Schriftsteller in der Schaffenskrise spielt. "Das Leben, so versucht er zu sagen, ist zu umfangreich, zu unordentlich, zu stetig, um auf 250 Seiten gebannt werden zu können. All das wird transportiert von Servillos elastischem Gesicht: sorgenvoll, sympathisch und niemals unfreundlich oder kalt, begierig darauf amüsiert zu werden, nicht schön, aber unvergänglich attraktiv. Er beobachtet das Leben, aber er entscheidet sich dazu, es als Traum zu behandeln."Außerdem: Jason Farago entdeckt in Thomas Ostermeiers Inszenierung von Ibsens "Volksfeind", die es von Berlin nach Brooklyn geschafft hat, interpretatorische Parallelen zum NSA-Skandal: "Was Ibsen so modern und 'Ein Volksfeind' für die Snowden-Affäre so passend macht, ist das Verständnis, dass Whistleblower entgegen des happy-Hacker-Images von schlechten Hollywood-Filmen wie 'The Fifth Estate' viel mehr tun als geheimes Wissen aufzudecken. Der Whistelblower bei Ibsen klagt nicht nur ein einzelnes Verbrechen an, sondern ein politisches und wirtschaftliches System in seiner offen liegenden Gänze."
Hier der Trailer der Schaubühne:
MicroMega (Italien), 15.11.2013
Micromega gehört zu den Medien, die die deutsche Austeritätspolitik Woche für Woche attackieren. Bitter liest sich die Anklage Barbara Spinellis, die die Deutschen an das Kriegsende erinnert: "Es folgte die Weitsicht der Sieger. Im Jahre 1953 haben 65 Staaten in einen Schuldenschnitt für die deutschen Kriegsschulden eingewilligt (darunter Italien und Griechenland, die heutigen Testländer der Zinskompression) und haben somit den Deutschen ihr außerordentliches Wirtschaftswunder der folgenden Jahrzehnte ermöglicht. Aber die Ursachen dieses Wirtschaftswunders sind heute vergessen, und dieses Vergessen erklärt, warum die deutsche Führung in Europa heute ohne weitblickende Solidarität und Verantwortungssinn auskommt."
Aeon (UK), 13.11.2013
 Mit gebührender Skepsis stellt Jesse Bering einige Wissenschaftler vor, die nach Beweisen für ein Leben nach dem Tod forschen. Unter ihnen ist Sam Parnia von der New Yorker Universität Stony Brook, der versucht, Berichte über sogenannte Nahtoderlebnisse zu verifizieren. Immerhin zehn Prozent aller Herzstillstandpatienten erzählen, sie hätten die Szene ihrer Wiederbelebung aus der Vogelperspektive mitangesehen. "Parnia plant nun, während des Herzstillstands zufällige computergenerierte Bilder auf den Boden des OPs zu projizieren, sichtbar nur für einen von der Decke herabblickenden 'Geist'. Wenn eine Person, deren Hirnaktivitäten denen eines Kohlkopfs entspricht, anschließend berichten kann, sie habe dort, sagen wir mal, ein rosa Nashorn mit Sonnenbrille gesehen, dann müsste vielleicht sogar ich meine bisherigen Annahmen überdenken. Der Hypothese, es handle sich um bloße Halluzinationen, würde damit jedenfalls der Wind aus den Segeln genommen."
Mit gebührender Skepsis stellt Jesse Bering einige Wissenschaftler vor, die nach Beweisen für ein Leben nach dem Tod forschen. Unter ihnen ist Sam Parnia von der New Yorker Universität Stony Brook, der versucht, Berichte über sogenannte Nahtoderlebnisse zu verifizieren. Immerhin zehn Prozent aller Herzstillstandpatienten erzählen, sie hätten die Szene ihrer Wiederbelebung aus der Vogelperspektive mitangesehen. "Parnia plant nun, während des Herzstillstands zufällige computergenerierte Bilder auf den Boden des OPs zu projizieren, sichtbar nur für einen von der Decke herabblickenden 'Geist'. Wenn eine Person, deren Hirnaktivitäten denen eines Kohlkopfs entspricht, anschließend berichten kann, sie habe dort, sagen wir mal, ein rosa Nashorn mit Sonnenbrille gesehen, dann müsste vielleicht sogar ich meine bisherigen Annahmen überdenken. Der Hypothese, es handle sich um bloße Halluzinationen, würde damit jedenfalls der Wind aus den Segeln genommen."Wired (USA), 21.12.2013
 Auch der Kampf gegen Polio kann - nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Pocken - beeindruckende Ergebnisse vorweisen, erfahren wir in einer multimedial aufbereitenen Reportage von Matthieu Aikins. Gerade mal ein paar hundert Fälle sind noch pro Jahr zu vermelden - und diese in geografisch oder politisch schwer zugänglichen Gebieten wie etwa Afghanistan. Das macht diese Fälle nicht nur zu den am schwierigsten durchzuführenden, sondern auch - pro Kopf gerechnet - zu den mit Abstand kostenintensivsten Behandlungen der ganzen Kampagne. Doch entsprechende Kritik hält Aikins für zu kurz gedacht: "Die Mathematik der Kosten-Nutzen-Analyse läuft auf Grund, wenn es um die Kampagnen zur Ausrottung der Krankheit geht, denn der Nutzen ist, theoretisch, unbegrenzt. Das bedeutet: Für den weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte wird niemand mehr an Pocken sterben oder auch nur einen Pfennig für eine Impfung ausgeben müssen (...). Nach einer Studie von 2010 würde eine Ausrottung von Polio bis zum Jahr 2035 zwischen 40 und 50 Milliarden Dollar Nettogewinn erzeugen. Betrachtet man es nur langfristig genug, wird die Ausrottung von Polio eines Tages als herausragend günstig eingeschätzt werden."
Auch der Kampf gegen Polio kann - nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Pocken - beeindruckende Ergebnisse vorweisen, erfahren wir in einer multimedial aufbereitenen Reportage von Matthieu Aikins. Gerade mal ein paar hundert Fälle sind noch pro Jahr zu vermelden - und diese in geografisch oder politisch schwer zugänglichen Gebieten wie etwa Afghanistan. Das macht diese Fälle nicht nur zu den am schwierigsten durchzuführenden, sondern auch - pro Kopf gerechnet - zu den mit Abstand kostenintensivsten Behandlungen der ganzen Kampagne. Doch entsprechende Kritik hält Aikins für zu kurz gedacht: "Die Mathematik der Kosten-Nutzen-Analyse läuft auf Grund, wenn es um die Kampagnen zur Ausrottung der Krankheit geht, denn der Nutzen ist, theoretisch, unbegrenzt. Das bedeutet: Für den weiteren Verlauf der Menschheitsgeschichte wird niemand mehr an Pocken sterben oder auch nur einen Pfennig für eine Impfung ausgeben müssen (...). Nach einer Studie von 2010 würde eine Ausrottung von Polio bis zum Jahr 2035 zwischen 40 und 50 Milliarden Dollar Nettogewinn erzeugen. Betrachtet man es nur langfristig genug, wird die Ausrottung von Polio eines Tages als herausragend günstig eingeschätzt werden."The Nation (USA), 09.12.2013
 Margarete von Trottas Film über "Hannah Arendt" ist in den USA angelaufen und beschäftigt dort eine ganze Reihe illustrer Autoren. David Rieff zum Beispiel ärgert sich sehr, dass Trotta und ihre Drehbuch-Autorin Pamela Katz Arendts Kritiker (wie auch die meisten Amerikaner und Israelis) als groteske, jämmerliche oder brutale Typen darstellen, bleibt ansonsten aber ausgewogen: "Sie porträtieren ihren Mut, ihr Talent für Freundschaft, ihre berührend komplexe Beziehung zu Heinrich Blücher, die Unbeugsamkeit ihres Geistes und natürlich die Tiefe und Kraft ihrer Intelligenz. Aber so erfolgreich sie auch das Denken an sich auf die Leinwand bringen, schaffen sie es doch nicht, Arendts spezielle Gedanken ebenso gelungen darzustellen... Trotta und Katz porträtieren ihre Einsamkeit, doch auch wenn sie Arendt durchaus als sehr entschieden zeigen, so ist ihre Arroganz allenfalls die Arroganz der einsamen Sucherin nach der Wahrheit. Dabei war es häufig schlicht die Arroganz der Arroganz."
Margarete von Trottas Film über "Hannah Arendt" ist in den USA angelaufen und beschäftigt dort eine ganze Reihe illustrer Autoren. David Rieff zum Beispiel ärgert sich sehr, dass Trotta und ihre Drehbuch-Autorin Pamela Katz Arendts Kritiker (wie auch die meisten Amerikaner und Israelis) als groteske, jämmerliche oder brutale Typen darstellen, bleibt ansonsten aber ausgewogen: "Sie porträtieren ihren Mut, ihr Talent für Freundschaft, ihre berührend komplexe Beziehung zu Heinrich Blücher, die Unbeugsamkeit ihres Geistes und natürlich die Tiefe und Kraft ihrer Intelligenz. Aber so erfolgreich sie auch das Denken an sich auf die Leinwand bringen, schaffen sie es doch nicht, Arendts spezielle Gedanken ebenso gelungen darzustellen... Trotta und Katz porträtieren ihre Einsamkeit, doch auch wenn sie Arendt durchaus als sehr entschieden zeigen, so ist ihre Arroganz allenfalls die Arroganz der einsamen Sucherin nach der Wahrheit. Dabei war es häufig schlicht die Arroganz der Arroganz." In der New York Review of Books hatte zuvor Mark Lilla kein gutes Haar an dem Film gelassen: "Verständlich ist Trottas Zurückhaltung, in die Einzelheiten des Eichmann-Prozesses zu gehen, oder auch das vorwegzunehmen, was wir heute wissen, denn das hätte die Integrität des Films verletzt. Doch etwas anderes wird vielleicht beschädigt, wenn eine Geschichte den Mut einer Denkerin feiert, eine Position zu verteidigen, von der wir heute wissen, dass sie nicht zu halten ist - wie Arendt, wenn sie noch am Leben wäre, zugeben müsste."
Kommentieren