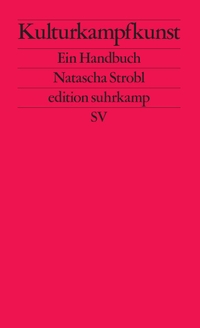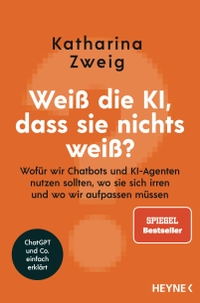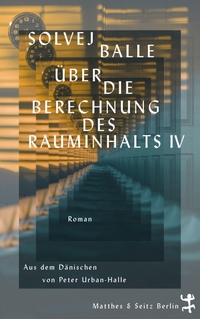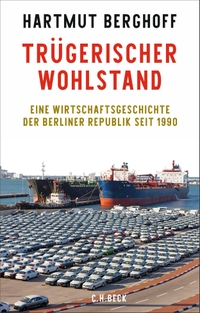Magazinrundschau
Wie ein schnarchender Roboter
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
05.04.2022. Putin und Dugin erinnern Magdalena Platzová in iLiteratura.cz an all jene verkrachten Gestalten, "die seit je mit alkoholvernebeltem Kopf oder in religiöser Verwirrung oder beidem durch die russische Literatur wanken". Atlantic besucht die neuen Engelmacherinnen in den USA und testet ihre Maschinen. In La Vie des Idées macht Militärhistoriker Bruno Cabanes klar, dass eine Geschichte des Kriegs eine Kulturgeschichte sein muss. Magyar Narancs hofft, dass sich die EU mit Orban keinen Taschen-Putin züchtet.
iLiteratura (Tschechien), 01.04.2022
Merkur (Deutschland), 01.04.2022
 Das Bundesverfassungsgericht hat schon immer auch politische Entscheidungen gefällt, räumt Uwe Volkmann ein, aber mit Blick auf das Urteil zur Klimagerechtigkeit für künftige Generationen sieht er eine neue Stufe erreicht. In der enormen Politisierung dieses Verfahrens sieht Volkmann das Ergebnis einer Moralisierung des Rechts, die den Kampf für die gerechte Sache vor gerichten austragen will: "Damit fügt es sich in eine Form der Prozessführung, die in den letzten Jahren immer weiter professionalisiert worden ist und sich mittlerweile ihrerseits zu einem eigenen Typus verfestigt hat, der 'strategic litigation' genannt wird: als, wie es auf einer einschlägigen Internetseite heißt, Versuch, 'weitreichende gesellschaftliche Veränderungen über die Einzelklage hinaus zu bewirken'. Auch zahlreiche andere Fälle vor dem Bundesverfassungsgericht der jüngeren Zeit lassen sich ihm zuordnen: Hinter den Klagen gegen Verschärfungen der Polizei- und Sicherheitsgesetze stand und steht regelmäßig die 'Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.', die gerade zu diesem Zweck gegründet wurde und ein 'Besseres Recht durch strategische Klagen' zu ihrem Vereinsmotto hat; die Klage zur Anerkennung eines dritten Geschlechts im Personenstandsrecht war betrieben von einer 'Kampagne für eine dritte Option', die sich mittlerweile offenbar aufgelöst hat, nachdem sie ihre Ziele durch das Urteil erreicht sah."
Das Bundesverfassungsgericht hat schon immer auch politische Entscheidungen gefällt, räumt Uwe Volkmann ein, aber mit Blick auf das Urteil zur Klimagerechtigkeit für künftige Generationen sieht er eine neue Stufe erreicht. In der enormen Politisierung dieses Verfahrens sieht Volkmann das Ergebnis einer Moralisierung des Rechts, die den Kampf für die gerechte Sache vor gerichten austragen will: "Damit fügt es sich in eine Form der Prozessführung, die in den letzten Jahren immer weiter professionalisiert worden ist und sich mittlerweile ihrerseits zu einem eigenen Typus verfestigt hat, der 'strategic litigation' genannt wird: als, wie es auf einer einschlägigen Internetseite heißt, Versuch, 'weitreichende gesellschaftliche Veränderungen über die Einzelklage hinaus zu bewirken'. Auch zahlreiche andere Fälle vor dem Bundesverfassungsgericht der jüngeren Zeit lassen sich ihm zuordnen: Hinter den Klagen gegen Verschärfungen der Polizei- und Sicherheitsgesetze stand und steht regelmäßig die 'Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V.', die gerade zu diesem Zweck gegründet wurde und ein 'Besseres Recht durch strategische Klagen' zu ihrem Vereinsmotto hat; die Klage zur Anerkennung eines dritten Geschlechts im Personenstandsrecht war betrieben von einer 'Kampagne für eine dritte Option', die sich mittlerweile offenbar aufgelöst hat, nachdem sie ihre Ziele durch das Urteil erreicht sah."Elena Meilicke erliegt der schauerlichen Faszination der Mommy Media: "Ich sehe den gesponsorten Content, die kaum verhüllten Werbe- und Verkaufsabsichten, ich sehe den Konservatismus und Klassismus in diesen Darstellungen erfolgreicher Mutterschaft. Ich sehe, wie eng abgesteckt das Feld dessen ist, was als 'gute' und erstrebenswerte Mutterschaft angepriesen wird: Geld muss sie haben, einen Mann muss sie haben, Geschmack und Stil, und natürlich Kinder muss sie haben, viele, je mehr desto besser. Ich sehe das alles, und dennoch üben diese Seiten eine unwiderstehliche Faszination auf mich aus. Gierig sauge ich die Bilder von einem schönen, hellen, strahlenden Familienleben ein, die so frei sind von Sorgen, Nöten, schlechten Gefühlen und beengten Verhältnissen, von Selbstzweifeln und Eintönigkeit."
New Yorker (USA), 05.04.2022

Kaum Malerei, viele Videoarbeiten und Installationen entdeckt Peter Schjedahl auf der Whitney Biennale für amerikanische Gegenwartskunst und erkennt nicht nur eine Emazipation vom Kunstmarkt, wie er im New Yorker schreibt, sondern auch einen Trend weg vom persönlichen Gefühl hin zu einer gemeinsamen Erfahrung: "Erwarte nur niemand, auf den ersten Blick viel zu verstehen. Im Mittelpunkt der Arbeit 'ishkode (fire)' von Rebecca Belmore, einer Anishinaabe-Künstlerin aus Kanada, steht die Darstellung eines in Ton gegossenen Schlafsacks, der sich aufgenscheinlich um eine stehende Figur hüllt, die selbst nicht zu sehen ist. Um sie herum auf dem Boden liegen Tausende von kleinkalibrigen Patronenhülsen, vermischt mit Kupferdraht. Die Arbeit ist wunderschön, bevor man darüber spekuliert, was sie beabsichtigt, aber auch danach. Die Arbeit zeichnet sich durch eine sorgfältige Gestaltung aus, die für zahlreiche Werke der Ausstellung typisch ist. Ich kann mir vorstellen, dass die pandemische Isolation, die Künstler gleichzeitig ihrer Karriezwänge beraubt und befreit hat, eine einsame Kultivierung von Perfektion begünstigt hat."
En attendant Nadeau (Frankreich), 04.04.2022
 Als sehr nützlich erweist sich ein Kompendium, das eine ganze Reihe von Historikern gegen Eric Zemmours Geschichtsklitterei zusammengestellt hat und viele der von Zemmour verbreiteten Geschichtslügen von König Chlodwig über den "Genozid" in der gegenrevolutionären Vendée bis hin zu Pétain so gern verbreitet. Solène Minier stellt es vor. Was sie über Zemmours Bild von Algerien schreibt, erinnert an Putins Klitterungen über die Ukraine: "Algerien sei 1830 von Frankreich als Eroberer aus dem Nichts geschaffen worden. Die Algerier ihrerseits hätten ihre Unabhängigkeit nur durch die Nachsicht eines barmherzigen de Gaulle erlangt."
Als sehr nützlich erweist sich ein Kompendium, das eine ganze Reihe von Historikern gegen Eric Zemmours Geschichtsklitterei zusammengestellt hat und viele der von Zemmour verbreiteten Geschichtslügen von König Chlodwig über den "Genozid" in der gegenrevolutionären Vendée bis hin zu Pétain so gern verbreitet. Solène Minier stellt es vor. Was sie über Zemmours Bild von Algerien schreibt, erinnert an Putins Klitterungen über die Ukraine: "Algerien sei 1830 von Frankreich als Eroberer aus dem Nichts geschaffen worden. Die Algerier ihrerseits hätten ihre Unabhängigkeit nur durch die Nachsicht eines barmherzigen de Gaulle erlangt."Gallimard vertreibt den schmalen Sammelband für nur 3,90 Euro, auch als Ebook. Die Historiker äußern sich auch in einem Video, in dem sie sich an ein großes Publikum wenden:
New York Times (USA), 31.03.2022
La vie des idees (Frankreich), 28.03.2022
In Frankreich kursiert mehr noch als in Deutschland der Topos, dass rechte Literaten die besseren Stilisten seien. Vincent Berthelier geht diesem Topos in einem sehr kenntnisreichen Essay auf den Grund. Zu den Autoren, die dieses Märchen verbreiteten, gehörten in Frankreich nach dem Krieg die "Husaren", eine Gruppe reaktionärer Dandys, auf die sich auch die Nouvelle Vague bezog. Die politische Funktion dieses Diskurss war es für Berthelier, "das Engagement der literarischen Rechten für Vichy und Hitler während der Besatzungszeit zu minimieren und die älteren Kollegen (Louis-Ferdinand Céline, Paul Morand, Jacques Chardonne, Pierre Drieu La Rochelle und so weiter) zu rehabilitieren, indem sie diese als Stilisten darstellen." Die meisten dieser Autoren sind heute nur mehr für Literaturwissenschaftler interessant, aber bei Céline wirkt der Topos des Stilisten bis heute fort. Über ihn schreibt Berthelier: "Mit der Entwicklung eines Stils, der von der gesprochenen Sprache inspiriert ist, strebt Céline nicht nur nach Authentizität: Er will das Volk als ethnisch gesundes und homogenes Element ansprechen, die 'weiße Bauernrasse' wachrütteln. In der Zeit der Pamphlete (und vielleicht sogar schon vorher) wurde Célines Stil also von seinem Autor als rassistisch, nationalistisch und mobilisierend konzipiert. Erst in der Nachkriegszeit entpolitisierte Céline aus taktischen Erwägungen seinen Diskurs über den Stil und betonte die formale Dimension seines Werks."
The Atlantic (USA), 01.05.2022
 In den USA sind Schwangerschaftsabbrüche bisher grundsätzlich legal, das regelt das Urteil Roe vs. Wade, das 1973 zu Gunsten des Selbstbestimmungsrechts von Frauen entschied. Viele fürchten jetzt um den Bestand dieser Freiheit, die schon jetzt von etlichen Bundesstaaten beschränkt wird. Sie erschweren Frauen den Zugang zu Informationen, treiben die Kosten in die Höhe oder schließen Kliniken, die Abtreibungen durchführen. Jessica Bruder besucht für ihre umfangreiche Reportage Frauen, die sich im Untergrund organisieren, um sich auf risikoarme Abtreibungen unabhängig von öffentlich Institutionen vorzubereiten. Neben Medikamenten, die einen Schwangerschaftsabbruch einleiten, stellt die Reporterin auch den Del-Em vor, ein Gerät das den Fötus durch Unterdruck absaugt und aus handelsüblichen Materialien einfach selbst hergestellt werden kann. Es wurde bereits 1971 von Lorraine Rothman entwickelt und als "Absauger von Menstruationsblut" getarnt: "Spät im Januar besuchte ich drei Frauen einer Gruppe von der Westküste, die sich mit den 'Absaugern' beschäftigten. Sie wurde 2017 von einer Sexualerzieherin, ich nenne sie Noah, auf einer 'Anti-Roe'-Plattform gegründet, die damit auf die Präsidentschaftswahl Donald Trumps reagierte. Wir vier saßen in einem Bungalow, aßen Käse und Cracker, während auf einem Bildschirm an der Wand ein Lagerfeuer knisterte. Die Gruppenmitglieder sprachen über den Zugang zu Abtreibungen - von dem sie hofften, dass er sich verbesserte, indem sie Aktivist*innen in stark regulierten Bundesstaaten das 'Absaugen' beibrachten. Sie hatten bereits Besucher*innen aus Kentucky und Texas geschult und planten, einige aus Ohio aufzunehmen. Nachdem wir fast zwei Stunden lang sprachen, reihten wir uns in einem Schlafzimmer für eine praktische Demonstration ein. Eine Frau, ich nenne sie Kira, schloss einen Del-Em an eine rosa Spectra-S2-Brustpumpe an. Nachdem sie angestellt wurde, begann die Maschine in regelmäßigen Intervallen zu surren und zu klicken, es klang wie ein schnarchender Roboter. Norah, die zwar nicht schwanger war, aber gerade menstruierte, zog sich von der Hüfte abwärts aus und legte sich aufs Bett. Gekonnt führte sie das Spekulum in ihren Vaginalkanal ein, um direkten Zugang zu ihrem Muttermund herzustellen. Kira begann, die Kanüle einzuführen. 'Ich bin an deinem Eingang' sagte sie und meinte die Öffnung des Muttermunds. 'Ist es in Ordnung einzudringen?' 'Leg los', antwortete Norah. Um die Zeit rumzubringen, begann die Gruppe zu plaudern - warum gibt es noch Fax? - bis Blut in dem Aquariumsschlauch erschien. Nach fünfzehn Minuten des Absaugens, verstopfte ein kleiner Klumpen, nichts Ungewöhnliches, die Kanüle. Weil das hier nur eine Übung war und Norah begann, Krämpfe zu bekommen, beschlossen sie aufzuhören. Kira entfernte die Kanüle und ließ sie in das Einwegglas abtropfen, in dem sich der Inhalt sammelte: 2,5 cm Blut. Und dann war es vorbei."
In den USA sind Schwangerschaftsabbrüche bisher grundsätzlich legal, das regelt das Urteil Roe vs. Wade, das 1973 zu Gunsten des Selbstbestimmungsrechts von Frauen entschied. Viele fürchten jetzt um den Bestand dieser Freiheit, die schon jetzt von etlichen Bundesstaaten beschränkt wird. Sie erschweren Frauen den Zugang zu Informationen, treiben die Kosten in die Höhe oder schließen Kliniken, die Abtreibungen durchführen. Jessica Bruder besucht für ihre umfangreiche Reportage Frauen, die sich im Untergrund organisieren, um sich auf risikoarme Abtreibungen unabhängig von öffentlich Institutionen vorzubereiten. Neben Medikamenten, die einen Schwangerschaftsabbruch einleiten, stellt die Reporterin auch den Del-Em vor, ein Gerät das den Fötus durch Unterdruck absaugt und aus handelsüblichen Materialien einfach selbst hergestellt werden kann. Es wurde bereits 1971 von Lorraine Rothman entwickelt und als "Absauger von Menstruationsblut" getarnt: "Spät im Januar besuchte ich drei Frauen einer Gruppe von der Westküste, die sich mit den 'Absaugern' beschäftigten. Sie wurde 2017 von einer Sexualerzieherin, ich nenne sie Noah, auf einer 'Anti-Roe'-Plattform gegründet, die damit auf die Präsidentschaftswahl Donald Trumps reagierte. Wir vier saßen in einem Bungalow, aßen Käse und Cracker, während auf einem Bildschirm an der Wand ein Lagerfeuer knisterte. Die Gruppenmitglieder sprachen über den Zugang zu Abtreibungen - von dem sie hofften, dass er sich verbesserte, indem sie Aktivist*innen in stark regulierten Bundesstaaten das 'Absaugen' beibrachten. Sie hatten bereits Besucher*innen aus Kentucky und Texas geschult und planten, einige aus Ohio aufzunehmen. Nachdem wir fast zwei Stunden lang sprachen, reihten wir uns in einem Schlafzimmer für eine praktische Demonstration ein. Eine Frau, ich nenne sie Kira, schloss einen Del-Em an eine rosa Spectra-S2-Brustpumpe an. Nachdem sie angestellt wurde, begann die Maschine in regelmäßigen Intervallen zu surren und zu klicken, es klang wie ein schnarchender Roboter. Norah, die zwar nicht schwanger war, aber gerade menstruierte, zog sich von der Hüfte abwärts aus und legte sich aufs Bett. Gekonnt führte sie das Spekulum in ihren Vaginalkanal ein, um direkten Zugang zu ihrem Muttermund herzustellen. Kira begann, die Kanüle einzuführen. 'Ich bin an deinem Eingang' sagte sie und meinte die Öffnung des Muttermunds. 'Ist es in Ordnung einzudringen?' 'Leg los', antwortete Norah. Um die Zeit rumzubringen, begann die Gruppe zu plaudern - warum gibt es noch Fax? - bis Blut in dem Aquariumsschlauch erschien. Nach fünfzehn Minuten des Absaugens, verstopfte ein kleiner Klumpen, nichts Ungewöhnliches, die Kanüle. Weil das hier nur eine Übung war und Norah begann, Krämpfe zu bekommen, beschlossen sie aufzuhören. Kira entfernte die Kanüle und ließ sie in das Einwegglas abtropfen, in dem sich der Inhalt sammelte: 2,5 cm Blut. Und dann war es vorbei."Magyar Narancs (Ungarn), 05.04.2022
 In einem Editorial positionierte sich Magyar Narancs noch vor den Parlamentswahlen, bei der die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán erneute eine weitere Zweidrittel-Mehrheit erlangte. "Nehmen wir also an, dass die Orbán-Regierung ihre 'Arbeit' unter den bekannten Bedingungen fortsetzt. (...) Internationale Isolierung wird es geben, aber kaum Geld - denn hoffen wir, dass es der Europäischen Union nicht einfällt, der Orbán-Regierung Zugang zum Wiederaufbaufonds zu gewähren. Eigentlich müssten selbst die Auszahlungen und Transferleistungen aus dem gewöhnlichen Haushalt verweigert werden. Es gab Wahlbetrug, und die Union will ja keinen Taschen-Putin finanzieren."
In einem Editorial positionierte sich Magyar Narancs noch vor den Parlamentswahlen, bei der die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán erneute eine weitere Zweidrittel-Mehrheit erlangte. "Nehmen wir also an, dass die Orbán-Regierung ihre 'Arbeit' unter den bekannten Bedingungen fortsetzt. (...) Internationale Isolierung wird es geben, aber kaum Geld - denn hoffen wir, dass es der Europäischen Union nicht einfällt, der Orbán-Regierung Zugang zum Wiederaufbaufonds zu gewähren. Eigentlich müssten selbst die Auszahlungen und Transferleistungen aus dem gewöhnlichen Haushalt verweigert werden. Es gab Wahlbetrug, und die Union will ja keinen Taschen-Putin finanzieren."Elet es Irodalom (Ungarn), 05.04.2022
 Der aus der Vojvodina stammende Soziologe György Szerbhorváth fühlt sich in Élet és Irodalom durch den Ukraine-Krieg nicht nur an die Belagerung von Sarajewo vor dreißig Jahren erinnert. "Entgegen einer weit verbreiteten Meinung denke ich, dass der Krieg in der Ukraine nicht der erste nach 1945 in Europa ist. Es ist kennzeichnend für die Erinnerungskultur, dass 1956, die erste sowjetische 'besondere Militäroperation' verdrängt wird, genauso wie die Belagerung der Tschechoslowakei von 1968. Als wären sie nie passiert. Auch die südslawischen Kriege werden bemäntelt, obwohl der internationale Strafgerichtshof in Den Haag die Haupttäter zur Rechenschaft zog - die kleineren Kriegsverbrecher wurden jedoch laufen gelassen. Dies gilt besonders für die serbischen Kräfte, die an der Belagerung Sarajewos beteiligt waren. Die bizarrsten dabei sind vielleicht die Fälle jener Gastarbeiter im Westen, die an den Wochenenden in die Berge am Rand der Städte fuhren, um als Scharfschützen die dortigen Einwohner zu terrorisieren. (…) Man ließ sie laufen, so wie die russischen Verantwortlichen des gegenwärtigen Krieges entkommen werden, im Zeichen eines noch scheinheiligeren Weltfriedens."
Der aus der Vojvodina stammende Soziologe György Szerbhorváth fühlt sich in Élet és Irodalom durch den Ukraine-Krieg nicht nur an die Belagerung von Sarajewo vor dreißig Jahren erinnert. "Entgegen einer weit verbreiteten Meinung denke ich, dass der Krieg in der Ukraine nicht der erste nach 1945 in Europa ist. Es ist kennzeichnend für die Erinnerungskultur, dass 1956, die erste sowjetische 'besondere Militäroperation' verdrängt wird, genauso wie die Belagerung der Tschechoslowakei von 1968. Als wären sie nie passiert. Auch die südslawischen Kriege werden bemäntelt, obwohl der internationale Strafgerichtshof in Den Haag die Haupttäter zur Rechenschaft zog - die kleineren Kriegsverbrecher wurden jedoch laufen gelassen. Dies gilt besonders für die serbischen Kräfte, die an der Belagerung Sarajewos beteiligt waren. Die bizarrsten dabei sind vielleicht die Fälle jener Gastarbeiter im Westen, die an den Wochenenden in die Berge am Rand der Städte fuhren, um als Scharfschützen die dortigen Einwohner zu terrorisieren. (…) Man ließ sie laufen, so wie die russischen Verantwortlichen des gegenwärtigen Krieges entkommen werden, im Zeichen eines noch scheinheiligeren Weltfriedens."Pitchfork (USA), 31.03.2022
Kommentieren