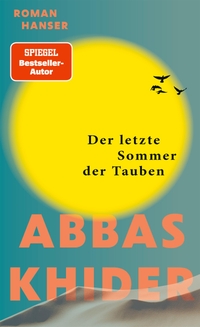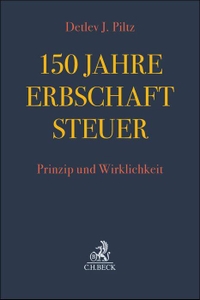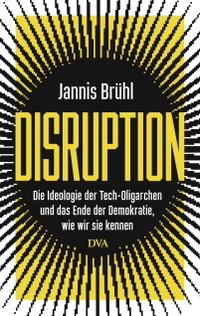Magazinrundschau
Bekenntnis zur Realität
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
21.03.2023. Prospect beschreibt die polnisch-ukrainischen Beziehungen, die nicht immer ungetrübt waren. American Scholar lauscht ihrem Tinnitus. Der New Yorker porträtiert Balenciaga-Couturier Demna Gvasalia. Hakai überprüft, ob Seetang Klima- und Hungerkrise lösen könnte. Die LRB kramt ihre Baudelaire-Anthologie hervor. Die NYT besucht traumatisierte ukrainische Soldaten im Krankenhaus. Criterion Collection erinnert an die tschechische Regisseurin Ester Krumbachóva. Granta überlegt, was normal ist.
Prospect (UK), 01.04.2023
 Über ihre Position in Europa sind sich die Polen alles andere als einig, aber an der Seite der Ukraine stehen sie wie eine eins, staunt der britische Historiker Neal Ascherson: "Tatsächlich waren die ukrainisch-polnischen Beziehungen noch nie so herzlich wie jetzt, inmitten des Krieges. Angesichts der Vergangenheit ist das ein Wunder. Ein großer Teil der Ukraine westlich des Dnjepr - und ein Großteil Weißrusslands und Litauens - wurde in den vergangenen Jahrhunderten von polnischen Großgrundbesitzern 'kolonisiert', deren Sprache, Religion und Kultur den auf ihren Ländereien arbeitenden Bauern in der Regel ziemlich fremd waren. (Ähnlich erging es den irischen Bauern unter englischer Herrschaft). Nach dem Ersten Weltkrieg, als sich der ukrainische Nationalismus herauszukristallisieren begann, wurden die westlichen Regionen der Ukraine unter heftigen Kämpfen von der neuen polnischen Republik annektiert. Im Zweiten Weltkrieg verübten ukrainische nationalistische Partisanen, die von den Nazi-Invasoren unterstützt wurden, in der Provinz Wolhynien völkermörderische Massaker an der polnischen und jüdischen Bevölkerung - Verbrechen, die erst vor kurzem, nach jahrelangem Schweigen, zugegeben und zur Versöhnung gebracht wurden. Und doch strömten während der Orangenen Revolution zwischen 2004 und 2005, als junge Ukrainer die Straßen von Kiew aus Protest gegen die ungeheuerliche politische Misswirtschaft besetzten, junge Polen zu Tausenden über die Grenze, um zu helfen, indem sie ihre rot-weißen Solidarnosc-Fahnen schwenkten - und wurden ohne ein Wort über den 'polnischen Imperialismus' ihrer Vorväter willkommen geheißen."
Über ihre Position in Europa sind sich die Polen alles andere als einig, aber an der Seite der Ukraine stehen sie wie eine eins, staunt der britische Historiker Neal Ascherson: "Tatsächlich waren die ukrainisch-polnischen Beziehungen noch nie so herzlich wie jetzt, inmitten des Krieges. Angesichts der Vergangenheit ist das ein Wunder. Ein großer Teil der Ukraine westlich des Dnjepr - und ein Großteil Weißrusslands und Litauens - wurde in den vergangenen Jahrhunderten von polnischen Großgrundbesitzern 'kolonisiert', deren Sprache, Religion und Kultur den auf ihren Ländereien arbeitenden Bauern in der Regel ziemlich fremd waren. (Ähnlich erging es den irischen Bauern unter englischer Herrschaft). Nach dem Ersten Weltkrieg, als sich der ukrainische Nationalismus herauszukristallisieren begann, wurden die westlichen Regionen der Ukraine unter heftigen Kämpfen von der neuen polnischen Republik annektiert. Im Zweiten Weltkrieg verübten ukrainische nationalistische Partisanen, die von den Nazi-Invasoren unterstützt wurden, in der Provinz Wolhynien völkermörderische Massaker an der polnischen und jüdischen Bevölkerung - Verbrechen, die erst vor kurzem, nach jahrelangem Schweigen, zugegeben und zur Versöhnung gebracht wurden. Und doch strömten während der Orangenen Revolution zwischen 2004 und 2005, als junge Ukrainer die Straßen von Kiew aus Protest gegen die ungeheuerliche politische Misswirtschaft besetzten, junge Polen zu Tausenden über die Grenze, um zu helfen, indem sie ihre rot-weißen Solidarnosc-Fahnen schwenkten - und wurden ohne ein Wort über den 'polnischen Imperialismus' ihrer Vorväter willkommen geheißen."Eurozine (Österreich), 17.03.2023
 Seitdem Nordmazedonien die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt, steht das Land zunehmend im Fokus hybrider Kriegsattacken, informiert Jovan Gjorgovski in einem aus der New Eastern Europe übernommenen Artikel. Russische Propagandisten nutzen den historischen Konflikt des Landes mit Bulgarien, um die Gesellschaft politisch zu entzweien. Das gefährdet auch den EU-Beitritt Nordmazedoniens: "Nordmazedonien ist noch kein Mitglied der Europäischen Union, und hier hat sich der bösartige Einfluss am schädlichsten ausgewirkt. Es begann mit einem Veto Bulgariens im Rat der EU, das die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen blockierte. Der Streit mit Bulgarien ist tiefgreifend und reicht bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurück, aber das Veto erwies sich als perfekte Gelegenheit für Moskau, Desinformation und Fake News einzusetzen, um Zweifel an der EU und der NATO zu säen. Ein Beispiel betrifft Feiertage und Nationalhelden. Die russische Botschaft in Skopje beging einen Feiertag und nannte ihn in den sozialen Medien 'mazedonisch', während die Botschaft in Sofia dasselbe tat, ihn aber 'bulgarisch' nannte. Ein billiger Trick, der leicht zu durchschauen ist, aber nicht für den Durchschnittsbürger, der Informationen vor allem in den sozialen Medien konsumiert und alles glauben will, was seine bestehenden Vorurteile bestätigt. In einer kürzlich vom Internationalen Republikanischen Institut in Nordmazedonien durchgeführten Umfrage ist die Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent gesunken. Serbien wird jetzt als der vielversprechendste Partner gehandelt und die EU steht an zweiter Stelle, eine drastische Veränderung gegenüber der Situation vor zwei Jahren, als Brüssel als wichtigster Partner angesehen wurde."
Seitdem Nordmazedonien die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt, steht das Land zunehmend im Fokus hybrider Kriegsattacken, informiert Jovan Gjorgovski in einem aus der New Eastern Europe übernommenen Artikel. Russische Propagandisten nutzen den historischen Konflikt des Landes mit Bulgarien, um die Gesellschaft politisch zu entzweien. Das gefährdet auch den EU-Beitritt Nordmazedoniens: "Nordmazedonien ist noch kein Mitglied der Europäischen Union, und hier hat sich der bösartige Einfluss am schädlichsten ausgewirkt. Es begann mit einem Veto Bulgariens im Rat der EU, das die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen blockierte. Der Streit mit Bulgarien ist tiefgreifend und reicht bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurück, aber das Veto erwies sich als perfekte Gelegenheit für Moskau, Desinformation und Fake News einzusetzen, um Zweifel an der EU und der NATO zu säen. Ein Beispiel betrifft Feiertage und Nationalhelden. Die russische Botschaft in Skopje beging einen Feiertag und nannte ihn in den sozialen Medien 'mazedonisch', während die Botschaft in Sofia dasselbe tat, ihn aber 'bulgarisch' nannte. Ein billiger Trick, der leicht zu durchschauen ist, aber nicht für den Durchschnittsbürger, der Informationen vor allem in den sozialen Medien konsumiert und alles glauben will, was seine bestehenden Vorurteile bestätigt. In einer kürzlich vom Internationalen Republikanischen Institut in Nordmazedonien durchgeführten Umfrage ist die Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent gesunken. Serbien wird jetzt als der vielversprechendste Partner gehandelt und die EU steht an zweiter Stelle, eine drastische Veränderung gegenüber der Situation vor zwei Jahren, als Brüssel als wichtigster Partner angesehen wurde."New Yorker (USA), 27.03.2023
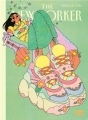 Demna Gvasalia, seit einigen Jahren Chefdesigner von Balenciaga, ist berühmt für seine überdimensionale Sportswear und seine Gimmicks, die mit der letzten Werbekampagne spektakulär in die Hose gingen. Dem Designer drohte kurz das Ende seiner Karriere, aber er scheint sich wieder gefangen zu haben und setzt jetzt auf, ähm, Nähkunst. So weit, so vorhersehbar. Trotzdem ist das Porträt, das Lauren Collins von ihm zeichnet, lesenswert, weil es einiges von seinem Hintergrund erzählt: Demna wurde in der Sowjetunion geboren, in Suchumi. Der Vater ist Georgier, die Mutter Russin. Ihren schwulen Sprössling fand die Großfamilie seltsam. "In der Schule verkürzte Demna seine Hose, so dass seine Socken zu sehen waren. Der Schulleiter warf seinen Eltern vor, kapitalistische Werte zu propagieren. Als Mitglied der Jungen Pioniere musste er ein rotes Halstuch tragen. Das ärgerte ihn: die Konformität, das Deppenhafte. In seinem 'ersten konzeptionell aktiven Akt des Modevandalismus' kritzelte er mit schwarzem Filzstift den Text eines Stücks der sowjetischen Rockband Kino, 'Blood Type', auf den Stoff. ('Meine Blutgruppe, auf meinem Ärmel / Meine Dienstnummer, auf meinem Ärmel / Wünscht mir Glück im Kampf!') Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte ein Durcheinander von Reizen. Es war schwer, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, das Verlockende vom Verächtlichen." 1992, als Demna zehn Jahre alt war, griffen abchasische Separatisten, die von Russland unterstützt wurden, Suchumi an. Die Familie floh fast 300 Meilen zu Fuß, bis ein Hubschrauber sie nach Tiflis brachte. Dort "trug Demna abgelegte Kleidung und ausrangierte Sachen. Seine Eltern sparten, indem sie ihm Kleidung kauften, die ihm mehrere Jahre lang tragen konnte. Der übergroße Look passte zu ihm, denn er verdeckte die Haare, die ihm seit seiner Jugend an den Händen wuchsen. Er trägt immer noch hauptsächlich T-Shirts und Sweatshirts, wobei er die Ärmel zu lang lässt, als Hommage an seine frühesten Anfänge der Selbstdarstellung und Selbstverteidigung. Selten hat sich jemand so intensiv mit den schützenden Aspekten der Mode auseinandergesetzt".
Demna Gvasalia, seit einigen Jahren Chefdesigner von Balenciaga, ist berühmt für seine überdimensionale Sportswear und seine Gimmicks, die mit der letzten Werbekampagne spektakulär in die Hose gingen. Dem Designer drohte kurz das Ende seiner Karriere, aber er scheint sich wieder gefangen zu haben und setzt jetzt auf, ähm, Nähkunst. So weit, so vorhersehbar. Trotzdem ist das Porträt, das Lauren Collins von ihm zeichnet, lesenswert, weil es einiges von seinem Hintergrund erzählt: Demna wurde in der Sowjetunion geboren, in Suchumi. Der Vater ist Georgier, die Mutter Russin. Ihren schwulen Sprössling fand die Großfamilie seltsam. "In der Schule verkürzte Demna seine Hose, so dass seine Socken zu sehen waren. Der Schulleiter warf seinen Eltern vor, kapitalistische Werte zu propagieren. Als Mitglied der Jungen Pioniere musste er ein rotes Halstuch tragen. Das ärgerte ihn: die Konformität, das Deppenhafte. In seinem 'ersten konzeptionell aktiven Akt des Modevandalismus' kritzelte er mit schwarzem Filzstift den Text eines Stücks der sowjetischen Rockband Kino, 'Blood Type', auf den Stoff. ('Meine Blutgruppe, auf meinem Ärmel / Meine Dienstnummer, auf meinem Ärmel / Wünscht mir Glück im Kampf!') Der Zusammenbruch der Sowjetunion brachte ein Durcheinander von Reizen. Es war schwer, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, das Verlockende vom Verächtlichen." 1992, als Demna zehn Jahre alt war, griffen abchasische Separatisten, die von Russland unterstützt wurden, Suchumi an. Die Familie floh fast 300 Meilen zu Fuß, bis ein Hubschrauber sie nach Tiflis brachte. Dort "trug Demna abgelegte Kleidung und ausrangierte Sachen. Seine Eltern sparten, indem sie ihm Kleidung kauften, die ihm mehrere Jahre lang tragen konnte. Der übergroße Look passte zu ihm, denn er verdeckte die Haare, die ihm seit seiner Jugend an den Händen wuchsen. Er trägt immer noch hauptsächlich T-Shirts und Sweatshirts, wobei er die Ärmel zu lang lässt, als Hommage an seine frühesten Anfänge der Selbstdarstellung und Selbstverteidigung. Selten hat sich jemand so intensiv mit den schützenden Aspekten der Mode auseinandergesetzt".Die Hoffnung, dass sich durch die (vermeintliche) Wunderdroge Ozempic etwas an der Wahrnehmung und Bewertung von Körpern ändert, hält Essayistin Jia Tolentino für verfrüht. Der Wirkstoff Semaglutid verspricht durch seine das Hungergefühl hemmende Wirkung zwar große Erfolge in der Behandlung von Diabetes-bedingtem chronischen Übergewicht, kann allerdings von Übelkeit bis Erschöpfung unangenehme Nebenwirkungen haben - die größte Gefahr besteht aber vielleicht in der Zweckentfremdung des Medikaments zum Erreichen eines dünnen Traumkörpers. Tolentino beschreibt eine besorgniserregende Sorglosigkeit, mit der profitorientierte Medizinunternehmen das Medikament einfach so verschreiben - und mit der völlig Normalgewichtige Risiken auf sich nehmen: "Als ich anderen Leuten von meinem Semaglutid-Vorrat erzählt habe, waren sie sehr interessiert. 'Soll ich es mal ausprobieren und dein Versuchskaninchen sein?', hat mich ein Freund gefragt. Ich habe ihn daran erinnert, dass er sowieso schon dünn ist. 'Ich bin eher schlank wie Gigi Hadid', hat er geantwortet, 'aber ich könnte so dünn sein wie Bella Hadid.' Es war scherzhaft gemeint, zumindest so halb. Ich war neugierig, ob ich auch dann ein Rezept dafür bekommen könnte, wenn ich nicht über mein Gewicht lüge. Ich habe die Website eines Telehealth-Unternehmens gefunden, das Semaglutid bewirbt und dieses Mal meine richtige Größe und mein tatsächliches Gewicht eingegeben, das einer Frau, die Größe 36 trägt. Ein Arzt hat mich am nächsten Morgen angerufen; ich habe ihm erzählt, ich hätte 2020 ein Baby bekommen und würde gerne 15 Pfund abnehmen. 'Genau für solche Fälle gibt es unser Programm', hat er behauptet. Er hat die möglichen Nebenwirkungen mit mir diskutiert - 'das einzige, das man befürchten muss, wäre eine leichte Übelkeit' - und erklärte mir, ich müsste während der Behandlung weder ärztlich begleitet werden noch Blut abgenommen bekommen. 'Es ist total harmlos, es sind doch nur Peptide', beschwichtigt er. 'Damit alles wieder ins Gleichgewicht kommt.'"
Hakai (Kanada), 20.03.2023
 Kann Seetang Klimakrise und Nahrungsmittelknappheit auf einmal lösen? Oder bringt er doch nur altbekannte Probleme mit sich? Dieser Frage geht Nicola Jones nach. Das Gewächs wird als sehr vielseitig beschrieben, soll roh wie gekocht verzehrbar sein, für die Herstellung von Bioplastik dienen und Schadstoffe filtern können, erfährt Jones, aber die Forschungsgrundlage ist dünn. Auch mögliche Risiken müssen noch besser erforscht werden: "Die Auswirkungen auf Ökosysteme können kompliziert sein. Ein dichter Algen-Wald, zum Beispiel, an einem Ort, wo vorher keiner war, kann Licht und Nährstoffe im umliegenden Areal beeinflussen - nicht unbedingt zum Guten. Der Seetang könnte theoretisch andere Organismen verdrängen. Der Anbau riesiger Mengen dieser Art in großem Maßstab könnte weitreichende negative Auswirkungen auf das Meeresklima und die Nahrungskette haben. Und der Anbau großer Mengen einer einzigen Kulturpflanze könnte eine Reihe bekannter Probleme nach sich ziehen - an Land haben sich Monokulturen, die auf hohe Gewinnspannen abzielen, bekanntermaßen als problematisch für die Artenvielfalt und die Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetterbedingungen oder Krankheiten erwiesen."
Kann Seetang Klimakrise und Nahrungsmittelknappheit auf einmal lösen? Oder bringt er doch nur altbekannte Probleme mit sich? Dieser Frage geht Nicola Jones nach. Das Gewächs wird als sehr vielseitig beschrieben, soll roh wie gekocht verzehrbar sein, für die Herstellung von Bioplastik dienen und Schadstoffe filtern können, erfährt Jones, aber die Forschungsgrundlage ist dünn. Auch mögliche Risiken müssen noch besser erforscht werden: "Die Auswirkungen auf Ökosysteme können kompliziert sein. Ein dichter Algen-Wald, zum Beispiel, an einem Ort, wo vorher keiner war, kann Licht und Nährstoffe im umliegenden Areal beeinflussen - nicht unbedingt zum Guten. Der Seetang könnte theoretisch andere Organismen verdrängen. Der Anbau riesiger Mengen dieser Art in großem Maßstab könnte weitreichende negative Auswirkungen auf das Meeresklima und die Nahrungskette haben. Und der Anbau großer Mengen einer einzigen Kulturpflanze könnte eine Reihe bekannter Probleme nach sich ziehen - an Land haben sich Monokulturen, die auf hohe Gewinnspannen abzielen, bekanntermaßen als problematisch für die Artenvielfalt und die Widerstandsfähigkeit gegen extreme Wetterbedingungen oder Krankheiten erwiesen."American Scholar (USA), 16.03.2023
 Caitriona Lally hört und riecht Gespenster: Ihr ganzes Leben begleitet die Autorin schon ein Tinnitus, der "im knochigen Amphitheater meines Schädels seine eigenen privaten Symphonien dirigiert", nach einer Covid-Infektion kommt Phantosmie hinzu, die Wahrnehmung von Gerüchen, die gar nicht wirklich da sind. Das ist Beeinträchtigung und Erweiterung der Sinneseindrücke zugleich: "Für mich ist Phantosmie das olfaktorische Äquivalent zu Tinnitus, ich höre Dinge, die nicht existieren und höre Dinge nicht, die existieren, rieche Gerüche, die nicht real sind und rieche reale Gerüche nicht - Geräusche und Gerüche heraufzubeschwören und sie entweder für echt zu halten oder zu wissen, dass sie es nicht sind und sie trotzdem zu hören und riechen und mit ihnen leben zu müssen. Mir gefällt, dass das Wort Phantom in einem medizinischen Kontext verwendet wird um diese Illusionen oder Täuschungen zu beschreiben. In meinen Ohren sind Gespenster, Geister in meiner Nase und klitzekleine Spukgestalten in meinen Augen. Diese nicht existierenden und doch so realen Phänomene haben etwas Schaurigschönes für mich."
Caitriona Lally hört und riecht Gespenster: Ihr ganzes Leben begleitet die Autorin schon ein Tinnitus, der "im knochigen Amphitheater meines Schädels seine eigenen privaten Symphonien dirigiert", nach einer Covid-Infektion kommt Phantosmie hinzu, die Wahrnehmung von Gerüchen, die gar nicht wirklich da sind. Das ist Beeinträchtigung und Erweiterung der Sinneseindrücke zugleich: "Für mich ist Phantosmie das olfaktorische Äquivalent zu Tinnitus, ich höre Dinge, die nicht existieren und höre Dinge nicht, die existieren, rieche Gerüche, die nicht real sind und rieche reale Gerüche nicht - Geräusche und Gerüche heraufzubeschwören und sie entweder für echt zu halten oder zu wissen, dass sie es nicht sind und sie trotzdem zu hören und riechen und mit ihnen leben zu müssen. Mir gefällt, dass das Wort Phantom in einem medizinischen Kontext verwendet wird um diese Illusionen oder Täuschungen zu beschreiben. In meinen Ohren sind Gespenster, Geister in meiner Nase und klitzekleine Spukgestalten in meinen Augen. Diese nicht existierenden und doch so realen Phänomene haben etwas Schaurigschönes für mich."London Review of Books (UK), 20.03.2023
 Sehr schön schreibt Ian Penman über Charles Baudelaire, dessen Poesie jeden feingeistigen Jugendlichen betört, auch wenn er - anders als der ewig junge Rimbaud - nie das Bild eines queeren Pans abgab, sondern zart, sinnlich und grob zugleich, das eines "frühgealterten Dandy mit Wasserschaden": "Seit fünfzig Jahren ist Baudelaire Teil meines Lebens. Er gehört nicht zu den Figuren, die in der Jugend wie verrückt verehrt und später als peinlich abgetan werden. Er verblasst eher wie alte Tinte und ist dann plötzlich wieder da und spricht weiter. Offensichtlich ist ein gewisses hypnotisches Stehvermögen im Spiel. In meiner Jugend gehörte er zur Pflichtlektüre. Ich sehe noch die Penguin-Anthologie von Mitte der 1970er Jahre vor mir, die ich wie einen Talisman mit mir herumtrug: parallel englische und französische Texte, auf dem Cover Carlos Schwabes Gemälde 'Spleen et Idéal'. OK, ich gestehe: Ich stand auf den Baudelaire-Mythos, obwohl ich die Poesie nie ganz verstanden habe. Ich erinnere mich, dass mich das ganze 'Oh Muse!'-Gesäusel abschreckte, das mehr Dachbodenmuff als Großstadtneon verströmte. Er wurde zum ersten Modernisten erklärt, aber er fühlte sich nicht so 'modern' an wie Rilke, Jarry oder Apollinaire. (Ganz zu schweigen von anderen Teenie-Darlings wie Charlie Parker und William Burroughs, Frank O'Hara und Andy Warhol). Er fühlte sich wie ein wahrer Dichter an, der in den Windungen von Kirche und Satan, Bösem und Schönem, Sünde und Verdammnis ringt. Was für einen mürrischen, halbkatholischen Heranwachsenden weiß Gott durchaus seinen Reiz hatte. Aber Baudelaire, der Dichter, schien eher der Ära eines Napoleons zu Pferde anzugehören als den Futuristen in Flugzeugen oder den Blues-Musikern, die den Greyhound-Bus nehmen. Erst in jüngster Zeit, dank des Chansonniers Léo Ferré (der Baudelaire-Vertonungen drei Alben gewidmet hat), macht die Poesie endlich Sinn, als etwas, das laut deklamiert wird. Liest man sie als trockenes englisches Gedicht auf dem Papier, wird sie nur schwer lebendig. Gehört als eine Störung in der Luft, ist sie verführerisch und schwindelerregend. Das wollüstige Lied eines säuerlichen Romantikers."
Sehr schön schreibt Ian Penman über Charles Baudelaire, dessen Poesie jeden feingeistigen Jugendlichen betört, auch wenn er - anders als der ewig junge Rimbaud - nie das Bild eines queeren Pans abgab, sondern zart, sinnlich und grob zugleich, das eines "frühgealterten Dandy mit Wasserschaden": "Seit fünfzig Jahren ist Baudelaire Teil meines Lebens. Er gehört nicht zu den Figuren, die in der Jugend wie verrückt verehrt und später als peinlich abgetan werden. Er verblasst eher wie alte Tinte und ist dann plötzlich wieder da und spricht weiter. Offensichtlich ist ein gewisses hypnotisches Stehvermögen im Spiel. In meiner Jugend gehörte er zur Pflichtlektüre. Ich sehe noch die Penguin-Anthologie von Mitte der 1970er Jahre vor mir, die ich wie einen Talisman mit mir herumtrug: parallel englische und französische Texte, auf dem Cover Carlos Schwabes Gemälde 'Spleen et Idéal'. OK, ich gestehe: Ich stand auf den Baudelaire-Mythos, obwohl ich die Poesie nie ganz verstanden habe. Ich erinnere mich, dass mich das ganze 'Oh Muse!'-Gesäusel abschreckte, das mehr Dachbodenmuff als Großstadtneon verströmte. Er wurde zum ersten Modernisten erklärt, aber er fühlte sich nicht so 'modern' an wie Rilke, Jarry oder Apollinaire. (Ganz zu schweigen von anderen Teenie-Darlings wie Charlie Parker und William Burroughs, Frank O'Hara und Andy Warhol). Er fühlte sich wie ein wahrer Dichter an, der in den Windungen von Kirche und Satan, Bösem und Schönem, Sünde und Verdammnis ringt. Was für einen mürrischen, halbkatholischen Heranwachsenden weiß Gott durchaus seinen Reiz hatte. Aber Baudelaire, der Dichter, schien eher der Ära eines Napoleons zu Pferde anzugehören als den Futuristen in Flugzeugen oder den Blues-Musikern, die den Greyhound-Bus nehmen. Erst in jüngster Zeit, dank des Chansonniers Léo Ferré (der Baudelaire-Vertonungen drei Alben gewidmet hat), macht die Poesie endlich Sinn, als etwas, das laut deklamiert wird. Liest man sie als trockenes englisches Gedicht auf dem Papier, wird sie nur schwer lebendig. Gehört als eine Störung in der Luft, ist sie verführerisch und schwindelerregend. Das wollüstige Lied eines säuerlichen Romantikers."Und hier kann man Ferré hören:
MIT Press Reader (USA), 20.03.2023
 Der Optimierungsdrang macht auch vor Müttern nicht Halt - und die zunehmenden Möglichkeiten der modernen Medizin tragen ihren Teil dazu bei, meinen Jessica Clements und Kari Nixon in der MIT Press. Wenn eine Schwangere trotz aller bekannten Risiken dennoch krank wird, war sie wohl nicht aufmerksam genug, lautet manchmal das implizite moralische Urteil: "Als die theoretische Möglichkeit eines risikofreien Lebens mehr und mehr als real erschien, passierte etwas Seltsames: Die Gesellschaft wurde ängstlicher gegenüber gesundheitlichen Risiken, gerade weil sie das Gefühl hatte, sie vermeiden zu können. In anderen Worten, je näher die Fantasie vom rundum sicheren und gesunden Leben gerückt ist, desto mehr Menschen haben den Druck verspürt, immer wachsam zu bleiben und alle Risiken zu vermeiden. Wenn Krankheiten theoretisch vermeidbar sind, scheint es so, dass auch jeder alles tun müsste, eben um sie zu vermeiden. In genau dem Moment, als Krankheiten nicht mehr als unvermeidlich gesehen wurden, hat sich der neoliberale Gedanke eingeschlichen, gute, verantwortungsbewusste Menschen würden immer ein Mittel finden, solchen Risiken aus dem Weg zu gehen." Das, so die Autorinnen, trägt insbesondere für leicht zu verunsichernde Schwangere dazu bei, ein Ideal der perfekten Mutter zu schaffen, das unerreichbar bleiben muss. Was genau der Neoliberalismus damit zu tun hat, erschließt sich einem allerdings nicht.
Der Optimierungsdrang macht auch vor Müttern nicht Halt - und die zunehmenden Möglichkeiten der modernen Medizin tragen ihren Teil dazu bei, meinen Jessica Clements und Kari Nixon in der MIT Press. Wenn eine Schwangere trotz aller bekannten Risiken dennoch krank wird, war sie wohl nicht aufmerksam genug, lautet manchmal das implizite moralische Urteil: "Als die theoretische Möglichkeit eines risikofreien Lebens mehr und mehr als real erschien, passierte etwas Seltsames: Die Gesellschaft wurde ängstlicher gegenüber gesundheitlichen Risiken, gerade weil sie das Gefühl hatte, sie vermeiden zu können. In anderen Worten, je näher die Fantasie vom rundum sicheren und gesunden Leben gerückt ist, desto mehr Menschen haben den Druck verspürt, immer wachsam zu bleiben und alle Risiken zu vermeiden. Wenn Krankheiten theoretisch vermeidbar sind, scheint es so, dass auch jeder alles tun müsste, eben um sie zu vermeiden. In genau dem Moment, als Krankheiten nicht mehr als unvermeidlich gesehen wurden, hat sich der neoliberale Gedanke eingeschlichen, gute, verantwortungsbewusste Menschen würden immer ein Mittel finden, solchen Risiken aus dem Weg zu gehen." Das, so die Autorinnen, trägt insbesondere für leicht zu verunsichernde Schwangere dazu bei, ein Ideal der perfekten Mutter zu schaffen, das unerreichbar bleiben muss. Was genau der Neoliberalismus damit zu tun hat, erschließt sich einem allerdings nicht.Elet es Irodalom (Ungarn), 17.03.2023
 Mitte Januar ist der Philosoph Gáspár Miklós Tamás gestorben. Seine letzte umfangreiche Schrift mit dem Titel "Fünf Ratschläge für die Heimat" erschien kurz vor seinem Tod. Der Philosoph Simon Isztray rekapituliert Teile des Aufsatzes in der Wochenzeitschrift Élet és Irodalom: "Tamàs interpretiert den politischen Raum um. Politisches Ringen beschreibt seiner Ansicht nach heute in Ungarn nicht mehr in erster Linie Wahlkampf, sondern den Widerstand der Staatsbürger gegen den 'Zustand' in vielen kleinen Bereichen. Aus diesen Kämpfen können in einer Ausnahmesituation bedeutende Ereignisse entstehen. Aber die 'Fünf Ratschläge' sind realistisch dahingehend, dass es bei diesen Kämpfen nicht um Siege und nicht mal um Erfolge gehen kann: "Der einzig vorstellbare Ausgang ist die machtlose intellektuelle Suche nach Wahrheit, die von der dauerhaften Konfliktfähigkeit der Zivilgesellschaft abhängt… was eine übermenschliche Aufgabe ist."
Mitte Januar ist der Philosoph Gáspár Miklós Tamás gestorben. Seine letzte umfangreiche Schrift mit dem Titel "Fünf Ratschläge für die Heimat" erschien kurz vor seinem Tod. Der Philosoph Simon Isztray rekapituliert Teile des Aufsatzes in der Wochenzeitschrift Élet és Irodalom: "Tamàs interpretiert den politischen Raum um. Politisches Ringen beschreibt seiner Ansicht nach heute in Ungarn nicht mehr in erster Linie Wahlkampf, sondern den Widerstand der Staatsbürger gegen den 'Zustand' in vielen kleinen Bereichen. Aus diesen Kämpfen können in einer Ausnahmesituation bedeutende Ereignisse entstehen. Aber die 'Fünf Ratschläge' sind realistisch dahingehend, dass es bei diesen Kämpfen nicht um Siege und nicht mal um Erfolge gehen kann: "Der einzig vorstellbare Ausgang ist die machtlose intellektuelle Suche nach Wahrheit, die von der dauerhaften Konfliktfähigkeit der Zivilgesellschaft abhängt… was eine übermenschliche Aufgabe ist."Granta (UK), 01.03.2023
 Der britische Regisseur Richard Eyre denkt, auch mit Blick auf seine eigene Familie, darüber nach, was "normale" Menschen sind. Sein Großvater Charles Royds zum Beispiel war Mitglied der Antarktis-Expedition von Scott 1901-1904. In seinen Tagebüchern "stellt er weder sich selbst noch seine Kollegen als Männer ohne Angst oder ohne Sinn für Gefahr dar. Für ihn liegt das Wunder - wenn es ein Wunder gibt - in ihrer Alltäglichkeit: '-53°C, das nenne ich ziemlich kühl!!! Man kann sich das Lachen nicht verkneifen, wenn man an Halsschmerzen und Erkältung in England denkt und daran, dass man sich nicht traut, seine Nase im Freien zu zeigen... Der Winter kann nicht nur Freude und Behaglichkeit bringen, niemand kann das erwarten, aber mit Hilfe von ein wenig Selbstverleugnung, ein wenig Taktgefühl und einem fröhlichen Gesicht kann man die meiste Monotonie und Unannehmlichkeit überwinden. Wir werden uns wie normale Menschen verhalten.' Ich wundere mich darüber. Ist es Mut? Ist es Stoizismus? Ist es absichtlicher Mangel an Vorstellungskraft?"
Der britische Regisseur Richard Eyre denkt, auch mit Blick auf seine eigene Familie, darüber nach, was "normale" Menschen sind. Sein Großvater Charles Royds zum Beispiel war Mitglied der Antarktis-Expedition von Scott 1901-1904. In seinen Tagebüchern "stellt er weder sich selbst noch seine Kollegen als Männer ohne Angst oder ohne Sinn für Gefahr dar. Für ihn liegt das Wunder - wenn es ein Wunder gibt - in ihrer Alltäglichkeit: '-53°C, das nenne ich ziemlich kühl!!! Man kann sich das Lachen nicht verkneifen, wenn man an Halsschmerzen und Erkältung in England denkt und daran, dass man sich nicht traut, seine Nase im Freien zu zeigen... Der Winter kann nicht nur Freude und Behaglichkeit bringen, niemand kann das erwarten, aber mit Hilfe von ein wenig Selbstverleugnung, ein wenig Taktgefühl und einem fröhlichen Gesicht kann man die meiste Monotonie und Unannehmlichkeit überwinden. Wir werden uns wie normale Menschen verhalten.' Ich wundere mich darüber. Ist es Mut? Ist es Stoizismus? Ist es absichtlicher Mangel an Vorstellungskraft?"Criterion Collection (USA), 10.03.2023
The Critic (UK), 12.03.2023
Tablet (USA), 20.03.2023
Info (Tschechien), 18.03.2023
Marek Kerles erinnert an die wenig bekannte Tatsache, dass die tschechoslowakischen Deutschen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918-1938) das Recht hatten, bei offiziellen Anlässen die Nationalhymne "Kde domov můj" auf Deutsch zu singen. "Bis heute streiten Historiker darüber, ob Hitlers Expansion [die Besetzung der Sudetengebiete und anschließend des ganzen Landes] hätte verhindert werden können, wenn die Tschechoslowakei der zahlreichen deutschen Minderheit stärker entgegengekommen wäre, deren Klagen über die Unterdrückung ihrer Rechte ein wichtiges Instrument von Hitlers Expansionspolitik wurden." Viele Deutsche in den Sudeten und andernorts störte zum Beispiel, dass alle Beamten eine Prüfung in der tschechischen Amtssprache ablegen mussten, und dies auch in rein deutsch bewohnten Gebieten. Auch in anderen Bereichen habe sich die deutsche Minderheit unterdrückt gefühlt. Gerade das Beispiel der deutschen Hymnenfassung "Wo ist mein Heim, mein Vaterland" zeige jedoch, dass sich die Staatsverwaltung nach dem Zerfall der Monarchie mit konkreten Schritten darum bemühte, dass auch die Deutschtschechen sich mit dem neuen Staat identifizierten und ihn als den ihren ansahen. Laut dem Historiker Petr Koura vom Collegium Bohemicum wählte das tschechoslowakische Schulministerium bereits 1918 die offizielle Übersetzung der Nationalhymne aus, die dann auch an den deutschsprachigen Schulen in den Lehrbüchern und im Unterricht gelehrt wurde.
New York Times (USA), 19.03.2023
 Ellen Barry besucht ein Krankenhaus für psychisch traumatisierte Soldaten in Kiew. Nach 200 Tagen oder so, schreibt sie, braucht eigentlich jeder hier einen Aufenthalt. 70 Prozent der Soldaten werden an die Front zurückgeschickt. Die anderen haben sich nicht schnell genug erholt. Barry erzählt eigentlich nur die Geschichten der Soldaten, und man ist nicht froher, wenn man ihren Text zu Ende gelesen hat. "Viele beschreiben ein Gefühl der Fremdheit, sogar in der Familie. Valeriy, der vor dem Krieg Bauarbeiter war, sagt: 'Manchmal spricht meine Frau mit mir, und dann merkt sie es. Sie sagt: 'Hast du gehört, was ich gesagt habe?' Ja, manchmal hört er sie nicht. Seine Gedanken drehen sich unablässig um eine Achse, um etwas, das an der Front passiert ist: sein ganzes Team, seine Kameraden sind in einem Panzer verbrannt. Er erinnert sich an ihre Namen, ihre Heimatstädte, an ihre Positionen, die Namen ihrer Ehefrauen. 'Valeriy erinnert sich, dass er einem von ihnen in einem Gespräch kurz vor dem Schlafengehen versprach, ihm bei der Reparatur seines Daches zu helfen. 'Unsere Betten standen nebeneinander, und dann war er weg', sagt er. Die Leichen sind noch nicht vom Brandherd geborgen, und diese Tatsache nagt an ihm. Eine andere Sache nagt auch an ihm: Eine Frau fragte, wie ihr Mann gestorben sei, und er konnte es ihr nicht sagen." Die Fotos der Reportage sind von Antoine d'Agata.
Ellen Barry besucht ein Krankenhaus für psychisch traumatisierte Soldaten in Kiew. Nach 200 Tagen oder so, schreibt sie, braucht eigentlich jeder hier einen Aufenthalt. 70 Prozent der Soldaten werden an die Front zurückgeschickt. Die anderen haben sich nicht schnell genug erholt. Barry erzählt eigentlich nur die Geschichten der Soldaten, und man ist nicht froher, wenn man ihren Text zu Ende gelesen hat. "Viele beschreiben ein Gefühl der Fremdheit, sogar in der Familie. Valeriy, der vor dem Krieg Bauarbeiter war, sagt: 'Manchmal spricht meine Frau mit mir, und dann merkt sie es. Sie sagt: 'Hast du gehört, was ich gesagt habe?' Ja, manchmal hört er sie nicht. Seine Gedanken drehen sich unablässig um eine Achse, um etwas, das an der Front passiert ist: sein ganzes Team, seine Kameraden sind in einem Panzer verbrannt. Er erinnert sich an ihre Namen, ihre Heimatstädte, an ihre Positionen, die Namen ihrer Ehefrauen. 'Valeriy erinnert sich, dass er einem von ihnen in einem Gespräch kurz vor dem Schlafengehen versprach, ihm bei der Reparatur seines Daches zu helfen. 'Unsere Betten standen nebeneinander, und dann war er weg', sagt er. Die Leichen sind noch nicht vom Brandherd geborgen, und diese Tatsache nagt an ihm. Eine andere Sache nagt auch an ihm: Eine Frau fragte, wie ihr Mann gestorben sei, und er konnte es ihr nicht sagen." Die Fotos der Reportage sind von Antoine d'Agata.
Kommentieren