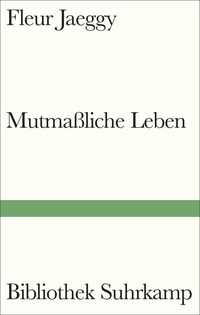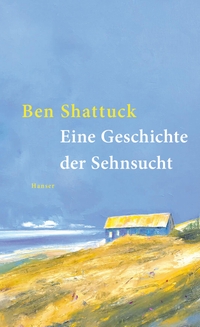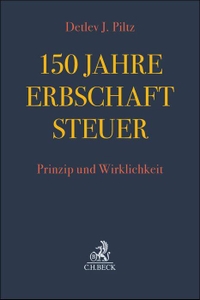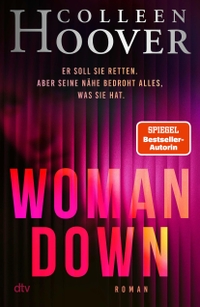Magazinrundschau
Rhetorik ist wichtig
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
16.06.2020. Der New Yorker lernt von David G. Marwell und Götz Aly, wie die Nazis sich ein alternatives Universum mit eigener Wissenschaft und Akademia erschufen. Die LRB denkt am Beispiel von Nazi-Deutschland und den USA über Kompensation für Unrecht nach. En attendant Nadeau erzählt von einem ganz speziellen 1968 in Polen. In Dalit Camera denkt Arundhati Roy über Rassismus nach. In Magyar Narancs weiß die Lyrikerin Orsolya Karafiáth: die Mehrheit steht nicht hinter den Mutigen.
New Yorker (USA), 22.06.2020
 Für die aktuelle Nummer des Magazins stellt Adam Gopnik zwei Bücher vor über das Böse und wie es entsteht (David G. Marwells "Mengele" und Götz Alys "Europa gegen die Juden: 1880-1945") und versucht der Analyse des Nazismus in dieser Hinsicht Erkenntnis abzugewinnen: "Die Nazi-Intelligenzija glaubte wirklich an ihr Tun. Eine obsessive Lehre und eine spezielle Sprache der rassischen Differenz brachte ein intellektuelles Arsenal hervor, das vor jeglicher Verifizierung geschützt war. Man erschuf ein alternatives Universum mit eigener Wissenschaft und Akademia, um sicherzugehen, dass jeder, der daran teilnahm, sein Tun als normal begreifen konnte und sich selbst als Wissenschaftler, der Wissenschaft betreibt. Diese sich selbst abschottende intellektuelle Ganzheit unterschied die Nazis von den kommerzorientierten Konservativen, mit denen sie paktierten. Mengeles Karriere gemahnt daran, dass der Nazismus keine Form des rohen Kapitalismus war, wie die Linke lange behauptete, sondern purer Irrsinn im weißen Kittel - vom Glauben und leidenschaftlichen Ideen befeuert wie viele historische Bewegungen, nicht von nachvollziehbaren Interessen … Zu erkennen ist, wie eng die Auslöschung der Juden mit dem Hass auf den Kosmopolitismus zusammenhängt. Obgleich viele der ermordeten Juden arme religiöse Bauern und Händler aus Osteuropa waren, waren der Hauptfeind, so wie Mengele es sah, stets die gebildeten Juden Westeuropas. Als ein SS-Arzt sich fragte, warum all die armen osteuropäischen Juden getötet wurden, erinnerte er sich an Mengele, der erklärte, 'dass genau aus dieser Quelle die Juden neue Kraft und frisches Blut schöpften. Ohne diese armen, harmlosen Juden wäre der westeuropäische Jude nicht überlebensfähig. Daher ist es nötig, sie alle zu vernichten.' Die Masse der armen religiösen Juden in Polen wurde fast zufällig Teil des Schlachtens, das tatsächliche Ziel war die Elite, die den Bazillus des Kosmopolitismus mit sich brachte."
Für die aktuelle Nummer des Magazins stellt Adam Gopnik zwei Bücher vor über das Böse und wie es entsteht (David G. Marwells "Mengele" und Götz Alys "Europa gegen die Juden: 1880-1945") und versucht der Analyse des Nazismus in dieser Hinsicht Erkenntnis abzugewinnen: "Die Nazi-Intelligenzija glaubte wirklich an ihr Tun. Eine obsessive Lehre und eine spezielle Sprache der rassischen Differenz brachte ein intellektuelles Arsenal hervor, das vor jeglicher Verifizierung geschützt war. Man erschuf ein alternatives Universum mit eigener Wissenschaft und Akademia, um sicherzugehen, dass jeder, der daran teilnahm, sein Tun als normal begreifen konnte und sich selbst als Wissenschaftler, der Wissenschaft betreibt. Diese sich selbst abschottende intellektuelle Ganzheit unterschied die Nazis von den kommerzorientierten Konservativen, mit denen sie paktierten. Mengeles Karriere gemahnt daran, dass der Nazismus keine Form des rohen Kapitalismus war, wie die Linke lange behauptete, sondern purer Irrsinn im weißen Kittel - vom Glauben und leidenschaftlichen Ideen befeuert wie viele historische Bewegungen, nicht von nachvollziehbaren Interessen … Zu erkennen ist, wie eng die Auslöschung der Juden mit dem Hass auf den Kosmopolitismus zusammenhängt. Obgleich viele der ermordeten Juden arme religiöse Bauern und Händler aus Osteuropa waren, waren der Hauptfeind, so wie Mengele es sah, stets die gebildeten Juden Westeuropas. Als ein SS-Arzt sich fragte, warum all die armen osteuropäischen Juden getötet wurden, erinnerte er sich an Mengele, der erklärte, 'dass genau aus dieser Quelle die Juden neue Kraft und frisches Blut schöpften. Ohne diese armen, harmlosen Juden wäre der westeuropäische Jude nicht überlebensfähig. Daher ist es nötig, sie alle zu vernichten.' Die Masse der armen religiösen Juden in Polen wurde fast zufällig Teil des Schlachtens, das tatsächliche Ziel war die Elite, die den Bazillus des Kosmopolitismus mit sich brachte."Außerdem: Luke Mogelson berichtet, wie sich Minneapolis unter dem Eindruck der jüngsten Demonstrationen gegen Rassismus verändert. Jill Lepore kritisiert all die Ausschüsse und ihre Berichte, die über die Jahrzehnte den Rassismus dokumentiert und doch nichts verändert haben. Rachel Aviv schickt eine Reportage aus amerikanischen Gefängnissen, wo Corona fast ungehindert wüten kann. Sarah Resnick stellt die Autorin Brit Bennett vor. Paul Elie fragt, wie rassistisch die Autorin Flannery O'Connor war. Jennifer Homans begutachtet den Tanz in Zeiten von Corona. Und Anthony Lane sah Spike Lees Netflix-Drama "Da 5 Bloods".
London Review of Books (UK), 18.06.2020
 Sollten sich die Amerikaner an den Deutschen in Sachen Vergangenheitsbewältigung ein Beispiel nehmen? Thomas Laqueur, selbst ein Kind aus der deutsch-jüdischen Diaspora, liest Susan Neimans entsprechenden Aufruf "Von den Deutschen lernen" mit großer Skepsis. Zum einen findet er die deutsche Wiedergutmachung gegenüber Juden und Israelkleinlicher und zögerlicher, als Neiman es darstellt. Aber selbst wenn es um Straßenumbenennung oder Denkmalsturz geht, scheint ihm die Aufgabe, das an Schwarzen begangene Unrecht zu kompensieren, eigentlich unmöglich: "Die Nazizeit war kurz und klar begrenzt. Der Weg zur deutschen Erlösung zeichnete sich schnell ab: Gesteht eure Sünden und bereut, leistet Wiedergutmachung und gelobt Besserung. Die Vergangenheit der USA aufzuarbeiten ist zeitlich eine andere Angelegenheit. Als Problem stellt sich die gesamte nationale Geschichte dar: Vor vierhundert Jahren kamen afrikanische Sklaven an diese Küsten, vor hundertfünfzig Jahre sprach der 13. Verfassungszusatz schwarze Amerikanern die vollen Bürgerrechten zu, vor sechzig Jahren erst endete das langlebigste, rechtlich abgestützte Rassistenregime der Weltgeschichte, dank Gerichtsurteilen und Gesetzgebung in den sechziger Jahren. Diese Geschichte verlangt von uns nicht nur, wie im deutschen Fall, zu erklären, wie wir einer Ideologie des Bösen erliegen konnten, sondern warum es so schwierig gewesen ist, das zu tun, was Lincoln in Gettysburg erhoffte: uns selbst dem Grundsatz zu verpflichten, dass alle Menschen gleich geschaffen sind ... Deutschlands unbestreitbare Niederlage im Zweiten Weltkrieg war grundlegend für seinen Versuch, mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Auch der amerikanische Süden verlor seinen Krieg. Aber er gewann den Frieden, in Folge seiner eigenen Anstrengungen, aber auch mit Zustimmung oder aus Indifferenz des restlichen Landes. Sein Sieg zeigte sich 1896, als der Supreme Court im Fall Plessy vs. Ferguson entschied, die Segregation unter dem Schlagwort 'Seperate but equal' zuzulassen."
Sollten sich die Amerikaner an den Deutschen in Sachen Vergangenheitsbewältigung ein Beispiel nehmen? Thomas Laqueur, selbst ein Kind aus der deutsch-jüdischen Diaspora, liest Susan Neimans entsprechenden Aufruf "Von den Deutschen lernen" mit großer Skepsis. Zum einen findet er die deutsche Wiedergutmachung gegenüber Juden und Israelkleinlicher und zögerlicher, als Neiman es darstellt. Aber selbst wenn es um Straßenumbenennung oder Denkmalsturz geht, scheint ihm die Aufgabe, das an Schwarzen begangene Unrecht zu kompensieren, eigentlich unmöglich: "Die Nazizeit war kurz und klar begrenzt. Der Weg zur deutschen Erlösung zeichnete sich schnell ab: Gesteht eure Sünden und bereut, leistet Wiedergutmachung und gelobt Besserung. Die Vergangenheit der USA aufzuarbeiten ist zeitlich eine andere Angelegenheit. Als Problem stellt sich die gesamte nationale Geschichte dar: Vor vierhundert Jahren kamen afrikanische Sklaven an diese Küsten, vor hundertfünfzig Jahre sprach der 13. Verfassungszusatz schwarze Amerikanern die vollen Bürgerrechten zu, vor sechzig Jahren erst endete das langlebigste, rechtlich abgestützte Rassistenregime der Weltgeschichte, dank Gerichtsurteilen und Gesetzgebung in den sechziger Jahren. Diese Geschichte verlangt von uns nicht nur, wie im deutschen Fall, zu erklären, wie wir einer Ideologie des Bösen erliegen konnten, sondern warum es so schwierig gewesen ist, das zu tun, was Lincoln in Gettysburg erhoffte: uns selbst dem Grundsatz zu verpflichten, dass alle Menschen gleich geschaffen sind ... Deutschlands unbestreitbare Niederlage im Zweiten Weltkrieg war grundlegend für seinen Versuch, mit seiner Vergangenheit ins Reine zu kommen. Auch der amerikanische Süden verlor seinen Krieg. Aber er gewann den Frieden, in Folge seiner eigenen Anstrengungen, aber auch mit Zustimmung oder aus Indifferenz des restlichen Landes. Sein Sieg zeigte sich 1896, als der Supreme Court im Fall Plessy vs. Ferguson entschied, die Segregation unter dem Schlagwort 'Seperate but equal' zuzulassen."Im Aufbegehren gegen Rassismus und Polizeigewalt sieht Adam Shatz - bei aller Sympathie - eher eine Welle des Protestes als eine neue Bewegung: "Die Proteste bieten einen unausgereiften Mix aus Marxismus, Antikolonialismus, Black-Power-Rhetorik, intersektionalem Feminismus, radikaler Achtsamkeit und (das ist schließlich Amerika) Anrufugungen von Jesus und anderen Propheten. Es ist eine Zeit des Handelns, und die Demonstranten arebiten ihre Ideen und Pläne auf den Straßen aus, ohne die charismatische Führer, die in den fünfziger und sechziger Jahren die Kämpfe der Bürgerrechtsbewegung prägten. Diese anfängliche Stärke kann sich, wie in der arabischen Revolte zu einer Schwäche wandeln kann."
En attendant Nadeau (Frankreich), 15.06.2020
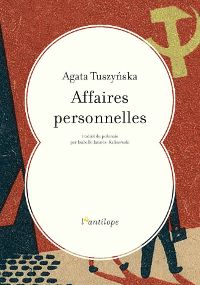 Agata Tuszynska erzählt in "Affaires personnelles", in einem "Stimmenchor" - so der Rezensent Norbert Czarny - das polnische 1968, das sehr sehr anders ist als das Pariser 1968 und noch mal völlig anders als das Prager 1968. Denn es ist das Jahr, in dem das polnische Regime die Juden des Landes zur Auswanderung zwang. Zehntausende Juden verließen damals das Land. Und es waren, so Czarny, sehr häufig gerade besonders gläubige Kommunisten, die gehen mussten. Solche, die 1939 nach Osten geflohen waren und mit der Roten Armee zurückkehrten (sofern sie nicht nach Kolyma hatten weiterreisen müssen). Diese Geschichten erzählt Tuszynska aus der Perspektive der Nachgeborenen, informiert uns Czarny: "Alle, die gehen, müssen auf die polnische Nationalität verzichten. Sie werden ausgeraubt und reisen mit kleinem Gepäck. Aber viele werden sich ein neues Leben aufbauen. Sie haben etwas, woraus sie schöpfen können und ihre kostbaren Werte. Einer wird Architekt in Dänemark, der nächste Astronom in Grenoble, eine dritte lehrt Gombrowicz, Hlasko und Konwicki an der Sorbonne. In Israel ist das Leben paradoxer Weise schwieriger, denn Religion ist nicht ihre Stärke - viele Jahre später werden die sowjetischen Juden das gleiche Problem haben." Hier der Link zum Buch in den Editions de l'Antilope.
Agata Tuszynska erzählt in "Affaires personnelles", in einem "Stimmenchor" - so der Rezensent Norbert Czarny - das polnische 1968, das sehr sehr anders ist als das Pariser 1968 und noch mal völlig anders als das Prager 1968. Denn es ist das Jahr, in dem das polnische Regime die Juden des Landes zur Auswanderung zwang. Zehntausende Juden verließen damals das Land. Und es waren, so Czarny, sehr häufig gerade besonders gläubige Kommunisten, die gehen mussten. Solche, die 1939 nach Osten geflohen waren und mit der Roten Armee zurückkehrten (sofern sie nicht nach Kolyma hatten weiterreisen müssen). Diese Geschichten erzählt Tuszynska aus der Perspektive der Nachgeborenen, informiert uns Czarny: "Alle, die gehen, müssen auf die polnische Nationalität verzichten. Sie werden ausgeraubt und reisen mit kleinem Gepäck. Aber viele werden sich ein neues Leben aufbauen. Sie haben etwas, woraus sie schöpfen können und ihre kostbaren Werte. Einer wird Architekt in Dänemark, der nächste Astronom in Grenoble, eine dritte lehrt Gombrowicz, Hlasko und Konwicki an der Sorbonne. In Israel ist das Leben paradoxer Weise schwieriger, denn Religion ist nicht ihre Stärke - viele Jahre später werden die sowjetischen Juden das gleiche Problem haben." Hier der Link zum Buch in den Editions de l'Antilope.H7O (Tschechien), 11.06.2020
 Anna Maślanka und Łukasz Grzesiczak berichten über das Sterben kleiner Buchhandlungen in Polen - und engagierte Bemühungen, dem etwas entgegenzusetzen. Die Voraussetzungen sind denkbar schwierig: "Im Jahr 2019 haben 61 Prozent der Polen kein einziges Buch gelesen." Immerhin kaufen sie etwas mehr, als sie lesen: "Im gleichen Jahr haben laut Picodi 63 Prozent der Frauen und 52 Prozent der Männer im Polen wenigstens ein Buch gekauft." Das geschieht allerdings zunehmend übers Internet. Da es keine Buchpreisbindung gibt, können die großen Buchhandelsketten und die Onlinehändler über die Mengenbestellungen den Verlagen größere Rabatte abfordern und günstigere Preise anbieten als die kleinen Buchhändler, die oft nur einzelne Exemplare in den Laden bestellen. Inzwischen gehört jede fünfte polnische Buchhandlung zu einer der großen Ketten. Die Kulturaktivistin Anna Karczewska hat deshalb bereits verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, mit denen die unabhängigen Läden unterstützt werden sollen. "Buchhandlungen sind keine bloßen Geschäfte und Buchlager", so Karczewska, "sie sind Kulturinstitutionen, Orte der Begegnung, der Inspiration und des Gesprächs. Und oft sind es die ersten Orte, wo wir der Literatur begegnen." Ihrem Engagement ist etwa eine Karte zu verdanken, mit der man kleine Buchhandlungen finden kann, sowie der Blog "Buchreservat", auf dem sich die einzelnen Läden vorstellen. In jedem April findet außerdem das "Wochenende der kleinen Buchhandlungen" statt, mit vielen Autorenlesungen und Diskussionen, und letztes Jahr gab es erstmals im ganzen Land die "Lange Nacht der Buchhandlungen", bei der etwa dichterische Silent Discos oder eine 24-stündige gemeinsame Proust-Lektüre stattfanden. Krakau ist übrigens die einzige Stadt Polens, die sich für den Erhalt der traditionellen Buchhandlungen einsetze.
Anna Maślanka und Łukasz Grzesiczak berichten über das Sterben kleiner Buchhandlungen in Polen - und engagierte Bemühungen, dem etwas entgegenzusetzen. Die Voraussetzungen sind denkbar schwierig: "Im Jahr 2019 haben 61 Prozent der Polen kein einziges Buch gelesen." Immerhin kaufen sie etwas mehr, als sie lesen: "Im gleichen Jahr haben laut Picodi 63 Prozent der Frauen und 52 Prozent der Männer im Polen wenigstens ein Buch gekauft." Das geschieht allerdings zunehmend übers Internet. Da es keine Buchpreisbindung gibt, können die großen Buchhandelsketten und die Onlinehändler über die Mengenbestellungen den Verlagen größere Rabatte abfordern und günstigere Preise anbieten als die kleinen Buchhändler, die oft nur einzelne Exemplare in den Laden bestellen. Inzwischen gehört jede fünfte polnische Buchhandlung zu einer der großen Ketten. Die Kulturaktivistin Anna Karczewska hat deshalb bereits verschiedene Initiativen ins Leben gerufen, mit denen die unabhängigen Läden unterstützt werden sollen. "Buchhandlungen sind keine bloßen Geschäfte und Buchlager", so Karczewska, "sie sind Kulturinstitutionen, Orte der Begegnung, der Inspiration und des Gesprächs. Und oft sind es die ersten Orte, wo wir der Literatur begegnen." Ihrem Engagement ist etwa eine Karte zu verdanken, mit der man kleine Buchhandlungen finden kann, sowie der Blog "Buchreservat", auf dem sich die einzelnen Läden vorstellen. In jedem April findet außerdem das "Wochenende der kleinen Buchhandlungen" statt, mit vielen Autorenlesungen und Diskussionen, und letztes Jahr gab es erstmals im ganzen Land die "Lange Nacht der Buchhandlungen", bei der etwa dichterische Silent Discos oder eine 24-stündige gemeinsame Proust-Lektüre stattfanden. Krakau ist übrigens die einzige Stadt Polens, die sich für den Erhalt der traditionellen Buchhandlungen einsetze.Dalit Camera (Indien), 15.06.2020
 Arundhati Roy vergleicht im Interview die Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA, die der Tod George Floyds ausgelöst hat, mit Indien, wo ständig Menschen - vor allem Muslime und Dalit - Opfer von Polizeigewalt werden. Doch wären solche Demonstationen gegen Rassismus oder das Kastensystem undenkbar, vom Schleifen von Denkmälern ganz zu schweigen, meint Roy. Den Hashtag #dalitlivesmatter empfindet sie nicht als unrechtmäßige Aneignung: "Ich denke, es ist ein Versuch, sich zu solidarisieren und etwas vom Licht der 'Black Lives Matter'-Bewegung zu suchen, die allein durch die Tatsache, dass sie in den USA stattfindet, mächtiger und sichtbarer ist als jede andere. In Indien lag das Kastenwesen lange unter dem Radar der internationalen Aufmerksamkeit - eine Form des Nichtsehens, an der selbst die bekanntesten und angesehensten Intellektuellen und Akademiker mitgewirkt haben. Davon abgesehen - niemand steht über Rassismus. Er nimmt an verschiedenen Orten unterschiedliche Formen an. In Südafrika zum Beispiel gibt es Fremdenfeindlichkeit von schwarzen Südafrikanern gegenüber Nigerianern und Afrikanern aus anderen afrikanischen Ländern. Und wie wir wissen, wird die Kastenunterdrückung, der Brahmanismus, von jeder Kaste praktiziert, die die Kaste unter ihr unterdrückt, das geht die ganze Leiter hinunter, sogar noch innerhalb der politischen Kategorie der 'Dalit', wie Sie selbst in Ihren eigenen Kämpfen erlebt haben. Wenn man etwas lange genug anstarrt, wird es sich immer als komplizierter erweisen als die Rhetorik, die es umgibt. Aber die Rhetorik ist wichtig. Sie bietet den Menschen einen Rahmen, in dem sie ihre Gedanken organisieren können."
Arundhati Roy vergleicht im Interview die Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA, die der Tod George Floyds ausgelöst hat, mit Indien, wo ständig Menschen - vor allem Muslime und Dalit - Opfer von Polizeigewalt werden. Doch wären solche Demonstationen gegen Rassismus oder das Kastensystem undenkbar, vom Schleifen von Denkmälern ganz zu schweigen, meint Roy. Den Hashtag #dalitlivesmatter empfindet sie nicht als unrechtmäßige Aneignung: "Ich denke, es ist ein Versuch, sich zu solidarisieren und etwas vom Licht der 'Black Lives Matter'-Bewegung zu suchen, die allein durch die Tatsache, dass sie in den USA stattfindet, mächtiger und sichtbarer ist als jede andere. In Indien lag das Kastenwesen lange unter dem Radar der internationalen Aufmerksamkeit - eine Form des Nichtsehens, an der selbst die bekanntesten und angesehensten Intellektuellen und Akademiker mitgewirkt haben. Davon abgesehen - niemand steht über Rassismus. Er nimmt an verschiedenen Orten unterschiedliche Formen an. In Südafrika zum Beispiel gibt es Fremdenfeindlichkeit von schwarzen Südafrikanern gegenüber Nigerianern und Afrikanern aus anderen afrikanischen Ländern. Und wie wir wissen, wird die Kastenunterdrückung, der Brahmanismus, von jeder Kaste praktiziert, die die Kaste unter ihr unterdrückt, das geht die ganze Leiter hinunter, sogar noch innerhalb der politischen Kategorie der 'Dalit', wie Sie selbst in Ihren eigenen Kämpfen erlebt haben. Wenn man etwas lange genug anstarrt, wird es sich immer als komplizierter erweisen als die Rhetorik, die es umgibt. Aber die Rhetorik ist wichtig. Sie bietet den Menschen einen Rahmen, in dem sie ihre Gedanken organisieren können."Magyar Narancs (Ungarn), 14.05.2020
 Der Theaterregisseur Róbert Alföldi unterhält sich mit der Lyrikerin Orsolya Karafiáth u.a. über die sich in Krisenzeiten ändernde Haltung vieler ehemals kritischen Künstler gegenüber der Macht: "Die existentielle Unsicherheit hat jetzt auch jene erreicht, die bisher erfolgreich ihren Kopf über Wasser hielten", sagt Karafiáth. "Wir sprechen viel von persönlicher Verantwortung, doch auch hier fehlen wie so oft die Abstufungen. Und nein, die Mehrheit steht nicht hinter den Mutigen. Wer sich nicht hinlegt, der muss erleben, dass er langsam als einziger seinen Mund aufmacht und die Anderen - die sich leise ihre Unterstützung sichern - in der Öffentlichkeit stumm bleiben. Die existentielle Angst ist eine sehr ernste Angelegenheit, doch ich habe ein größeres Problem mit jenen, die es nicht nötig haben und sich trotzdem ergeben. Selbstzensur und Vorsicht. 'Spring nicht herum, lerne unter solchen Umständen zu funktionieren' - das haben sie gelernt, das kennen sie, in dieser Welt sind die meisten von ihnen zu Hause. Der Ungar hat schon immer einen Retter gebraucht!"
Der Theaterregisseur Róbert Alföldi unterhält sich mit der Lyrikerin Orsolya Karafiáth u.a. über die sich in Krisenzeiten ändernde Haltung vieler ehemals kritischen Künstler gegenüber der Macht: "Die existentielle Unsicherheit hat jetzt auch jene erreicht, die bisher erfolgreich ihren Kopf über Wasser hielten", sagt Karafiáth. "Wir sprechen viel von persönlicher Verantwortung, doch auch hier fehlen wie so oft die Abstufungen. Und nein, die Mehrheit steht nicht hinter den Mutigen. Wer sich nicht hinlegt, der muss erleben, dass er langsam als einziger seinen Mund aufmacht und die Anderen - die sich leise ihre Unterstützung sichern - in der Öffentlichkeit stumm bleiben. Die existentielle Angst ist eine sehr ernste Angelegenheit, doch ich habe ein größeres Problem mit jenen, die es nicht nötig haben und sich trotzdem ergeben. Selbstzensur und Vorsicht. 'Spring nicht herum, lerne unter solchen Umständen zu funktionieren' - das haben sie gelernt, das kennen sie, in dieser Welt sind die meisten von ihnen zu Hause. Der Ungar hat schon immer einen Retter gebraucht!"Public Domain Review (UK), 11.06.2020

Paula Findlen erzählt die Geschichte des italienischen Dichters Francesco Petrarca, passionierter Briefeschreiber, Chronist seiner Zeit, Freund von Boccaccio und vor allem Zeitzeuge zahlreicher Pestwellen, die er schreibend - und oft geprägt vom Verlust von Freunden - begleitete. Nicht nur den Wert der Freundschaft definierte er in seinen melancholischen, von Trauer geprägten Briefen neu, sondern holte auch zur Kritik an Quacksalbern aus: "Während der zweiten Pandemie hob Petrarca zu einer geharnischten Kritik an den Astrologen an und welche Rolle sie dabei spielten, die Rückkehr der Seuche und deren Verlauf zu deuten. Den Wahrheitsstatus, den diese für ihre Darlegungen in Anspruch nahmen, wies er als Produkt des Zufalls aus: 'Warum täuscht ihr sinnlose Prophezeiungen vor, nachdem sich etwas ereignet hat, oder gebt Eure Glückserfolge als Wahrheiten aus?' Er strafte Freunde und Gönner dafür ab, wenn sie in ihren Horoskopen nachschlugen, die er für falsche Wissenschaft aus, die astronomische Daten missbrauchte. ... Petrarca war nicht der einzige, der darauf hinwies, dass die Schlüsse der Astrologen auf keinerlei astronomischer Datengrundlage und auch nicht auf der tatsächlichen Verbreitung der Krankheit beruhten. Sie boten auf den Marktplätzen falsche Hoffnungen und trügerische Gewissheiten feil. Petrarca suchte vernünftigeren Antworten auf die Pandemie, die auf tauglichere Instrumente zurückgriff als die Wissenschaft von den Sternen. Was war also von der Medizin zu halten? Petrarca war berüchtigt für seine Skepsis gegenüber Ärzten, die zu viel Gewissheit und Autorität für sich beanspruchten. Er vertrat die Ansicht, dass Mediziner, wie alle anderen auch, sich als ersten Schritt auf dem Weg zu mehr Wissen das eigene Nichtwissen eingestehen müssten."
New York Times (USA), 14.06.2020
 Ein Beitrag von Kim Tingley im neuen Heft befasst sich mit den architektonischen Implikationen der Corona-Pandemie und betrachtet letztere als Design-Problem - das der Architekten-Thinktank MIX in Yale zu lösen versucht: "Das Chaos, das Covid-19 an einst vertrauten Orten verursacht hat, macht die Überlegungen dringlich: Kann MIX sein an Menschen mit besonderen Bedürfnissen orientiertes Konzept auf eine ganz und gar neue Wirklichkeit ausweiten? Architektur soll vermitteln zwischen den aktuellen Bedürfnissen und den noch nicht bekannten Bedürfnissen der Zukunft, zwischen den unmittelbaren Bedürfnissen unseres Körpers und dem Wunsch, etwas für kommende Generationen und darüber hinaus zu schaffen … Design, das für social distancing wirbt, könnte Räume grundsätzlich gastlicher machen … Die Kairoer Architektin Magda Mostafa ist für 'Flexibilität, Beweglichkeit und Unterteilbarkeit von Räumen, aber auch Orte mit unterschiedlicher Luftzirkulation'. Ihr Design beinhaltet Notausgänge aus stark frequentierten Räumen. Hört man den Designern dabei zu, wie sie Ansätze für ein Miteinander auf Abstand beschreiben, fällt es nicht schwer zu verstehen, wie Menschen mit Autismus oder anderen besonderen Bedürfnissen, die sich im öffentlichen Raum mit Problemen konfrontiert sehen, zu kreativen Lösungen des Raum-Virus-Problems beitragen und Verbesserungen vorschlagen können, die niemandem bisher in den Sinn gekommen sind. Vielleicht inspiriert Covid ja noch andere Kollaborationen."
Ein Beitrag von Kim Tingley im neuen Heft befasst sich mit den architektonischen Implikationen der Corona-Pandemie und betrachtet letztere als Design-Problem - das der Architekten-Thinktank MIX in Yale zu lösen versucht: "Das Chaos, das Covid-19 an einst vertrauten Orten verursacht hat, macht die Überlegungen dringlich: Kann MIX sein an Menschen mit besonderen Bedürfnissen orientiertes Konzept auf eine ganz und gar neue Wirklichkeit ausweiten? Architektur soll vermitteln zwischen den aktuellen Bedürfnissen und den noch nicht bekannten Bedürfnissen der Zukunft, zwischen den unmittelbaren Bedürfnissen unseres Körpers und dem Wunsch, etwas für kommende Generationen und darüber hinaus zu schaffen … Design, das für social distancing wirbt, könnte Räume grundsätzlich gastlicher machen … Die Kairoer Architektin Magda Mostafa ist für 'Flexibilität, Beweglichkeit und Unterteilbarkeit von Räumen, aber auch Orte mit unterschiedlicher Luftzirkulation'. Ihr Design beinhaltet Notausgänge aus stark frequentierten Räumen. Hört man den Designern dabei zu, wie sie Ansätze für ein Miteinander auf Abstand beschreiben, fällt es nicht schwer zu verstehen, wie Menschen mit Autismus oder anderen besonderen Bedürfnissen, die sich im öffentlichen Raum mit Problemen konfrontiert sehen, zu kreativen Lösungen des Raum-Virus-Problems beitragen und Verbesserungen vorschlagen können, die niemandem bisher in den Sinn gekommen sind. Vielleicht inspiriert Covid ja noch andere Kollaborationen."Außerdem: Emily Bazelon überlegt, wie die amerikanische Polizei zu reformieren wäre. Steven Johnson erklärt, wie die Erhebung und Verarbeitung von Daten schon im 19. Jahrhundert im Kampf gegen Epidemien erfolgreich eingesetzt wurde. Und Clive Thompson macht sich Gedanken über das Homeoffice als neuem Standard.
Kommentieren