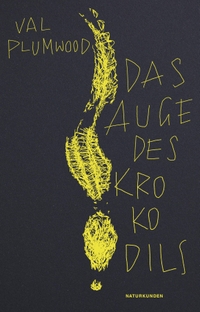Magazinrundschau
Tantrische Nerdgasmen
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
Longreads (USA), 09.04.2020
Hier Rambalacs Streifzug durchs verregnete Japan bei Nacht:
Johannesburg Review of Books (Südafrika), 10.04.2020
 In einem lebhaften, sehr persönlichen Interview mit Lebohang Mojapelo erklärt der somalische Autor Nuruddin Farah, warum er schon aus mehreren afrikanischen Ländern rausgeschmissen wurde, warum seine Bücher im südlichen Afrika kaum gelesen werden, warum sein multikultureller und multilingualer Hintergrund in Afrika stets etwas misstrauisch beäugt wird und warum Frauenrechte für ihn immer selbstverständlich waren. "Ich habe meine Bücher nie als feministisch bezeichnet. Ich kann nur sagen, dass ich genug Erfahrung damit hatte, wie die Gesellschaft mit meiner Mutter oder meinen Schwestern umging. Dass uns Männern Privilegien eingeräumt wurden, die Mädchen nie beanspruchen konnten. Wie die Schwester, die nach mir kam, in der Küche gehalten wurde, während der Junge, der nach ihr kam, sofort zur Schule geschickt wurde. Mein Vater und ich hatten einen großen Streit darüber, ob ich viel Geld für die Ausbildung meiner Schwester ausgeben würde oder nicht, mein Vater sagte: 'Gib mir das Geld, statt es für ein Mädchen auszugeben.' Nun, ich tat es nicht, nicht, weil ich Feminist war, sondern weil fair fair ist. Ist man jetzt Feminist, weil man glaubt, dass fair fair ist? Da müssten Sie jemand anders fragen." Frauen machen es in der somalischen Gesellschaft allerdings oft auch nicht besser, meint Farah: "Die Abwesenheit des Patriarchen schafft sofort Raum für eine Matriarchin, die dann dieses traditionelle Unterdrückungssystem vertritt. Ich sage Ihnen, das gesamte somalische Familiensystem ist autoritär. Die Somalier und ihre Familien sind in der Regel autoritär sind. Sie würden isoliert, rausgeschmissen, von der Religion, von der Familie exkommuniziert werden, hielten Sie sich nicht an die Linie des Clans, der Familie und des Glaubens. ... Ich komme von einem Ort, von dem aus ich die Tradition in Frage stelle. Ich komme von einem Ort, an dem ich sage, dass die Ältesten alles vermasselt haben. Ich bin eine Anomalie."
In einem lebhaften, sehr persönlichen Interview mit Lebohang Mojapelo erklärt der somalische Autor Nuruddin Farah, warum er schon aus mehreren afrikanischen Ländern rausgeschmissen wurde, warum seine Bücher im südlichen Afrika kaum gelesen werden, warum sein multikultureller und multilingualer Hintergrund in Afrika stets etwas misstrauisch beäugt wird und warum Frauenrechte für ihn immer selbstverständlich waren. "Ich habe meine Bücher nie als feministisch bezeichnet. Ich kann nur sagen, dass ich genug Erfahrung damit hatte, wie die Gesellschaft mit meiner Mutter oder meinen Schwestern umging. Dass uns Männern Privilegien eingeräumt wurden, die Mädchen nie beanspruchen konnten. Wie die Schwester, die nach mir kam, in der Küche gehalten wurde, während der Junge, der nach ihr kam, sofort zur Schule geschickt wurde. Mein Vater und ich hatten einen großen Streit darüber, ob ich viel Geld für die Ausbildung meiner Schwester ausgeben würde oder nicht, mein Vater sagte: 'Gib mir das Geld, statt es für ein Mädchen auszugeben.' Nun, ich tat es nicht, nicht, weil ich Feminist war, sondern weil fair fair ist. Ist man jetzt Feminist, weil man glaubt, dass fair fair ist? Da müssten Sie jemand anders fragen." Frauen machen es in der somalischen Gesellschaft allerdings oft auch nicht besser, meint Farah: "Die Abwesenheit des Patriarchen schafft sofort Raum für eine Matriarchin, die dann dieses traditionelle Unterdrückungssystem vertritt. Ich sage Ihnen, das gesamte somalische Familiensystem ist autoritär. Die Somalier und ihre Familien sind in der Regel autoritär sind. Sie würden isoliert, rausgeschmissen, von der Religion, von der Familie exkommuniziert werden, hielten Sie sich nicht an die Linie des Clans, der Familie und des Glaubens. ... Ich komme von einem Ort, von dem aus ich die Tradition in Frage stelle. Ich komme von einem Ort, an dem ich sage, dass die Ältesten alles vermasselt haben. Ich bin eine Anomalie."The Atlantic (USA), 14.04.2020
 Was es bedeutet, dass Indien mit dem von der Regierung Modi verabschiedeten Citizenship Amendment Act seinen Status als säkularer Staat aufgibt, hat Aatish Taseer gerade gelernt: "Indien brodelt, aber ich kann nicht in das Land zurückkehren, in dem ich aufgewachsen bin. Am 7. November hatte mir die indische Regierung die indische Übersee-Staatsbürgerschaft entzogen und mich auf die schwarze Liste des Landes gesetzt, in dem meine Mutter und meine Großmutter leben. Der Vorwand, den die Regierung benutzte, war, dass ich die pakistanische Herkunft meines Vaters verheimlicht hatte, von dem ich mich die meiste Zeit meines Lebens entfremdet war und den ich erst im Alter von 21 Jahren kennen gelernt hatte. Das war eine seltsame Anschuldigung. Ich hatte ein Buch geschrieben, 'Stranger to History', und viele Artikel über meinen abwesenden Vater veröffentlicht. Die Geschichte unserer Beziehung war gut bekannt, weil mein Vater, Salmaan Taseer, Gouverneur des Punjab in Pakistan gewesen war und 2011 von seinem Leibwächter ermordet wurde, weil er es gewagt hatte, eine christliche Frau zu verteidigen, die der Blasphemie beschuldigt wurde. All dies hatte keinen Einfluss auf meinen Status in Indien, wo ich 30 meiner 40 Jahre gelebt hatte. In den Augen der Regierung von Modi wurde ich 'Pakistani' - und, was noch wichtiger ist, 'Muslim', weil die religiöse Identität in Indien meist patrilinear und mehr eine Frage des Blutes als des Glaubens ist."
Was es bedeutet, dass Indien mit dem von der Regierung Modi verabschiedeten Citizenship Amendment Act seinen Status als säkularer Staat aufgibt, hat Aatish Taseer gerade gelernt: "Indien brodelt, aber ich kann nicht in das Land zurückkehren, in dem ich aufgewachsen bin. Am 7. November hatte mir die indische Regierung die indische Übersee-Staatsbürgerschaft entzogen und mich auf die schwarze Liste des Landes gesetzt, in dem meine Mutter und meine Großmutter leben. Der Vorwand, den die Regierung benutzte, war, dass ich die pakistanische Herkunft meines Vaters verheimlicht hatte, von dem ich mich die meiste Zeit meines Lebens entfremdet war und den ich erst im Alter von 21 Jahren kennen gelernt hatte. Das war eine seltsame Anschuldigung. Ich hatte ein Buch geschrieben, 'Stranger to History', und viele Artikel über meinen abwesenden Vater veröffentlicht. Die Geschichte unserer Beziehung war gut bekannt, weil mein Vater, Salmaan Taseer, Gouverneur des Punjab in Pakistan gewesen war und 2011 von seinem Leibwächter ermordet wurde, weil er es gewagt hatte, eine christliche Frau zu verteidigen, die der Blasphemie beschuldigt wurde. All dies hatte keinen Einfluss auf meinen Status in Indien, wo ich 30 meiner 40 Jahre gelebt hatte. In den Augen der Regierung von Modi wurde ich 'Pakistani' - und, was noch wichtiger ist, 'Muslim', weil die religiöse Identität in Indien meist patrilinear und mehr eine Frage des Blutes als des Glaubens ist."In einem anderen Artikel erklärt Kathy Gilsinan, wie wenig die WHO dazu beigetragen hat (beitragen konnte), rechtzeitig vor dem Coronavirus zu warnen: "Zu den Mitgliedern der Gruppe gehören transparente Demokratien ebenso wie autoritäre Staaten und Systeme, was bedeutet, dass die Informationen, die die WHO herausgibt, nur so gut sind wie das, was sie von Staatsführern wie Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erhält. Nordkorea zum Beispiel hat absolut keine Fälle von Coronaviren gemeldet, und die WHO ist nicht wirklich in der Lage, etwas anderes zu behaupten."
La regle du jeu (Frankreich), 13.04.2020
 Bernard-Henri Lévy erinnert an zwei Pandemien, die heute vergessen sind, die "asiatische Grippe" von 1957 und die "Hongkong-Grippe" von 1968/69, die weltweit wesentlich mehr Menschenleben kosteten als bisher Covid-19 - und dennoch keineswegs die selbe Reaktion auslösten wie heute: "Diese beiden Präzedenzfälle, die vor Ähnlichkeiten zu den heutigen Ereignissen bersten, offenbaren etwas: Das Spektakel ist entscheidend. Ein Ereignis ist nur 'historisch' und 'verändert die Welt' nur..., wenn die Medien es in ihrer Selbstbesoffenheit so entscheiden." Lévy ist zwiespältig: Einerseits zeige die Reaktion, dass die heutige Öffentlichkeit nicht bereit sei, Tausende von Toten einfach so akzeptieren und das sei "herrlich". Andererseits sieht er die Gefahr der Übertreibung: Wir müssten uns fragen, "ob der gerechte Kampf gegen die Pandemie das schwarze Loch in unseren Köpfen über die Rückkehr des Islamischen Staats im Nahen Osten, die Expansion der russischen und chinesischen Reiche oder das fatale Auseinanderdriften der EU rechtfertigt."
Bernard-Henri Lévy erinnert an zwei Pandemien, die heute vergessen sind, die "asiatische Grippe" von 1957 und die "Hongkong-Grippe" von 1968/69, die weltweit wesentlich mehr Menschenleben kosteten als bisher Covid-19 - und dennoch keineswegs die selbe Reaktion auslösten wie heute: "Diese beiden Präzedenzfälle, die vor Ähnlichkeiten zu den heutigen Ereignissen bersten, offenbaren etwas: Das Spektakel ist entscheidend. Ein Ereignis ist nur 'historisch' und 'verändert die Welt' nur..., wenn die Medien es in ihrer Selbstbesoffenheit so entscheiden." Lévy ist zwiespältig: Einerseits zeige die Reaktion, dass die heutige Öffentlichkeit nicht bereit sei, Tausende von Toten einfach so akzeptieren und das sei "herrlich". Andererseits sieht er die Gefahr der Übertreibung: Wir müssten uns fragen, "ob der gerechte Kampf gegen die Pandemie das schwarze Loch in unseren Köpfen über die Rückkehr des Islamischen Staats im Nahen Osten, die Expansion der russischen und chinesischen Reiche oder das fatale Auseinanderdriften der EU rechtfertigt."Boston Review (USA), 14.04.2020
Guardian (UK), 10.04.2020
Außerdem: Rebecca Solnit schöpft während der Coronakrise Hoffnung auf mehr Umweltbewusstsein.
iLiteratura (Tschechien), 10.04.2020
La vie des idees (Frankreich), 14.04.2020
Le Monde diplomatique (Deutschland / Frankreich), 09.04.2020
 Die Coronakrise rührt nicht nur aus der Gefährlichkeit der Krankheit Covid-19, schreiben Renaud Lambert und Pierre Rimbert, sondern hat auch mit der Ökonomisierung des Gesundheitssystems in einigen europäischen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten zu tun: "1980 gab es in Frankreich elf Krankenhausbetten pro tausend Einwohner, davon sind heute noch sechs übrig. Macrons Gesundheitsministerin hat im September 2019 vorgeschlagen, sie 'bed managers' zu überlassen, die das rare Gut zuteilen sollten. In den USA sank die Zahl von 7,9 Betten 1970 auf 2,8 im Jahr 2016. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es in Italien 1980 für 'schwere Fälle' 922 Betten pro 100.000 Einwohner. 30 Jahre später waren es nur noch 275. Überall galt nur eine Devise: Kosten senken. Das Krankenhaus sollte wie eine Autofabrik im Just-in-time-Modus funktionieren. Das Resultat ist, dass die italienische Gesellschaft für Anästhesie, Analgesie, Reanimation und Intensivtherapie (Siaarti) die Arbeit der Notärzte heute als 'Katastrophenmedizin' bezeichnet. Sie warnt, angesichts der fehlenden Ressourcen 'könnte es nötig werden, eine Altersgrenze für den Zugang zur Intensivversorgung festzulegen'. Auch im Nordosten von Frankreich spricht man mittlerweile in ähnlicher Weise von 'Kriegsmedizin'."
Die Coronakrise rührt nicht nur aus der Gefährlichkeit der Krankheit Covid-19, schreiben Renaud Lambert und Pierre Rimbert, sondern hat auch mit der Ökonomisierung des Gesundheitssystems in einigen europäischen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten zu tun: "1980 gab es in Frankreich elf Krankenhausbetten pro tausend Einwohner, davon sind heute noch sechs übrig. Macrons Gesundheitsministerin hat im September 2019 vorgeschlagen, sie 'bed managers' zu überlassen, die das rare Gut zuteilen sollten. In den USA sank die Zahl von 7,9 Betten 1970 auf 2,8 im Jahr 2016. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es in Italien 1980 für 'schwere Fälle' 922 Betten pro 100.000 Einwohner. 30 Jahre später waren es nur noch 275. Überall galt nur eine Devise: Kosten senken. Das Krankenhaus sollte wie eine Autofabrik im Just-in-time-Modus funktionieren. Das Resultat ist, dass die italienische Gesellschaft für Anästhesie, Analgesie, Reanimation und Intensivtherapie (Siaarti) die Arbeit der Notärzte heute als 'Katastrophenmedizin' bezeichnet. Sie warnt, angesichts der fehlenden Ressourcen 'könnte es nötig werden, eine Altersgrenze für den Zugang zur Intensivversorgung festzulegen'. Auch im Nordosten von Frankreich spricht man mittlerweile in ähnlicher Weise von 'Kriegsmedizin'."London Review of Books (UK), 16.04.2020
 Simone de Beauvoir hat kein vorbildliches Leben geführt, stellt Joanna Biggs fest: Ihre Abhängigkeit von Jean-Paul Sartre war geradezu pervers, fatal war die Bedenkenlosigkeit, mit der die beiden sich junge Frauen zuschoben. Am Ende wurde Beauvoir zu einer kalten, übellaunigen Trinkerin, die stets ihr Pariser Leben überhöhte, dabei schuf sie ihre größten Werke, "Das andere Geschlecht" und "Die Mandarine von Paris", während ihrer konventionellen, aber eben inspirierenden Liebesbeziehung mit Nelson Algren. Zwei neue Bücher über Beauvoir, Kate Kirkpatricks Biografie "Becoming Beauvoir" und Deirdre Bairs Memoir "Parisian Live", beschönigen nichts am Leben der französischen Autorin, und Briggs findet das ganz richtig: So befreit man Ikonen! "Der Schaden, den sie Bianca Bienefeld zugefügt hatten, war groß und andauernd, Beauvoirs Grausamkeit kann man einer Frau kaum verzeihen, die immerhin die existenzialistische Ethik begründet hatte (so weit brachte es Sartre nie) und die in all ihren Stücken, Essays und Romanen betonte, dass entscheidend im Leben Beziehungen seien, die auf Gegenseitigkeit basierten. Fast inakzetabel erscheinen mir Beauvoirs viele Beziehungen zu Menschen, die jünger und von ihr eingeschüchtert waren, die sie verriet und im Stich ließ. Was würde man über sie sagen, wenn sie ein Mann im Zeitalter von #MeToo wäre? Nathalie Sorokines Mutter zeigte sie für ihren ausschweifenden Lebenswandel an, und Beauvoir wurde 1943 von den Vichy-Behörden vom Dienst suspendiert, was ihr als Perle in der Krone der Resistance angerechnet wurde, statt als Verstoß gegen die guten Sitten. Aber nach Bianca ließ sich Beauvoir nicht mehr auf ein solches Trio ein; sie erkannte, dass sie jemandem wehgetan hatte, den sie liebte, offenbar war sie es, die dem schmuddeligen Treiben ein Ende machte."
Simone de Beauvoir hat kein vorbildliches Leben geführt, stellt Joanna Biggs fest: Ihre Abhängigkeit von Jean-Paul Sartre war geradezu pervers, fatal war die Bedenkenlosigkeit, mit der die beiden sich junge Frauen zuschoben. Am Ende wurde Beauvoir zu einer kalten, übellaunigen Trinkerin, die stets ihr Pariser Leben überhöhte, dabei schuf sie ihre größten Werke, "Das andere Geschlecht" und "Die Mandarine von Paris", während ihrer konventionellen, aber eben inspirierenden Liebesbeziehung mit Nelson Algren. Zwei neue Bücher über Beauvoir, Kate Kirkpatricks Biografie "Becoming Beauvoir" und Deirdre Bairs Memoir "Parisian Live", beschönigen nichts am Leben der französischen Autorin, und Briggs findet das ganz richtig: So befreit man Ikonen! "Der Schaden, den sie Bianca Bienefeld zugefügt hatten, war groß und andauernd, Beauvoirs Grausamkeit kann man einer Frau kaum verzeihen, die immerhin die existenzialistische Ethik begründet hatte (so weit brachte es Sartre nie) und die in all ihren Stücken, Essays und Romanen betonte, dass entscheidend im Leben Beziehungen seien, die auf Gegenseitigkeit basierten. Fast inakzetabel erscheinen mir Beauvoirs viele Beziehungen zu Menschen, die jünger und von ihr eingeschüchtert waren, die sie verriet und im Stich ließ. Was würde man über sie sagen, wenn sie ein Mann im Zeitalter von #MeToo wäre? Nathalie Sorokines Mutter zeigte sie für ihren ausschweifenden Lebenswandel an, und Beauvoir wurde 1943 von den Vichy-Behörden vom Dienst suspendiert, was ihr als Perle in der Krone der Resistance angerechnet wurde, statt als Verstoß gegen die guten Sitten. Aber nach Bianca ließ sich Beauvoir nicht mehr auf ein solches Trio ein; sie erkannte, dass sie jemandem wehgetan hatte, den sie liebte, offenbar war sie es, die dem schmuddeligen Treiben ein Ende machte." Weiteres: Adam Tooze blickt mit ungefiltertem Entsetzen auf die Weltwirtschaft: "Die Aussichten der EU sind düster, die der USA vielleicht noch übler." Skye Arundhati Thomas erklärt, dass Social Distancing in Indien für die armen Menschen schlichtweg unmöglich ist.
168 ora (Ungarn), 12.04.2020
 Nach einem kurz vor Ostern in Kraft getretenen Gesetz verlieren die in öffentlichen Kultur-, Kunst- und Bildungseinrichtungen Beschäftigten ihren Status als öffentliche Angestellte. Csaba Csóti, Vorsitzende der Gewerkschaft für die Beschäftigten im Kultursektor (SzEF), spricht im Interview mit Zsuzsa Sándor über die langfristigen Auswirkungen des Gesetzes auf die Kulturbranche. "In den Arbeitsbereichen der öffentlichen Sphäre ist Profit kein Ziel. In der Kulturszene werden wichtige öffentliche Bildungsaufträge erledigt, wozu allerding gewisse Bedingungen geschaffen werden müssen: so sollen die Institutionen für ihre Mitarbeitern langfristig Entwicklung wie professionelle Weiterbildung sicherstellen und eine Perspektive bieten. Dazu bedarf es der Kontinuität und Planbarkeit. (...) Das staatsbürgerliche Recht auf Bildung und Kultur steht auch im Grundgesetz, trotzdem dauert die Abwertung der Kultur seit Jahren an. Für die Regierung zählt die Kultur nicht als öffentliche Grundversorgung, sondern als Propagandawerkzeug."
Nach einem kurz vor Ostern in Kraft getretenen Gesetz verlieren die in öffentlichen Kultur-, Kunst- und Bildungseinrichtungen Beschäftigten ihren Status als öffentliche Angestellte. Csaba Csóti, Vorsitzende der Gewerkschaft für die Beschäftigten im Kultursektor (SzEF), spricht im Interview mit Zsuzsa Sándor über die langfristigen Auswirkungen des Gesetzes auf die Kulturbranche. "In den Arbeitsbereichen der öffentlichen Sphäre ist Profit kein Ziel. In der Kulturszene werden wichtige öffentliche Bildungsaufträge erledigt, wozu allerding gewisse Bedingungen geschaffen werden müssen: so sollen die Institutionen für ihre Mitarbeitern langfristig Entwicklung wie professionelle Weiterbildung sicherstellen und eine Perspektive bieten. Dazu bedarf es der Kontinuität und Planbarkeit. (...) Das staatsbürgerliche Recht auf Bildung und Kultur steht auch im Grundgesetz, trotzdem dauert die Abwertung der Kultur seit Jahren an. Für die Regierung zählt die Kultur nicht als öffentliche Grundversorgung, sondern als Propagandawerkzeug."New York Times (USA), 09.04.2020
 Kennen Sie noch Weird Al Yankovic? Den begnadeten Pop-Parodisten, der in den Achtzigern und Neunzigern von Michael Jackson und Madonna über Nirvana (siehe unten) bis zu Coolio mit seinem ans MAD-Heft erinnernden Humor alles aufs Korn nahm, was bei drei nicht auf den Bäumen war? In Deutschland ist es um Weird Al in den letzten Jahrzehnten ziemlich still geworden - aber in den USA zählt der unter bedrückend religiösen Einflüssen aufgewachsene Komiker mittlerweile fest zum Comedy-Kanon und hat sich selbst als Pop-Ikone einen Platz im Pantheon gesichert: In jedem der letzten vier Jahrzehnte mindestens eine Single in den Top40-Charts zu platzieren - das ist neben Weird Al jedenfalls nur denen gelungen, die zu parodieren er berühmt geworden ist. Sam Anderson hat ein tolles, sehr persönliches Feature über ihn verfasst - und beim Konzert mit seinem Idol aus Kindertagen, von dem er gelernt hat, dass auch gehänselte Außenseiter ihren Platz in der Popkultur haben, erlebt er eine Epiphanie: "Die Menge wogte durch tantrische Nerdgasmen, zurückgehaltenen Explosionen des Zusammengehörigkeitsgefühls und der Freude. Am Ende der Show, während des Chorus von 'Amish Paradise', als das ganze Stadium anfing mit den Armen im Takt zu schwingen, war ich zu meiner Überraschung den Tränen nahe. Weird Al trug einen lächerlichen schwarzen Anzug mit Zylinder und einen langen falschen Bart. Er rappte darüber, Butter zu rühren und Scheunen zu bauen und jeder sang mit. Ich spürte, wie sich in mir ganze Wogen jener Gefühle einer Einzelgänger-Kindheit - Einsamkeit, Zuneigungen, Verletzlichkeiten, Freude - kräuselten, aus mir heraus zu sickern und sich in dieses große, gemeinsame Sammelbecken zu ergießen begannen. All die Liebe, die ich privat für diese Musik immer empfunden hatte - nicht nur für Weird Als Parodien, sondern auch für die Originale - war nun da, um mich herum und wummerte durch die ganze Menge. Weird Al nutzte einen sonderbaren emotionalen Trick: Er hat all die isolierte Energie unserer winzigen Kinderzimmer in diesen großen öffentlichen Raum getragen."
Kennen Sie noch Weird Al Yankovic? Den begnadeten Pop-Parodisten, der in den Achtzigern und Neunzigern von Michael Jackson und Madonna über Nirvana (siehe unten) bis zu Coolio mit seinem ans MAD-Heft erinnernden Humor alles aufs Korn nahm, was bei drei nicht auf den Bäumen war? In Deutschland ist es um Weird Al in den letzten Jahrzehnten ziemlich still geworden - aber in den USA zählt der unter bedrückend religiösen Einflüssen aufgewachsene Komiker mittlerweile fest zum Comedy-Kanon und hat sich selbst als Pop-Ikone einen Platz im Pantheon gesichert: In jedem der letzten vier Jahrzehnte mindestens eine Single in den Top40-Charts zu platzieren - das ist neben Weird Al jedenfalls nur denen gelungen, die zu parodieren er berühmt geworden ist. Sam Anderson hat ein tolles, sehr persönliches Feature über ihn verfasst - und beim Konzert mit seinem Idol aus Kindertagen, von dem er gelernt hat, dass auch gehänselte Außenseiter ihren Platz in der Popkultur haben, erlebt er eine Epiphanie: "Die Menge wogte durch tantrische Nerdgasmen, zurückgehaltenen Explosionen des Zusammengehörigkeitsgefühls und der Freude. Am Ende der Show, während des Chorus von 'Amish Paradise', als das ganze Stadium anfing mit den Armen im Takt zu schwingen, war ich zu meiner Überraschung den Tränen nahe. Weird Al trug einen lächerlichen schwarzen Anzug mit Zylinder und einen langen falschen Bart. Er rappte darüber, Butter zu rühren und Scheunen zu bauen und jeder sang mit. Ich spürte, wie sich in mir ganze Wogen jener Gefühle einer Einzelgänger-Kindheit - Einsamkeit, Zuneigungen, Verletzlichkeiten, Freude - kräuselten, aus mir heraus zu sickern und sich in dieses große, gemeinsame Sammelbecken zu ergießen begannen. All die Liebe, die ich privat für diese Musik immer empfunden hatte - nicht nur für Weird Als Parodien, sondern auch für die Originale - war nun da, um mich herum und wummerte durch die ganze Menge. Weird Al nutzte einen sonderbaren emotionalen Trick: Er hat all die isolierte Energie unserer winzigen Kinderzimmer in diesen großen öffentlichen Raum getragen."
Ein Klassiker aus Weird Al Yankovics Schaffen: