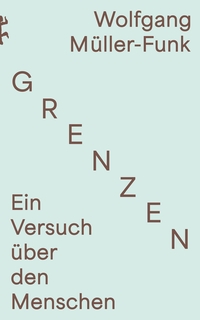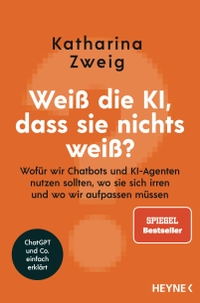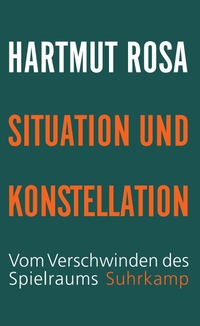Magazinrundschau
Homer der Huzulen
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
10.11.2009. In Open Democracy wünscht Neal Ascherson den Europäern etwas vom revolutionären Geist der Franzosen. Tygodnik dokumentiert, dass die polnische Dissidenten schon 1954 und auch noch in den Siebzigern auf die deutsche Wiedervereinigung hofften. In Newsweek findet Niall Ferguson 1989 welthistorisch nicht so bedeutend wie 1979. In Eurozine treibt Laszlo Borhi Österreichs Sozialdemokraten die Schamesröte ins Gesicht. Outlook India fährt nach Arunachal. Wired besucht den Henry Ford des Informationszeitalters. The New Republic pilgert zu den Bauten Peter Zumthors.
Open Democracy (UK), 09.11.2009
Neal Ascherson beschreibt sehr schön, wie sehr der Osten 1989 dem Westen voraus war: "Niemand von uns im Westen hatte verstanden, dass das ganze Imperium vom Bug bis zum Rhein kaum mehr als ein altes Wespennest war, das unter einem Dach hing - ausgetrocknet, verlassen von den stechenden Horden, kurz davor, bei einem Windhauch in Staub zu zerfallen. Aber die Leute im Osten haben es begriffen. Sie haben etwas verloren - nicht ihre Angst, sondern ihre Geduld. Auf einmal schien es unerträglich, dieses System, diese kleinen fetten Idioten in ihren blauen Anzügen auch nur für ein weiteres Jahr zu ertragen, für einen weiteren Tag, für eine Stunde. Diese spezielle Form der Ungeduld ist das Kraftwerk einer Revolution... Und es war eine richtige Revolution, allerdings fehlte ein entscheidendes Merkmal. Das Gefühl in einem Volk: 'Wir haben es einmal geschafft, und wenn uns die neue Truppe enttäuscht, werden wir es wieder schaffen!' Es ist dieses stolze, bedrohliche Selbstvertrauen, das die Französische Revolution so besonders machte. Im Europa des 21. Jahrhundert ist davon wenig zu spüren. Nach 1989 haben die Völker ihre Freiheit den Experten übergeben. Werden sie sie zurückverlangen?"
Fred Halliday erinnert daran, dass mit 1989 nicht nur mehr Freiheit in die Welt kam, sondern auch Nationalismus und Bürgerkriege, Kleptokratie und Anarchie. Zudem versammelt Open Democarcy eine Reihe europäischer Stimmen: Ivan Krastev konstatiert etwa, dass die politische Kraft von 1989 im Westen wie im Osten erschöpft ist. Adam Szostkiewicz räumt fröhlich ein: "Nach 1989 war es gar nicht mehr samten, sondern ein ganz schön rauer Ritt."
Fred Halliday erinnert daran, dass mit 1989 nicht nur mehr Freiheit in die Welt kam, sondern auch Nationalismus und Bürgerkriege, Kleptokratie und Anarchie. Zudem versammelt Open Democarcy eine Reihe europäischer Stimmen: Ivan Krastev konstatiert etwa, dass die politische Kraft von 1989 im Westen wie im Osten erschöpft ist. Adam Szostkiewicz räumt fröhlich ein: "Nach 1989 war es gar nicht mehr samten, sondern ein ganz schön rauer Ritt."
Tygodnik Powszechny (Polen), 08.11.2009
 Wojciech Pieciak weiß genau, was er am 9. November 1989 gemacht hat: Er war bei Freunden in Ostberlin, wurde sogar mit der Nachricht von der Grenzöffnung geweckt, befand sie aber für zu schön, um wahr zu sein, und schlief wieder ein. Jetzt erinnert er sich an diese Tage und Gespräche mit den Aktivisten der DDR-Opposition und analysiert: "Noch einige Wochen zuvor, im September und Oktober, glaubten sie, die gesellschaftliche Isolation überwunden zu haben. Dass, wie es in Polen neun Jahre zuvor, Arbeiter, Studenten und Intellektuelle zusammen standen, dass die Opposition endlich Unterstützung bekommt. Schließlich kamen selbst in kleineren Städten zigtausend Menschen zu Demonstrationen. Aber diese Kraft war eine Illusion; ja, sie haben etwas bewegt, aber nur, um einen Augenblick später wieder nutzlos zu sein".
Wojciech Pieciak weiß genau, was er am 9. November 1989 gemacht hat: Er war bei Freunden in Ostberlin, wurde sogar mit der Nachricht von der Grenzöffnung geweckt, befand sie aber für zu schön, um wahr zu sein, und schlief wieder ein. Jetzt erinnert er sich an diese Tage und Gespräche mit den Aktivisten der DDR-Opposition und analysiert: "Noch einige Wochen zuvor, im September und Oktober, glaubten sie, die gesellschaftliche Isolation überwunden zu haben. Dass, wie es in Polen neun Jahre zuvor, Arbeiter, Studenten und Intellektuelle zusammen standen, dass die Opposition endlich Unterstützung bekommt. Schließlich kamen selbst in kleineren Städten zigtausend Menschen zu Demonstrationen. Aber diese Kraft war eine Illusion; ja, sie haben etwas bewegt, aber nur, um einen Augenblick später wieder nutzlos zu sein". Weiter zu diesem Thema nachzulesen ist die Aufzeichnung einer Expertendiskussion zum Verhältnis von Polen und Ostdeutschen zu kommunistischen Zeiten. Unter anderem erinnert der Historiker Lukasz Kaminski daran, dass die polnische Opposition schon in den 70er Jahren die deutsche Einheit als Grundvoraussetzung für ein neues Europa ansah: "Es lohnt sich, den Hintergrund zu erforschen: Warum forderten die polnischen Oppositionellen bereits in den siebziger oder achtziger Jahren, als die Erinnerung an den Krieg noch viel lebendiger war als heute, die deutsche Einheit?" Darauf antwortet sein Kollegen Andrzej Paczkowski: "Ich glaube, einer der ersten Polen, der über die deutsche Einheit als Bedingung für die europäische Einheit geschrieben hat, war Juliusz Meiroszewski, 1954 in der Pariser Exilzeitschrift Kultura. In einem Kommentar zum Beitritt Westdeutschlands zur Nato schrieb er, dass es ohne wiedervereinigtes Deutschland kein freies Polen geben werde. Eine zweite Schlussfolgerung daraus könnte sein, dass es ohne eine unabhängige Ukraine kein freies Polen geben wird, und umgekehrt. Aber das ist ein anderes Thema."
Berichtet wird ferner vom Joseph-Conrad-Festival mit anschließender Literaturmesse in Krakau. Nachzulesen ist dazu ein Weblog von Grzegorz Nurek. In der Literaturbeilage von "Tygodnik" schreibt Krzysztof Siwczyk über Thomas Bernhards kürzlich ins Polnisch übersetzte Frühwerk "Verstörung": "Darin entwickelt sich sein Prosastil mit wiederholten Sätzen, manischen Rückgriffen auf Schlüsselwörter, fast krankhaften Steigerungen von Adjektiven, die zeigen, wie sehr er das menschliche Wesen verachtet. Schlecht, schlechter, am schlechtesten - das ist der Mensch bei Bernhard". Hingewiesen wird ferner auf das Festival des Russischen Kinos, "Sputnik", das zwei Wochen lang in 26 polnischen Städten gastieren wird.
Newsweek (USA), 16.11.2009
 War 1989 wirklich ein Jahr von welthistorischer Bedeutung? Der Historiker Niall Ferguson bezweifelt das - und nicht nur, weil er Berlin kurz vor dem 9. November verlassen hatte. "Die Ereignisse zehn Jahre vorher - 1979 - haben doch sicher einen größeren Anspruch auf historische Bedeutung. Denken Sie nur, was vor dreißig Jahren alles in der Welt passiert ist. Die Sowjets begannen ihre Politik der Selbstzerstörung, indem sie in Afghanistan einmarschierten. Die Briten gaben den Startschuss zum Revival der freien Marktwirtschaft im Westen, indem sie Margaret Thatcher wählten. Deng Xiaoping setzte China auf einen neuen ökonomischen Kurs, indem er die Vereinigten Staaten besuchte um selbst zu sehen, was ein freier Markt erreichen kann. Und die Iraner leiteten eine neue Ära des Kampfs der Kulturen ein, indem sich den Shah stürzten und eine Islamische Republik verkündeten. Dreißig Jahre später hat jedes dieser vier Ereignisse weitaus schwerwiegendere Konsequenzen für die Vereinigten Staaten und die Welt als die Ereignisse 1989."
War 1989 wirklich ein Jahr von welthistorischer Bedeutung? Der Historiker Niall Ferguson bezweifelt das - und nicht nur, weil er Berlin kurz vor dem 9. November verlassen hatte. "Die Ereignisse zehn Jahre vorher - 1979 - haben doch sicher einen größeren Anspruch auf historische Bedeutung. Denken Sie nur, was vor dreißig Jahren alles in der Welt passiert ist. Die Sowjets begannen ihre Politik der Selbstzerstörung, indem sie in Afghanistan einmarschierten. Die Briten gaben den Startschuss zum Revival der freien Marktwirtschaft im Westen, indem sie Margaret Thatcher wählten. Deng Xiaoping setzte China auf einen neuen ökonomischen Kurs, indem er die Vereinigten Staaten besuchte um selbst zu sehen, was ein freier Markt erreichen kann. Und die Iraner leiteten eine neue Ära des Kampfs der Kulturen ein, indem sich den Shah stürzten und eine Islamische Republik verkündeten. Dreißig Jahre später hat jedes dieser vier Ereignisse weitaus schwerwiegendere Konsequenzen für die Vereinigten Staaten und die Welt als die Ereignisse 1989."Eurozine (Österreich), 06.11.2009
 Der ungarische Historiker Laszlo Borhi rekapituliert, wie zögerlich und ängstlich Europa und die USA auf die Ereignisse von 1989 reagierten. Zum Beispiel die Offiziellen in Wien (die sich aber auch nicht stärker blamierten als ihre Kollegen in Bonn, Paris oder London): "Die Österreicher empfahlen eine langsame und vorhersehbare Demokratisierung. Der Staatssekretär im Außenministerium, Thomas Klestil, erkundigte sich bei bei Ungarns Außenminister Gyula Horn nach den Grenzen der Transformation und ob diese zu Spannungen mit der Sowjetunion führen könnten. Die Österreicher fürchteten die Unvorhersehbarkeiten des Wandels. Ihr Außenminister Alois Mock sorgte sich, dass Ungarns Entscheidung im Februar, die Grenzzäune abzubauen, zu einer steigenden Zahl von osteuropäischen Flüchtlingen führen würde. Steigende finanzielle Belastungen könnten Österreich dazu zwingen, seine Flüchtlingspolitik zu ändern. Österreichs Sozialdemokraten äußerten ihre Furcht, dass Ungarns sozialistische Partei HSWP kollabieren und Anarchie aufziehen könnte. Dies hielten sie für eine ebenso reale Gefahr wie die Rücknahme der Reformen. Ihr Credo lautete nach Darstellung der ungarischen Botschaft in Wien: 'Ungarn sollte Europa nicht schon wieder Kopfzerbrechen bereiten.'"
Der ungarische Historiker Laszlo Borhi rekapituliert, wie zögerlich und ängstlich Europa und die USA auf die Ereignisse von 1989 reagierten. Zum Beispiel die Offiziellen in Wien (die sich aber auch nicht stärker blamierten als ihre Kollegen in Bonn, Paris oder London): "Die Österreicher empfahlen eine langsame und vorhersehbare Demokratisierung. Der Staatssekretär im Außenministerium, Thomas Klestil, erkundigte sich bei bei Ungarns Außenminister Gyula Horn nach den Grenzen der Transformation und ob diese zu Spannungen mit der Sowjetunion führen könnten. Die Österreicher fürchteten die Unvorhersehbarkeiten des Wandels. Ihr Außenminister Alois Mock sorgte sich, dass Ungarns Entscheidung im Februar, die Grenzzäune abzubauen, zu einer steigenden Zahl von osteuropäischen Flüchtlingen führen würde. Steigende finanzielle Belastungen könnten Österreich dazu zwingen, seine Flüchtlingspolitik zu ändern. Österreichs Sozialdemokraten äußerten ihre Furcht, dass Ungarns sozialistische Partei HSWP kollabieren und Anarchie aufziehen könnte. Dies hielten sie für eine ebenso reale Gefahr wie die Rücknahme der Reformen. Ihr Credo lautete nach Darstellung der ungarischen Botschaft in Wien: 'Ungarn sollte Europa nicht schon wieder Kopfzerbrechen bereiten.'"Spectator (UK), 07.11.2009
 Für den Spectator war der Fall der Mauer ein Erfolg, den das Magazin persönlich nahm. Gefeiert wird mit Berichten über die Anbiederungen der Labour-Partei an die Sowjetunion in den Siebzigern (wie Maggie Thatcher in den Achtzigern Kohle aus der Sowjetunion liefern ließ, um den Streik der britischen Bergarbeiter zu brechen, ist dann wohl in der nächste Woche Thema). Aber es gibt auch die Erinnerungen des damaligen Osteuropa-Korrespondenten des Spectator, Timothy Garton Ash: "Die wunderbarste war die Samtene Revolution in Prag. Aus den Eingeweiden des unterirdischen Laterna-Magika-Theaters dirigierte der Dissidenten-Dramatiker Vaclav Havel sein größtes Stück, in dem er selbst auch die Hauptrolle spielte: 300.000 Menschen waren sein Ensemble, Tag für Tag versammelte es sich auf dem Wenzelsplatz, eine der größten und besten Bühnen der Welt. Tja, Pech gehabt, Cecil B. de Mille."
Für den Spectator war der Fall der Mauer ein Erfolg, den das Magazin persönlich nahm. Gefeiert wird mit Berichten über die Anbiederungen der Labour-Partei an die Sowjetunion in den Siebzigern (wie Maggie Thatcher in den Achtzigern Kohle aus der Sowjetunion liefern ließ, um den Streik der britischen Bergarbeiter zu brechen, ist dann wohl in der nächste Woche Thema). Aber es gibt auch die Erinnerungen des damaligen Osteuropa-Korrespondenten des Spectator, Timothy Garton Ash: "Die wunderbarste war die Samtene Revolution in Prag. Aus den Eingeweiden des unterirdischen Laterna-Magika-Theaters dirigierte der Dissidenten-Dramatiker Vaclav Havel sein größtes Stück, in dem er selbst auch die Hauptrolle spielte: 300.000 Menschen waren sein Ensemble, Tag für Tag versammelte es sich auf dem Wenzelsplatz, eine der größten und besten Bühnen der Welt. Tja, Pech gehabt, Cecil B. de Mille." Outlook India (Indien), 15.11.2009
 Der Titel ist dem miserablen Zustand von Arunachal gewidmet, einem indischen Bundesstaat an der Grenze zu Tibet. Im indo-chinesischen Krieg 1962 hatten die Chinesen vergeblich versucht, das Gebiet zu erobern. Heute fragen sich die Bewohner von Arunachal, auf ihr von Dehli vernachlässigtes Land, die Korruption und die maroden Straßen blickend, ob sie mit China nicht besser gefahren wären, berichtet Saikat Datta, Demokratie hin oder her. Der Arunachali Ritesh erzählt ihm, "von dem Tag, als er das erste Mal in seinem Leben die McMahon-Linie überquerte, die Indien und China trennt - und sah, wie China war. Tatsächlich sah Ritesh nicht das normale China, sondern die Region, die euphemistisch 'Autonome Region Tibet' (TAR) genannt wird. Rithesh konnte die McMahon Linie überqueren, weil es eine Tradition gibt, die das indische und chinesische Militär jedes Jahr brav befolgen. Am 15. August zieht die chinesische Delegation über Bum La nach Tawang; am 2. Oktober setzt eine indische Delegation über nach TAR, um den Chinesischen Nationalfeiertag zu feiern (mehr hier). An diesen beiden Tagen hissen beide Seiten die Flagge des Nachbarstaats. Neben dem Austausch von Liebenswürdigkeiten zeigt jede Delegation der anderen die Erfolge ihres Landes. Auf einem solchen Trip sah Ritesh Chinas Fortschritt. 'Die Straßen waren wunderbar', sagt er, 'die Dörfer todschick und die Infrastruktur fantastisch. Dann dachte ich an die Straße, auf der ich von Tezpur aus zwei Tage lang gefahren war, um dorthin zu kommen und ich fragte mich, wo Arunachal wäre, wenn es nach 1962 zu China gehört hätte."
Der Titel ist dem miserablen Zustand von Arunachal gewidmet, einem indischen Bundesstaat an der Grenze zu Tibet. Im indo-chinesischen Krieg 1962 hatten die Chinesen vergeblich versucht, das Gebiet zu erobern. Heute fragen sich die Bewohner von Arunachal, auf ihr von Dehli vernachlässigtes Land, die Korruption und die maroden Straßen blickend, ob sie mit China nicht besser gefahren wären, berichtet Saikat Datta, Demokratie hin oder her. Der Arunachali Ritesh erzählt ihm, "von dem Tag, als er das erste Mal in seinem Leben die McMahon-Linie überquerte, die Indien und China trennt - und sah, wie China war. Tatsächlich sah Ritesh nicht das normale China, sondern die Region, die euphemistisch 'Autonome Region Tibet' (TAR) genannt wird. Rithesh konnte die McMahon Linie überqueren, weil es eine Tradition gibt, die das indische und chinesische Militär jedes Jahr brav befolgen. Am 15. August zieht die chinesische Delegation über Bum La nach Tawang; am 2. Oktober setzt eine indische Delegation über nach TAR, um den Chinesischen Nationalfeiertag zu feiern (mehr hier). An diesen beiden Tagen hissen beide Seiten die Flagge des Nachbarstaats. Neben dem Austausch von Liebenswürdigkeiten zeigt jede Delegation der anderen die Erfolge ihres Landes. Auf einem solchen Trip sah Ritesh Chinas Fortschritt. 'Die Straßen waren wunderbar', sagt er, 'die Dörfer todschick und die Infrastruktur fantastisch. Dann dachte ich an die Straße, auf der ich von Tezpur aus zwei Tage lang gefahren war, um dorthin zu kommen und ich fragte mich, wo Arunachal wäre, wenn es nach 1962 zu China gehört hätte."Außerdem: Der chinesische Journalist Wang Yaodong beklagt sich bitter über die in seinen Augen höchst unfaire China-Berichterstattung in indischen Medien. Pranay Sharma gibt zu, dass die Inder das chinesische Wachstum, das ihres übertrifft, mit Unbehagen sehen. Und Lola Nayar betrachtet den Handel zwischen Indien und China.
Wired (USA), 01.11.2009
 Daniel Roth hat die Zukunft gesehen: der Henry Ford des Informationszeitalters ist eine Firma namens Demand Media, die täglich 4.000 Artikel und Videos produziert, die auf alle Fragen eine Antwort geben sollen. Die Grundidee: Weder traditionelle Medien, noch Blogger noch soziale Netzwerke liefern Antworten auf die Fragen, die die Leute wirklich wissen wollen. Bei Demand werden "die Stücke weder von ausgebildeten Redakteuren zusammengeträumt noch aufgrund eingereichter Fragen beauftragt. Statt dessen werden sie durch einen Algorithmus zusammengestellt, der ein knappes Terabyte an Such-Daten, Mustern von Besucherströmen und Suchbegriffe verarbeitet um herauszufinden, was die User wissen wollen und wieviel Anzeigenkunden bezahlen werden, um neben der Antwort zu erscheinen." Die Artikel und Videos werden von freien Mitarbeitern produziert, die im Schnitt 15 Dollar für einen Artikel bekommen und 20 Dollar für ein Video. Auf der Seite Demand Studio kann jeder sehen, welche Artikel gerade gebraucht werden. Vor kurzem bot Demand an einem einzigen Tag Aufträge für 62.000 Artikel an.
Daniel Roth hat die Zukunft gesehen: der Henry Ford des Informationszeitalters ist eine Firma namens Demand Media, die täglich 4.000 Artikel und Videos produziert, die auf alle Fragen eine Antwort geben sollen. Die Grundidee: Weder traditionelle Medien, noch Blogger noch soziale Netzwerke liefern Antworten auf die Fragen, die die Leute wirklich wissen wollen. Bei Demand werden "die Stücke weder von ausgebildeten Redakteuren zusammengeträumt noch aufgrund eingereichter Fragen beauftragt. Statt dessen werden sie durch einen Algorithmus zusammengestellt, der ein knappes Terabyte an Such-Daten, Mustern von Besucherströmen und Suchbegriffe verarbeitet um herauszufinden, was die User wissen wollen und wieviel Anzeigenkunden bezahlen werden, um neben der Antwort zu erscheinen." Die Artikel und Videos werden von freien Mitarbeitern produziert, die im Schnitt 15 Dollar für einen Artikel bekommen und 20 Dollar für ein Video. Auf der Seite Demand Studio kann jeder sehen, welche Artikel gerade gebraucht werden. Vor kurzem bot Demand an einem einzigen Tag Aufträge für 62.000 Artikel an.Odra (Polen), 01.10.2009
 Die interessantesten Beiträge der polnischen Kulturzeitschrift sind diesmal nicht online nachzulesen. Dazu gehört das Gespräch mit dem Literaturkritiker Piotr Sliwinski über die letzten zwanzig Jahre seit dem Umbruch. Von einer einheitlich literarischen Epoche könne nicht die Rede sein, eher vom Ende von etwas Altem und dem Anbahnen von etwas Neuem. "Das Alte war dominiert vom Streben nach Authentizität, dem Fokus auf existenzielle Fragen, dem Abwenden von der Idee einer großen Nationalliteratur. Das Neue hat andere Ziele: Sich wiederfinden in der Künstlichkeit, Identität als Spiel zu begreifen, das Schreiben, das Schriftstellersein als Performance zu begreifen". In den letzten Jahren habe sich eine neue Autorengeneration zu Wort gemeldet, die weder mit dem Kommunismus kämpfen noch die Freiheit begrüßen musste, keine Schreibmaschinen kannte und sich nicht für den Besitz eines Handys schämen musste. Die Literatur werde dadurch nicht automatisch besser oder schlechter, aber unterhalb von "Recycling, Pastiche, Cover" liegt eine Wahrheit, die nur herausragende Schriftsteller aufzeigen können, so Sliwinski.
Die interessantesten Beiträge der polnischen Kulturzeitschrift sind diesmal nicht online nachzulesen. Dazu gehört das Gespräch mit dem Literaturkritiker Piotr Sliwinski über die letzten zwanzig Jahre seit dem Umbruch. Von einer einheitlich literarischen Epoche könne nicht die Rede sein, eher vom Ende von etwas Altem und dem Anbahnen von etwas Neuem. "Das Alte war dominiert vom Streben nach Authentizität, dem Fokus auf existenzielle Fragen, dem Abwenden von der Idee einer großen Nationalliteratur. Das Neue hat andere Ziele: Sich wiederfinden in der Künstlichkeit, Identität als Spiel zu begreifen, das Schreiben, das Schriftstellersein als Performance zu begreifen". In den letzten Jahren habe sich eine neue Autorengeneration zu Wort gemeldet, die weder mit dem Kommunismus kämpfen noch die Freiheit begrüßen musste, keine Schreibmaschinen kannte und sich nicht für den Besitz eines Handys schämen musste. Die Literatur werde dadurch nicht automatisch besser oder schlechter, aber unterhalb von "Recycling, Pastiche, Cover" liegt eine Wahrheit, die nur herausragende Schriftsteller aufzeigen können, so Sliwinski.Alan Weiss erinnert an den Schriftsteller Stanislaw Vincenz, einen seinerzeit einflussreichen, aber heute fast vergessenen Homer des Huzulen-Landes in der heutigen Ukraine. "Das Lesen seiner Bücher erinnert an eine Fahrt in der dritten Klasse eines ukrainischen Zuges von Ivano-Frankivsk ins Cernohora-Gebiet. Ein Zug, aus dem man nach einer Stunden aussteigen möchte, den man nach einer gewissen Zeit aber vermisst. Man sehnt sich nach den langsam vorbeiziehenden Landschaften, nach der harten Holzbank, nach den Verkäufern im Zug. So ist Vincenz Schaffen - unauffällig und manchmal unbequem, aber es ist unmöglich, nicht wieder danach greifen zu wollen."
Al Ahram Weekly (Ägypten), 05.11.2009
 Warum zieht die arabische Welt keine Konsequenzen aus den niederschmetternden Arab Human Development Reports der Uno, fragt Ramzy Baroud. Zwar wurden in letzter Zeit vereinzelt Anstrengungen unternommen, zum Beispiel Ausbildung und Erziehung zu verbessern. "Aber natürlich ist Bildung auch eine Denkart, eine Kultur sogar. Welchen Sinn hat es, einen Magister zu erwerben in einer Gesellschaft, in der Nepotismus bestimmt, wer was tut? Vom Standpunkt des Eigeninteresses aus ist es vernünftiger, seine Zeit zu nutzen, um die 'richtigen Leute' kennen zu lernen - und ihnen die Visitenkarte zu überreichen - als Jahre des Lebens damit zu verbringen einen Universitätsabschluss zu erwerben."
Warum zieht die arabische Welt keine Konsequenzen aus den niederschmetternden Arab Human Development Reports der Uno, fragt Ramzy Baroud. Zwar wurden in letzter Zeit vereinzelt Anstrengungen unternommen, zum Beispiel Ausbildung und Erziehung zu verbessern. "Aber natürlich ist Bildung auch eine Denkart, eine Kultur sogar. Welchen Sinn hat es, einen Magister zu erwerben in einer Gesellschaft, in der Nepotismus bestimmt, wer was tut? Vom Standpunkt des Eigeninteresses aus ist es vernünftiger, seine Zeit zu nutzen, um die 'richtigen Leute' kennen zu lernen - und ihnen die Visitenkarte zu überreichen - als Jahre des Lebens damit zu verbringen einen Universitätsabschluss zu erwerben."Außerdem: Charlotte El-Shabrawy hat aus zwei Fortsetzungsdramen, die während des Ramadan im Fernsehen gezeigt wurden, gelernt, welche Belange im öffentlichen Leben Ägyptens heute eine große Rolle spielen: männlicher Stolz, weibliche Unabhängigkeit, Scheidung, Drogen, Aids, häusliche Gewalt, Demenz etc. Klingt vertraut. Und Ati Metwaly bespricht ein "Romeo und Julia"-Ballett.
Vanity Fair (USA), 01.12.2009
 Mark Bowden erzählt die Geschichte der Verhaftung eines Pädophilen. Nur dass er vielleicht doch keiner ist. Der Mann chattete im Internet mit einer Polizeibeamtin über Sex mit ihr und ihren zwei - imaginären - Kindern. Bowden hat einen Teil des Chats abgedruckt und jeder kann sich selbst einen Reim darauf machen, ob der Mann tatsächlich Interesse an den Kindern oder eher an der Frau hatte. Im Text nimmt Bowden auch die Zahlen auseinander, die eine Epidemie von Kinderpornografie im Netz belegen sollen, und hält fest: "Wie andere populäre Wahnvorstellungen enthält die Angst vor Kinderschändern im Internet eine Spur von Logik. Es ist vernünftig zu fragen, ob die Explosion von Internetpornografie, Kinderpornografie inklusive, vermehrt gestörte Menschen auf den Pfad der kriminellen Verderbtheit führt. Aber das Internet begleitet uns seit den Mitt-Neunzigern. Wenn es zu einem Anstieg sexueller Belästigung geführt hätte, wüssten wir das nicht inzwischen? Tatsächlich geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Laut einer Untersuchung des Justizministeriums beispielsweise sind sexuelle Anschläge auf Teenager zwischen 1992 und 2005 dramatisch gesunken - um 52 Prozent."
Mark Bowden erzählt die Geschichte der Verhaftung eines Pädophilen. Nur dass er vielleicht doch keiner ist. Der Mann chattete im Internet mit einer Polizeibeamtin über Sex mit ihr und ihren zwei - imaginären - Kindern. Bowden hat einen Teil des Chats abgedruckt und jeder kann sich selbst einen Reim darauf machen, ob der Mann tatsächlich Interesse an den Kindern oder eher an der Frau hatte. Im Text nimmt Bowden auch die Zahlen auseinander, die eine Epidemie von Kinderpornografie im Netz belegen sollen, und hält fest: "Wie andere populäre Wahnvorstellungen enthält die Angst vor Kinderschändern im Internet eine Spur von Logik. Es ist vernünftig zu fragen, ob die Explosion von Internetpornografie, Kinderpornografie inklusive, vermehrt gestörte Menschen auf den Pfad der kriminellen Verderbtheit führt. Aber das Internet begleitet uns seit den Mitt-Neunzigern. Wenn es zu einem Anstieg sexueller Belästigung geführt hätte, wüssten wir das nicht inzwischen? Tatsächlich geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung. Laut einer Untersuchung des Justizministeriums beispielsweise sind sexuelle Anschläge auf Teenager zwischen 1992 und 2005 dramatisch gesunken - um 52 Prozent."Elet es Irodalom (Ungarn), 30.10.2009
 Der Medienwissenschaftler Peter György besucht die von Gerald Matt kuratierte Ausstellung "1989 - Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft?"in Wien, die recht provokativ ausgefallen zu sein scheint: "Die Aufgabe des Museums liegt nach Matt nicht in der getreuen Darstellung der damaligen Ereignisse, sondern darin, das Thema als Ausgangspunkt zu verwenden und damit den Kindern von 1989 zu zeigen, wo die Welt, in der sie leben, ihren Anfang nahm, und den Zeitgenossen die Möglichkeit zu geben, mit ihrer Nostalgie und ihrem verletzten Gerechtigkeitsgefühl fertig zu werden. Die ungarischen Besucher der Ausstellung 1989... können sich in Wien mit einer Reihe von bildpolitischen Provokationen konfrontieren, die sie nicht nur zu einer floskelhaften Stellungnahme, sondern vielmehr zu einer schonungslosen Introspektion zwingen. Die Bilder üben einen Zwang aus, dem man nicht widerstehen kann. Zwanzig Jahre nach 1989 verschwindet jener Universalismus, in dessen Geist und Hoffnung wir einst lebten, langsam aus dem Blickfeld. Die Selbstprüfung ist darum nötiger geworden denn je."
Der Medienwissenschaftler Peter György besucht die von Gerald Matt kuratierte Ausstellung "1989 - Ende der Geschichte oder Beginn der Zukunft?"in Wien, die recht provokativ ausgefallen zu sein scheint: "Die Aufgabe des Museums liegt nach Matt nicht in der getreuen Darstellung der damaligen Ereignisse, sondern darin, das Thema als Ausgangspunkt zu verwenden und damit den Kindern von 1989 zu zeigen, wo die Welt, in der sie leben, ihren Anfang nahm, und den Zeitgenossen die Möglichkeit zu geben, mit ihrer Nostalgie und ihrem verletzten Gerechtigkeitsgefühl fertig zu werden. Die ungarischen Besucher der Ausstellung 1989... können sich in Wien mit einer Reihe von bildpolitischen Provokationen konfrontieren, die sie nicht nur zu einer floskelhaften Stellungnahme, sondern vielmehr zu einer schonungslosen Introspektion zwingen. Die Bilder üben einen Zwang aus, dem man nicht widerstehen kann. Zwanzig Jahre nach 1989 verschwindet jener Universalismus, in dessen Geist und Hoffnung wir einst lebten, langsam aus dem Blickfeld. Die Selbstprüfung ist darum nötiger geworden denn je.""Kein Drama, keine Pointen" - mit diesen Worten würdigt die Literaturwissenschaftlerin Sarolta Deczki den Erzählband "Solche Geschenke" von Franziska Gerstenberg, der nun in der Übersetzung von Hanna Győri auch in Ungarisch vorliegt (erschienen bei Jozsef Attila Kör - L'Harmattan): "Empfindlichkeit, Klugheit und Geduld zeichnen die Prosa von Gerstenberg aus. Mit einer ganz besonderen Feinheit hält sie Lebenssituationen, Stimmungen und Gefühle fest, und ihre Geschichten bestehen weniger aus Geschehnissen, sondern sind vielmehr Beschreibungen: Was wir bekommen, sind minuziös ausgearbeitete Fresken einer Lebenssituation, eines Ereignisses."
Times Literary Supplement (UK), 04.11.2009
Mit Goethe und Mozart habe man Hugo von Hofmannsthal zu seiner Zeit verglichen, erzählt der Germanist Paul Reitter. Ebenso habe es aber auch Kritik gegeben, insbesondere von Karl Kraus, der keine Gelegenheit ausließ, Hoffmansthal eins mitzugeben: "Als ein begieriger Sammler von Porzellanarbeiten, der Gedichte in Stefan Georges exklusiven 'Blättern für die Kunst' veröffentlichte, sah Hofmannsthal sich dem Vorwurf der ästhetischen Dekadenz ausgesetzt. Kraus etwa machte sich über ihn lustig und nannte ihn einen 'Edensteinsammler', der 'das Leben flieht' und gleichzeitig den Dingen huldigt, 'welche es verschönern'. Die Kritik saß, war aber kaum angemessen. Denn tatsächlich hatte Hofmannsthal schon von Beginn an seine Einwände gegen die Neigungen geäußert, die Kraus ihm vorwarf. In der Tat hat er einmal gesagt, dass 'modern' sein für ihn bedeute, 'alte Möbel und junge Nervositäten' auszustellen. Die Weltflucht ist ein wichtiges Sujet in seinen Arbeiten aus dem Jahrzehnt nach 1890, aber sie ist bei ihm eher als Problem verhandelt denn als Ideal." Im Anschluß an eine sehr lange Einführung bespricht Reitter die Hofmannsthal-Ausgabe "The Whole Difference" von J.D. McClatchy, dessen Tenor ihm nicht recht gefällt, und zwar weil Hofmannsthals Leben und Werk unter McClatchys Händen "prächtiger, aber auch weniger komplex and darum langweiliger gerät, als es tatsächlich war".
Espresso (Italien), 06.11.2009
 Silvio Berlusconi bestreitet natürlich jede Einflussnahme auf die Geschichte. Canale 5, ein Sender aus dem Portfolio von Silvio Berlusconi, hatte Mitte Oktober einen offenbar heimlich gefilmten Beitrag über den Mailänder Richter Raimondo Mesiano gesendet. Mesiano wird beim Warten vor dem Rasiersalon, beim "nervösen" Ziehen an einer Zigarette und beim Sitzen auf einer Parkbank gezeigt, mit besonderem Verweis auf seine türkisfarbenen Socken. Mesiano hat Berlusconis Finanzholdig Fininvest kürzlich zu einer Strafe von 750 Millionen Euro verurteilt. Umberto Eco hat als Zehnjähriger für eine ältere Frau einmal unwissentlich einen anonymen Brief verfasst. Da standen so harmlose Sachen drin wie "Ihre Angetraute ist sehr beliebt in der Stadt" oder "die Familie ist sehr wohlhabend". Eco weiß also Bescheid über die Feinheiten der Denunziation. "Es gibt natürlich konkrete Anschuldigungen, mehr oder weniger anonym, die auf ein bestimmtes Verbrechen hinweisen (der ist pädophil, hat Steuergelder veruntreut, geht ins Bett mit Ihrer Ehefrau oder Ihrem Ehemann, hat etwas mit Osama zu tun); sie werden am häufigsten eingesetzt, sind aber, wie soll ich sagen, die unschuldigsten, denn es genügen kleine Fakten, um sie als inkorrekt zu entlarven und damit wirkungslos werden zu lassen. Die gefährlichsten sind jene Sätze, die überhaupt nichts behaupten und alles dem Empfänger überlassen. Sie sind nicht greifbar. Aber gefährlich."
Silvio Berlusconi bestreitet natürlich jede Einflussnahme auf die Geschichte. Canale 5, ein Sender aus dem Portfolio von Silvio Berlusconi, hatte Mitte Oktober einen offenbar heimlich gefilmten Beitrag über den Mailänder Richter Raimondo Mesiano gesendet. Mesiano wird beim Warten vor dem Rasiersalon, beim "nervösen" Ziehen an einer Zigarette und beim Sitzen auf einer Parkbank gezeigt, mit besonderem Verweis auf seine türkisfarbenen Socken. Mesiano hat Berlusconis Finanzholdig Fininvest kürzlich zu einer Strafe von 750 Millionen Euro verurteilt. Umberto Eco hat als Zehnjähriger für eine ältere Frau einmal unwissentlich einen anonymen Brief verfasst. Da standen so harmlose Sachen drin wie "Ihre Angetraute ist sehr beliebt in der Stadt" oder "die Familie ist sehr wohlhabend". Eco weiß also Bescheid über die Feinheiten der Denunziation. "Es gibt natürlich konkrete Anschuldigungen, mehr oder weniger anonym, die auf ein bestimmtes Verbrechen hinweisen (der ist pädophil, hat Steuergelder veruntreut, geht ins Bett mit Ihrer Ehefrau oder Ihrem Ehemann, hat etwas mit Osama zu tun); sie werden am häufigsten eingesetzt, sind aber, wie soll ich sagen, die unschuldigsten, denn es genügen kleine Fakten, um sie als inkorrekt zu entlarven und damit wirkungslos werden zu lassen. Die gefährlichsten sind jene Sätze, die überhaupt nichts behaupten und alles dem Empfänger überlassen. Sie sind nicht greifbar. Aber gefährlich." New Republic (USA), 06.11.2009
 Sarah William Goldhagen hat ihre gutmütige Familie mitgeschleppt auf eine Pilgerreise zu Peter Zumthors entrückten Bauten, deren unheimlicher Schönheit sie in nahezu religiösem Ton huldigt. Zum Beispiel der Therme Vals: "Diese strenge polyphone Symphonie aus Stein, Schatten, Wasser und Licht kommt den größten Werken der Architektur gleich: dem Pantheon in Rom, der Hagia Sophia in Istanbul, der Alhambra in Granada, Le Corbusiers Notre Dame in Rionchamp, Louis Kahns Parlamentsgebäude in Dhaka. Wie all diese Gebäude verändert Zumthors Therme unser Verständnis von Architektur und zugleich uns selbst... Mann oder Frau - in dieser Therme nimmt niemand einfach ein Bad. Man lässt sich auf ein grundlegendes Ritual der Reinigung und Klärung ein, wie es in den unterschiedlichen Kulturen über Tausende von Jahren praktiziert wurde, ein Ritual, durchzogen von symbolischen Assoziationen, kontemplativen Transformationen und spirituellen Dimensionen. Augenblicke und Räume bleiben in unserem Inneren haften, anhaltende Erinnerungen an jene seltenen Momente einer vom Menschen geschaffenen Schönheit."
Sarah William Goldhagen hat ihre gutmütige Familie mitgeschleppt auf eine Pilgerreise zu Peter Zumthors entrückten Bauten, deren unheimlicher Schönheit sie in nahezu religiösem Ton huldigt. Zum Beispiel der Therme Vals: "Diese strenge polyphone Symphonie aus Stein, Schatten, Wasser und Licht kommt den größten Werken der Architektur gleich: dem Pantheon in Rom, der Hagia Sophia in Istanbul, der Alhambra in Granada, Le Corbusiers Notre Dame in Rionchamp, Louis Kahns Parlamentsgebäude in Dhaka. Wie all diese Gebäude verändert Zumthors Therme unser Verständnis von Architektur und zugleich uns selbst... Mann oder Frau - in dieser Therme nimmt niemand einfach ein Bad. Man lässt sich auf ein grundlegendes Ritual der Reinigung und Klärung ein, wie es in den unterschiedlichen Kulturen über Tausende von Jahren praktiziert wurde, ein Ritual, durchzogen von symbolischen Assoziationen, kontemplativen Transformationen und spirituellen Dimensionen. Augenblicke und Räume bleiben in unserem Inneren haften, anhaltende Erinnerungen an jene seltenen Momente einer vom Menschen geschaffenen Schönheit."Standpoint (UK), 01.11.2009
 Der katholische Autor Piers Paul Read und der konservative Politiker David Heathcoat-Amory kennen sich seit ihrer Kindheit. Doch wurde aus ersterem ein EU-Fan, aus letzterem ein EU-Gegner. Das Gespräch kommt einem - vor allem als Mittel- und Osteuropäer - vor wie eine Diskussion auf einem anderen Stern. Auf den Vorhalt Heathcoat-Amorys, die EU versuche ein supranationales System zu erbauen, antwortet Read: "Ja, genau das wollen wir. Nationalstaaten haben zu endlosen Kriegen, Konkurrenz und Abschlachterei geführt. Der Nationalstaat war eine fürchterliche Idee, während Charles V. Konzept für die Christenheit, für ein Europäisches Heiliges Römisches Reich eine wunderbare Idee war. Und die EU ist zum Teil eine Neuverkörperung dieses Konzepts. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Spanien und Österreich je einen Krieg ausgefochten haben. Oder haben sie, die beiden Habsburger Reiche? Ich meine, wenn die Habsburger ganz Europa beherrscht hätten, hätten wir nicht diese Religionskriege gehabt. Der Protestantismus wäre von der Inquisition im Keim erstickt worden."
Der katholische Autor Piers Paul Read und der konservative Politiker David Heathcoat-Amory kennen sich seit ihrer Kindheit. Doch wurde aus ersterem ein EU-Fan, aus letzterem ein EU-Gegner. Das Gespräch kommt einem - vor allem als Mittel- und Osteuropäer - vor wie eine Diskussion auf einem anderen Stern. Auf den Vorhalt Heathcoat-Amorys, die EU versuche ein supranationales System zu erbauen, antwortet Read: "Ja, genau das wollen wir. Nationalstaaten haben zu endlosen Kriegen, Konkurrenz und Abschlachterei geführt. Der Nationalstaat war eine fürchterliche Idee, während Charles V. Konzept für die Christenheit, für ein Europäisches Heiliges Römisches Reich eine wunderbare Idee war. Und die EU ist zum Teil eine Neuverkörperung dieses Konzepts. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Spanien und Österreich je einen Krieg ausgefochten haben. Oder haben sie, die beiden Habsburger Reiche? Ich meine, wenn die Habsburger ganz Europa beherrscht hätten, hätten wir nicht diese Religionskriege gehabt. Der Protestantismus wäre von der Inquisition im Keim erstickt worden."Nepszabadsag (Ungarn), 07.11.2009
 Die so genannte "Glückspiel-Affäre" hat die polnische Medienlandschaft im Nu in regierungsnahe und oppositionelle Lager aufgeteilt. Angesichts der verhärteten Fronten befürchtet der polnische Publizist Bogdan Goralczyk eine Art "kalten Bürgerkrieg", wie er in Ungarn seit Jahren zu beobachten ist: "Bei der Schlussabrechnung werden alle auf der Verliererseite stehen. Sollten die Emotionen nicht bei Zeiten abgekühlt und die Parteiinteressen in den Hintergrund gedrängt werden, könnte der große Verlierer gar Polen selbst sein. [...] Da kann man noch von Glück reden, dass der Konflikt ausschließlich die politische und die Medien-Elite beschäftigt, während die Bevölkerung aber ihren Pflichten nachgeht, wodurch der wirtschaftliche Zustand erhalten werden könnte. Trotzdem erwarten uns noch trotz des Winters heiße Monate in Polen – und das ganz unabhängig von der globalen Erderwärmung."
Die so genannte "Glückspiel-Affäre" hat die polnische Medienlandschaft im Nu in regierungsnahe und oppositionelle Lager aufgeteilt. Angesichts der verhärteten Fronten befürchtet der polnische Publizist Bogdan Goralczyk eine Art "kalten Bürgerkrieg", wie er in Ungarn seit Jahren zu beobachten ist: "Bei der Schlussabrechnung werden alle auf der Verliererseite stehen. Sollten die Emotionen nicht bei Zeiten abgekühlt und die Parteiinteressen in den Hintergrund gedrängt werden, könnte der große Verlierer gar Polen selbst sein. [...] Da kann man noch von Glück reden, dass der Konflikt ausschließlich die politische und die Medien-Elite beschäftigt, während die Bevölkerung aber ihren Pflichten nachgeht, wodurch der wirtschaftliche Zustand erhalten werden könnte. Trotzdem erwarten uns noch trotz des Winters heiße Monate in Polen – und das ganz unabhängig von der globalen Erderwärmung."Guardian (UK), 07.11.2009
Ihre Bücher über die Mumins (diese liebenswerte großnasige Kreaturen, die den existenzialistischen skandinavischen Winter Jahr für Jahr überleben), haben der finnischen Autoren Tove Jansson so viel Berühmtheit gebracht, ihre Erwachsenenbücher dagegen kennt niemand. Nun wurden sie zum ersten Mal ins Englische übersetzt, und Ali Smih hat darin Jansson at her best erlebt: "Ihr Roman 'The True Deceiver' über Wahrheit, Täuschung, Selbsttäuschung und der ehrliche Umgang mit Fiktion ist umwerfend in seiner Klarheit und scheinbaren Einfachheit. 1982 veröffentlicht, ist dieser, ihr dritter Roman für Erwachsene das Herzstück ihres zutiefst rätselhaften und subtilen Werks. Ihr Biograf Boel Westin hält fest, dass sie große Schwierigkeiten mit ihm hatte. 'Dieser schonungslose Blick auf das Leben', kommentiert Westin, ' ist charakteristisch für ihre Romane.' Jansson selbst hielt fest, wie stur und hart sie daran gearbeitet hat. Kein Zweifel, es waren niederdrückende Bedingungen, unter denen ihre Figuren leben mussten. 'Der Wind hatte zugenommen. Er drückte den Schnee gegen die Fenster mit einem machtvollen Flüstern, das die Menschen des Ortes seit langer, langer Zeit verfolgte. Zwischen den Windböen war Stille."
New York Times (USA), 08.11.2009
Emily Parker schildert in der Book Review in einem interessanten Essay, welche Auswirkung die digitale Kommunikation auf die japanische Sprache hat. "Die japanische Sprache wird durch Blogs, EMails und keitai shosetsu (Handyromane) verändert. Amerikaner mögen sich darüber aufregen, dass die digitale Kommunikation schlampige Grammatik und Rechtschreibung fördern, aber in Japan sind diese Veränderungen umstürzender. Eine vertikal geschriebene Sprache scheint immer mehr horizontal zu werden. Romane werden auf kleinen Bildschirmen geschrieben und gelesen. Die Leute haben sich so ans Tippen gewöhnt, dass sie Zeichen nicht mehr mit der Hand schreiben können. Und immer mehr englische Wörter infiltrieren die Sprache." Der größten Vorteil, den Parker in der Vereinfachung - oder Verflachung, wie man's nimmt - sieht, liegt darin, dass sie Immigranten, die das überalterte Japan dringend braucht, das Erlernen des Japanischen erleichtern könnte.
Besprochen werden unter anderem Stephen Kings neuer Roman "Under the Dome" (Hörprobe), eine Samuel-Johnson-Biografie und John Irvings neuer Roman "Last Night in Twisted River" (Leseprobe). Das Magazine befasst sich mit der Gesundheitsreform und der Frage, wie man Choreografien für Modernen Tanz dokumentieren kann.
Besprochen werden unter anderem Stephen Kings neuer Roman "Under the Dome" (Hörprobe), eine Samuel-Johnson-Biografie und John Irvings neuer Roman "Last Night in Twisted River" (Leseprobe). Das Magazine befasst sich mit der Gesundheitsreform und der Frage, wie man Choreografien für Modernen Tanz dokumentieren kann.
Kommentieren