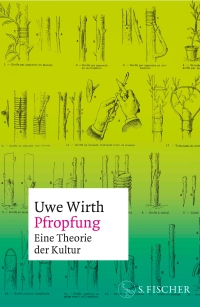Magazinrundschau
Mein Messer ist so schön und scharf
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
19.04.2011. Hauptnutznießer der Ermordung von Malcolm X war Louis Farrakhan, lernt der Guardian aus Manning Marables "Malcolm X"-Biografie. Von Journalisten, die sich als Jack the Ripper ausgaben, erzählt das TLS. Für Osteuropa reist Wassili Golowanow über die Barentssee. Im Bookforum kennt Rian Malan ein Gegenmittel für die süßen Lügen südafrikanischer Politik. In Le Monde stellt Claude Lanzmann klar: die Intervention in Libyen ist Krieg.
Guardian (UK), 18.04.2011
Die informativste und kürzeste Kritik zu Manning Marables "Malcolm X"-Biografie (Leseprobe) hat Peter James Hundson geschrieben. Zwei Aspekte hebt er besonders hervor: Malcolm X' Pilgerfahrt nach Mekka und seine Ermordung durch Mitglieder der Nation of Islam: "Marable gräbt neue Informationen aus den Überwachungsakten des FBI und der NYPD über die Ermordung aus: Drei Männer waren ursprünglich verurteilt worden; nur zwei von ihnen waren während des Anschlags anwesend. Marables Forschung weist auf eine Konspiration hin, die von Mitgliedern der Moschee Nation of Islam in Newark, New Jersey organisiert wurde. Einige der Verschwörer leben noch und wurden nie angeklagt. Der Anschlag wurde von der Führung der Nation stillschweigend befürwortet und sowohl von der NYPD als auch vom FBI indirekt unterstützt. Wie auch immer, der 'Hauptnutznießer der Ermordung Malcolms', versichert Marable, 'war Louis Farrakhan' - Malcolms ehemaliger Schüler. Nach der Ermordung Malcolms konnte Farrakhan Malcolms führende Position in der Nation nach dem Tod von Elijah Muhammad übernehmen."
Annalena McAfee ist im Zuge einer Recherche für ihren neuen Roman auf eine ganze Reihe von Kriegskorrespondentinnen gestoßen, die heute kaum noch jemand kennt. Zum Beispiel Margaret Fuller, "eine Dorothy-Parker-Frau in einer Jane-Austen-Welt", die von der 1848er Revolution in Rom berichtete, oder Jessie White, die von Garibaldis Schlachtfeldern berichtete, oder Cora Stewart Taylor, die Ende des 19. Jahrhunderts über den griechisch-türkischen Krieg berichtete und das eine oder andere Bordell führte, Anna N Benjamin, Mary Roberts Rinehart, Nellie Bly, Ishbel Ross, Martha Gellhorn, Clare Hollingworth, Virginia Cowles oder Marguerite Higgins, die kein General vom Koreakrieg fernhalten konnte. Janet Flanner, die Paris-Korrespondentin des New Yorker, beobachtete, wie Higgins auf ein Kriegsschiffes gehievt wurde, das schon abgelegt hatte. An Bord kam eine "schlanke, blauäugige 24-Jährige in Uniform, deren Helm herunterfiel und eine Wolke blonden Haars enthüllte. 'Das war meine erste Begegnung mit Marguerite Higgins', sagte Flanner. 'Sie sah so süß und unschuldig aus. Ich dachte sofort an Goldlöckchen und wollte sie beschützen. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich sie über Bord geworfen.'"
Außerdem: Es ist einfach schön zu wissen, dass Werner Herzog in der englischsprachigen Welt geliebt wird, weil er hierzulande offenbar als alter Hut gilt: Hari Kunzru widmet ihm anlässlich seines neuen Films "Cave of forgotten dreams" ein ausführliches Werkporträt, das deutschen Lesern und Zuschauern besonders ans Herz gelegt sei.
Annalena McAfee ist im Zuge einer Recherche für ihren neuen Roman auf eine ganze Reihe von Kriegskorrespondentinnen gestoßen, die heute kaum noch jemand kennt. Zum Beispiel Margaret Fuller, "eine Dorothy-Parker-Frau in einer Jane-Austen-Welt", die von der 1848er Revolution in Rom berichtete, oder Jessie White, die von Garibaldis Schlachtfeldern berichtete, oder Cora Stewart Taylor, die Ende des 19. Jahrhunderts über den griechisch-türkischen Krieg berichtete und das eine oder andere Bordell führte, Anna N Benjamin, Mary Roberts Rinehart, Nellie Bly, Ishbel Ross, Martha Gellhorn, Clare Hollingworth, Virginia Cowles oder Marguerite Higgins, die kein General vom Koreakrieg fernhalten konnte. Janet Flanner, die Paris-Korrespondentin des New Yorker, beobachtete, wie Higgins auf ein Kriegsschiffes gehievt wurde, das schon abgelegt hatte. An Bord kam eine "schlanke, blauäugige 24-Jährige in Uniform, deren Helm herunterfiel und eine Wolke blonden Haars enthüllte. 'Das war meine erste Begegnung mit Marguerite Higgins', sagte Flanner. 'Sie sah so süß und unschuldig aus. Ich dachte sofort an Goldlöckchen und wollte sie beschützen. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich sie über Bord geworfen.'"
Außerdem: Es ist einfach schön zu wissen, dass Werner Herzog in der englischsprachigen Welt geliebt wird, weil er hierzulande offenbar als alter Hut gilt: Hari Kunzru widmet ihm anlässlich seines neuen Films "Cave of forgotten dreams" ein ausführliches Werkporträt, das deutschen Lesern und Zuschauern besonders ans Herz gelegt sei.
Times Literary Supplement (UK), 15.04.2011
Mit Vergnügen hat Jonathan Barnes das Buch "The Invention of Murder" von Judith Flanders gelesen, die erzählt, wie die Viktorianer das moderne Verbrechen erfanden. Entscheidend war die Professionalisierung der Polizei, die Herausbildung des Detektivs und die Massenpresse. Am besten natürlich das Beispiel Jack the Ripper: "Flanders stellt (vielleicht etwas forsch) fest, dass, seit Kain Abel erschlug, über keinen Mord so viel geschrieben wurde wie über die Whitechapel-Morde, und sie argumentiert, dass die Verbrechen eine Zusammenfassung grimmiger Logik bedeuten. 'Alles was wir über Jack the Ripper wissen - seinen Namen, seine Person, seine Grüne zu töten -, ist der Höhepunkt eines Jahrhunderts voll mörderischer Unterhaltung, Melodram, Puppenshows, Schauergeschichten', schreibt sie. Die Presse, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt einflussreicher wurde, war 1888 - das Jahr, in dem die Prostituierten des East End abgechlachtet wurden -, in der Lage, eine nationale Panik zu erzeugen. Viele, wenn nicht alle Briefe, die angeblich vom Täter an Scotland Yard, die Central News Agency und das Vigilance Committee geschickt wurden ('Mein Messer ist so schön und scharf, ich möcht' gleich ans Werk gehen...'), wurden fast sicher von Journalisten verfasst."
New Yorker (USA), 25.04.2011
 David Remnick hat nicht viel zu sagen zu Manning Marables Malcolm-X-Biografie. In seinem Artikel zeichnet er eher das faszinierend komplizierte private und politische Leben von Malcolm X - dem ein Lehrer gesagt hatte, Anwalt sei "kein realistisches Ziel für einen Nigger" - nach, wie Alex Haley es aufgeschrieben und Jahre später Barack Obama beeindruckt hat: "Im milden Hawaii, an einer der angesehensten Privatschulen westlich der Rockies, fand Obama etwas in dieser Geschichte eines Mannes, der auch gemischtrassig war, seinen Vater verloren hatte und seine Identität erschaffen musste. [...] 'Ich habe mich nie so für seine Theorien interessiert', sagte mir Obama letztes Jahr. 'Ich denke, Malcolm X knüpfte an eine alte Tradition der afroamerikanischen Community an, wonach es in bestimmten Momenten für einen Afroamerikaner wichtig ist, sich seiner Männlichkeit zu versichern, seines Wertes. ... Diese Bestätigung, dass man ein Mann ist, dass man etwas wert ist, war wichtig. Und ich glaube, Malcolm X hat das besser erfasst als jeder andere." (In der NYT lieferte letzte Woche Michiko Kakutami eine Besprechung von Marables Biografie, die so steif ist, als hätte Bill Keller sie redigiert.)
David Remnick hat nicht viel zu sagen zu Manning Marables Malcolm-X-Biografie. In seinem Artikel zeichnet er eher das faszinierend komplizierte private und politische Leben von Malcolm X - dem ein Lehrer gesagt hatte, Anwalt sei "kein realistisches Ziel für einen Nigger" - nach, wie Alex Haley es aufgeschrieben und Jahre später Barack Obama beeindruckt hat: "Im milden Hawaii, an einer der angesehensten Privatschulen westlich der Rockies, fand Obama etwas in dieser Geschichte eines Mannes, der auch gemischtrassig war, seinen Vater verloren hatte und seine Identität erschaffen musste. [...] 'Ich habe mich nie so für seine Theorien interessiert', sagte mir Obama letztes Jahr. 'Ich denke, Malcolm X knüpfte an eine alte Tradition der afroamerikanischen Community an, wonach es in bestimmten Momenten für einen Afroamerikaner wichtig ist, sich seiner Männlichkeit zu versichern, seines Wertes. ... Diese Bestätigung, dass man ein Mann ist, dass man etwas wert ist, war wichtig. Und ich glaube, Malcolm X hat das besser erfasst als jeder andere." (In der NYT lieferte letzte Woche Michiko Kakutami eine Besprechung von Marables Biografie, die so steif ist, als hätte Bill Keller sie redigiert.)Außerdem: Burkhard Bilger porträtiert den Neurowissenschaftler David Eagleman, der über eine eigene Nahtoderfahrung zu seinem Lebensthema fand und über Geheimnisse von Zeit und Gehirn forscht.
Osteuropa (Deutschland), 18.04.2011
 Das neue Osteuropa-Heft ist der Arktis gewidmet. Der Schriftsteller und Fotograf Wassili Golowanow erzählt von seiner Reise zur Insel Kolgujew in der östlichen Barentssee, Siedlungsgebiet der nomadischen Nenzen, die ihre Standplätze vor dem Verlassen mit Gänsefedern sauber fegten: "Nun stehen wir auf dem sandigen Küstenstreifen am Landende. Ringsumher die Wasser des Nordpolarmeers. Irgendwo hinter dem Horizont liegt die Welt. Mitunter tragen die von weither anrollenden Wellen Dinge heran und lassen sie auf dem Ufer zurück. Würden wir diese Dinge wie Schriftzeichen aneinanderlegen, so könnten wir vielleicht eine wichtige Botschaft lesen, die uns erlaubte, diese Welt zu begreifen. Doch einstweilen fehlen noch viele Buchstaben, und wir durchkämmen mit zerstreuter Hand diesen Fundus des Weltalphabets. G - Geschoss, Geschosskisten, Gasmaske, Geschirrverpackungen. F - Fässer, Flaschen. S - Schnüre und Stricke (verheddert), Schwimmer. H - Holzteile (mit Nägeln), Hubschrauberverkleidung (ein abgerissenes Stück). B - Bierdosen ..." (Golowanows Buch "Die Insel oder Rechtfertigung des sinnlosen Reisens" erscheint nächstes Jahr bei Matthes und Seitz).
Das neue Osteuropa-Heft ist der Arktis gewidmet. Der Schriftsteller und Fotograf Wassili Golowanow erzählt von seiner Reise zur Insel Kolgujew in der östlichen Barentssee, Siedlungsgebiet der nomadischen Nenzen, die ihre Standplätze vor dem Verlassen mit Gänsefedern sauber fegten: "Nun stehen wir auf dem sandigen Küstenstreifen am Landende. Ringsumher die Wasser des Nordpolarmeers. Irgendwo hinter dem Horizont liegt die Welt. Mitunter tragen die von weither anrollenden Wellen Dinge heran und lassen sie auf dem Ufer zurück. Würden wir diese Dinge wie Schriftzeichen aneinanderlegen, so könnten wir vielleicht eine wichtige Botschaft lesen, die uns erlaubte, diese Welt zu begreifen. Doch einstweilen fehlen noch viele Buchstaben, und wir durchkämmen mit zerstreuter Hand diesen Fundus des Weltalphabets. G - Geschoss, Geschosskisten, Gasmaske, Geschirrverpackungen. F - Fässer, Flaschen. S - Schnüre und Stricke (verheddert), Schwimmer. H - Holzteile (mit Nägeln), Hubschrauberverkleidung (ein abgerissenes Stück). B - Bierdosen ..." (Golowanows Buch "Die Insel oder Rechtfertigung des sinnlosen Reisens" erscheint nächstes Jahr bei Matthes und Seitz).Der Historiker Philipp Felsch blickt auf die jahrhundertealte Vorstellung von einem eisfreien Polarmeer zurück. Was jetzt dank schmelzender Polkappen eine schiffbare Nordwestpassage und zugängliche Rohstoffe verheißt, war im 19. Jahrhundert ein fataler Irrtum, der die großen Polarforscher wie Sir John Franklin in den tragischen Tod trieb: "Ihre Schiffe waren Bastionen englischer Lebensweise: von der zwölfhundert Bände umfassenden Bordbibliothek über feines Porzellan bis zu den gefütterten Winteruniformen der Königlichen Marine, dazu zum ersten Mal bleiverlötete Fleischkonserven - der Zuschnitt der Franklin-Expedition offenbart die ganze Hybris des viktorianischen Welteroberungsprojekts. Allerdings sagt sich das leicht, wenn man weiß, dass Franklin grandios scheiterte. Statt zur ersehnten Beringstraße durchzubrechen, froren seine Schiffe im Eis ein und mussten nach mehreren tatenlosen Wintern schließlich aufgegeben werden. Der Versuch, zu Fuß nach Süden zu entkommen, schlug fehl und endete in einem verzweifelten Todesmarsch, ein kannibalistisches Finale inklusive."
Bookforum (USA), 15.04.2011
 Als Heilmittel gegen alle Illusionen über das neue Südafrika empfiehlt der Autor Rian Malan das Buch "Brave New World" des Politikwissenschaftlers R.W. Johnson, eine bittere Bilanz des unter Thabo Mbeki in Korruption und Immoralität versunkenen Südafrikas. Johnson, erzählt Malan, ging als Mitglied der Kommunistischen Partei in den 60ern ins britische Exil und kehrte 1995 zurück: "Eine churchillhafte Gestalt, bewehrt mit der Art absoluten Selbstbewusstseins, das man mit dem britischen Establishment verbindet. Jahrzehnte des Exils haben ihn zu einem Liberalen in der strengen britischen Tradition des 19. Jahrhunderts gemacht, das heißt, er ist für freie Märkte, freie Rede, eine konstitutionelle Demokratie und gegen die albernen Sperenzchen seiner einstigen Genossen. Johnson war immer auch ein begnadeter Schreiber, oder vielleicht sollte ich sagen: Redner. Essays und Artikel gingen ihm ganz leicht von der Zunge und ins Aufnahmegerät. Im Ergebnis war die Prosa gebieterisch im Ton und ein permanenter Angriff auf die linken Journalisten und Akademiker, die versuchten, das Bild von Nelson Mandela und seiner Regenbogennation zu kontrollieren. Johnson tat ihre Erzeugnisse als 'ideologische Willfährigkeit oder reine Einbildung' ab. Sie rächten sich, indem sie ihn als Rassisten brandmarkten."
Als Heilmittel gegen alle Illusionen über das neue Südafrika empfiehlt der Autor Rian Malan das Buch "Brave New World" des Politikwissenschaftlers R.W. Johnson, eine bittere Bilanz des unter Thabo Mbeki in Korruption und Immoralität versunkenen Südafrikas. Johnson, erzählt Malan, ging als Mitglied der Kommunistischen Partei in den 60ern ins britische Exil und kehrte 1995 zurück: "Eine churchillhafte Gestalt, bewehrt mit der Art absoluten Selbstbewusstseins, das man mit dem britischen Establishment verbindet. Jahrzehnte des Exils haben ihn zu einem Liberalen in der strengen britischen Tradition des 19. Jahrhunderts gemacht, das heißt, er ist für freie Märkte, freie Rede, eine konstitutionelle Demokratie und gegen die albernen Sperenzchen seiner einstigen Genossen. Johnson war immer auch ein begnadeter Schreiber, oder vielleicht sollte ich sagen: Redner. Essays und Artikel gingen ihm ganz leicht von der Zunge und ins Aufnahmegerät. Im Ergebnis war die Prosa gebieterisch im Ton und ein permanenter Angriff auf die linken Journalisten und Akademiker, die versuchten, das Bild von Nelson Mandela und seiner Regenbogennation zu kontrollieren. Johnson tat ihre Erzeugnisse als 'ideologische Willfährigkeit oder reine Einbildung' ab. Sie rächten sich, indem sie ihn als Rassisten brandmarkten."El Pais Semanal (Spanien), 17.04.2011
"Ich blicke nicht zurück. Diese Haltung kann ich den Bürgern aber nicht aufzwingen." Soledad Gallego-Diaz spricht mit dem Präsidenten von Uruguay, Jose Mujica, der während der Militärdiktatur brutal gefoltert wurde und fast 15 Jahre inhaftiert war, sich jetzt aber - erfolglos - gegen die Aufhebung eines am Ende der Diktatur verfügten Amnestiegesetzes für deren Verbrechen ausgesprochen hat - wie übrigens die Mehrheit der Uruguayer bei zwei früheren Abstimmungen: "Eine republikanische Demokratie muss sich der Treue ihrer Streitkräfte versichern. Wen man verachtet, der wird einem nie treu ergeben sein. Da liegt das Paradox. Die Wunden der Vergangenheit bringen viele von uns dazu, die Militärs von heute wegen deren Vorgängern zu verurteilen." - "Und wie steht es allgemein mit der neuen lateinamerikanischen Linken, der ja auch Sie zuzurechnen sind?" - "Man könnte glauben, Südamerika sei der letzte Zufluchtsort für Linke weltweit. Stimmt aber nicht. Die Linke ist so alt wie die Menschheit. Die Rechte genauso. Jeder Mensch hat eine konservative Seite und eine, die für Veränderungen ist. Mit diesem Widerspruch müssen die Menschen leben. Die konservative Seite, für die es gute Gründe gibt, wird reaktionär, wenn sie sich stur sämtlichen Veränderungen verschließt. Die linke Seite dagegen wird kindisch, wenn sie es mit der Radikalität übertreibt. Entscheidend ist die Mitte, die zugleich die Mehrheit ist - früher hielten wir Linken die Mitte bloß für kleinbürgerlich; heute sehen wir, dass es dort eine große Liebe zu den kleinen Dingen des Lebens gibt, die letztlich so wichtig sind."
The Atlantic (USA), 01.05.2011
 Philip Larkin war einer der miesepetrigsten Personen überhaupt in der englischen Dichtung, so charakterisiert ihn jedenfalls Christopher Hitchens, der eine Ehrenrettung dieses Dichters versucht, der Sex überhaupt nicht mochte, außer mit sich selbst und angefeuert von Fantasien, die heute als wirklich schmutzig gelten. 1951 schrieb Larkin: "Ich finde - obwohl ich natürlich für freie Lebe, fortschrittliche Schulen usw. bin - dass irgendjemand mal eine kleine Studie über die inneren Eigenschaften des Sex erstellen sollte - über seine Grausamkeit, seine Tyrannei zum Beispiel. Es scheint mir, dass jemanden unter deinen Willen zu beugen das eigentliche Wesen des Sex ist - mit Zwang oder Nachlässigkeit, wenn man männlich ist, mit Gehässigkeit oder Nörgelei oder Szenen, wenn man weiblich ist. Und was am schlimmsten ist, beide Seiten haben es lieber so als gar nicht. Ich nicht." Das Ergebnis dieser Überlegung war sein Gedicht "Deceptions".
Philip Larkin war einer der miesepetrigsten Personen überhaupt in der englischen Dichtung, so charakterisiert ihn jedenfalls Christopher Hitchens, der eine Ehrenrettung dieses Dichters versucht, der Sex überhaupt nicht mochte, außer mit sich selbst und angefeuert von Fantasien, die heute als wirklich schmutzig gelten. 1951 schrieb Larkin: "Ich finde - obwohl ich natürlich für freie Lebe, fortschrittliche Schulen usw. bin - dass irgendjemand mal eine kleine Studie über die inneren Eigenschaften des Sex erstellen sollte - über seine Grausamkeit, seine Tyrannei zum Beispiel. Es scheint mir, dass jemanden unter deinen Willen zu beugen das eigentliche Wesen des Sex ist - mit Zwang oder Nachlässigkeit, wenn man männlich ist, mit Gehässigkeit oder Nörgelei oder Szenen, wenn man weiblich ist. Und was am schlimmsten ist, beide Seiten haben es lieber so als gar nicht. Ich nicht." Das Ergebnis dieser Überlegung war sein Gedicht "Deceptions".Außerdem: Ta-Nehisi Coates erzählt, was Malcolm X ihm und seiner Familie bedeutet.
Elet es Irodalom (Ungarn), 15.04.2011
 Der schwedische Schriftsteller Per Olov Enquist, dessen autobiographischer Roman "Ett annat liv" (dt. Titel: "Ein anderes Leben") kürzlich in Ungarn erschienen ist, hat den diesjährigen "Großen Preis von Budapest" des internationalen Buchfestivals erhalten. Sein ungarischer Kollege Peter Esterhazy schreibt in seiner Laudatio auf Enquist: "Ich glaube, dieser Buchfestival-Preis ist der einzige Preis bei uns, der auch einem ausländischen Autor verliehen werden kann. Es ist wichtig, dass es solch einen Preis gibt, um durch ihn am Rest der Welt andocken zu können. Wir können den preisgekrönten großen Schriftstellern, in diesem Fall also Per Olov Enquist, dankbar sein, und nicht etwa, weil dadurch meistens eine berühmte Persönlichkeit nach Ungarn kommt, ... sondern weil jener europäische oder globale Zusammenhang, den sie und ihre Bücher darstellen, uns Gelegenheit bietet, über 'unseren Platz in der Welt' nachzudenken. Wir neigen nämlich dazu, uns selbst zu isolieren und - wie es [der Dichter und Verleger] Gabor Csordas kürzlich ausdrückte - die Dinge der Welt im Kontext unserer Kultur zu interpretieren, statt die eigenen Dinge im Kontext der Welt. Und das ist nicht in erster Linie eine Frage der Sprache. Dies scheint immer aktueller zu werden: Was ist die Liebe zur Provinz und was ist Provinzialität, also Angst, Lüge, Minderwertigkeitskomplexe und womit werden diese verschleiert? Aggressivität, Großtuerei, Brutalität."
Der schwedische Schriftsteller Per Olov Enquist, dessen autobiographischer Roman "Ett annat liv" (dt. Titel: "Ein anderes Leben") kürzlich in Ungarn erschienen ist, hat den diesjährigen "Großen Preis von Budapest" des internationalen Buchfestivals erhalten. Sein ungarischer Kollege Peter Esterhazy schreibt in seiner Laudatio auf Enquist: "Ich glaube, dieser Buchfestival-Preis ist der einzige Preis bei uns, der auch einem ausländischen Autor verliehen werden kann. Es ist wichtig, dass es solch einen Preis gibt, um durch ihn am Rest der Welt andocken zu können. Wir können den preisgekrönten großen Schriftstellern, in diesem Fall also Per Olov Enquist, dankbar sein, und nicht etwa, weil dadurch meistens eine berühmte Persönlichkeit nach Ungarn kommt, ... sondern weil jener europäische oder globale Zusammenhang, den sie und ihre Bücher darstellen, uns Gelegenheit bietet, über 'unseren Platz in der Welt' nachzudenken. Wir neigen nämlich dazu, uns selbst zu isolieren und - wie es [der Dichter und Verleger] Gabor Csordas kürzlich ausdrückte - die Dinge der Welt im Kontext unserer Kultur zu interpretieren, statt die eigenen Dinge im Kontext der Welt. Und das ist nicht in erster Linie eine Frage der Sprache. Dies scheint immer aktueller zu werden: Was ist die Liebe zur Provinz und was ist Provinzialität, also Angst, Lüge, Minderwertigkeitskomplexe und womit werden diese verschleiert? Aggressivität, Großtuerei, Brutalität."Poets & Writers (USA), 18.04.2011
 Die PR-Frau Lauren Cerand ermuntert Schriftsteller, über social media nachzudenken, ohne gleich in eine Web 2.0-Hyperventilation zu vefallen: Nicht jeder Autor braucht einen Youtube-Kanal. Und eins bleibt immer gleich: "Vor einigen Jahren dachte ich, Print sei tot, und die Zukunft liegt in Romanen für Handys. Also fuhr ich nach Japan. Tatsächlich, alle Welt las diese Romane in der U-Bahn, und es gab eine Menge schicke Gadgets auf meiner Reise. Aber was mich am meisten beeindruckte, war, dass die japanische Kultur so viel älter war als meine eigene. Die Moral ist einfach: Bücher ändern sich. Geschichten wird es immer geben."
Die PR-Frau Lauren Cerand ermuntert Schriftsteller, über social media nachzudenken, ohne gleich in eine Web 2.0-Hyperventilation zu vefallen: Nicht jeder Autor braucht einen Youtube-Kanal. Und eins bleibt immer gleich: "Vor einigen Jahren dachte ich, Print sei tot, und die Zukunft liegt in Romanen für Handys. Also fuhr ich nach Japan. Tatsächlich, alle Welt las diese Romane in der U-Bahn, und es gab eine Menge schicke Gadgets auf meiner Reise. Aber was mich am meisten beeindruckte, war, dass die japanische Kultur so viel älter war als meine eigene. Die Moral ist einfach: Bücher ändern sich. Geschichten wird es immer geben."Le Monde (Frankreich), 16.04.2011
Der Regisseur Claude Lanzmann kritisiert das verschleiernde Politikverständnis, das die internationalen Luftschläge gegen Libyen ausdrücklich nicht als "Krieg" verstanden wissen will und entprechend als "Schläge" bezeichnet. "Die Option null Tote duldet keinen Kampf von Mann zu Mann. Man muss verstehen: Ein Schlag, das ist ein Schlag auf den Hintern, ein Hieb, wie man ihn Kindern verpasst. Ein Schlag eben, kein Krieg. Man kann getrost von einer Infantilisierung der Politik sprechen. Auf dem Feld der Schläge oder Hiebe bleiben die Opfer ungezählt und namenlos, sie zählen nicht."
Newsweek (USA), 10.04.2011
 Francis Fukuyama hat ein neues Buch geschrieben "The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution", und damit, schreibt Andrew Bast, der den Politologen in Kalifornien besucht hat, ist Fukuyama, der sich inzwischen von den Neocons entfremdet hat, zu seinen Anfängen zurückgekehrt: Er "überlegt wie die Menschen ihre Stammeskonflikte überwunden und sich in politischen Gesellschaften organisiert haben. 'In der entwickelten Welt halten wir die Existenz von Regierungen für so selbstverständlich, dass wir manchmal vergessen, wie schwierig es war, sie zu schaffen', schreibt er."
Francis Fukuyama hat ein neues Buch geschrieben "The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution", und damit, schreibt Andrew Bast, der den Politologen in Kalifornien besucht hat, ist Fukuyama, der sich inzwischen von den Neocons entfremdet hat, zu seinen Anfängen zurückgekehrt: Er "überlegt wie die Menschen ihre Stammeskonflikte überwunden und sich in politischen Gesellschaften organisiert haben. 'In der entwickelten Welt halten wir die Existenz von Regierungen für so selbstverständlich, dass wir manchmal vergessen, wie schwierig es war, sie zu schaffen', schreibt er."Open Democracy (UK), 18.04.2011
 Syrien ist ein Patchwork aus Konfessionen und ethnischen Minderheiten, schreibt Ali Khan. Was passiert, wenn die herrschende Assad-Familie, die zur Minderheit der Alewiten gehört, weicht? Khan fürchtet eine Situation wie im Libanon: "Iran und die Hisbollah werden den Verlust eines wichtigen regionalen Verbündeten und den Aufstieg einer rein sunnitischen Regierung wittern. Davon abgesehen werden selbst Schiiten, die nicht mit dem Iran verbündet sind, Angst haben, ihren Status zu verlieren. Vor allem die religiösen Schulen um den Sayyida Zainab Schrein in Damaskus fürchten den Moment, in dem die Alewiten die Macht verlieren, schon jetzt. Israel muss sich Sorgen machen, weil es jetzt zumindest über einen Feind verfügt, den es 'kennt' und schwer vorauszusagen ist, ob eine neue Regierung nicht noch antizionistischer ist."
Syrien ist ein Patchwork aus Konfessionen und ethnischen Minderheiten, schreibt Ali Khan. Was passiert, wenn die herrschende Assad-Familie, die zur Minderheit der Alewiten gehört, weicht? Khan fürchtet eine Situation wie im Libanon: "Iran und die Hisbollah werden den Verlust eines wichtigen regionalen Verbündeten und den Aufstieg einer rein sunnitischen Regierung wittern. Davon abgesehen werden selbst Schiiten, die nicht mit dem Iran verbündet sind, Angst haben, ihren Status zu verlieren. Vor allem die religiösen Schulen um den Sayyida Zainab Schrein in Damaskus fürchten den Moment, in dem die Alewiten die Macht verlieren, schon jetzt. Israel muss sich Sorgen machen, weil es jetzt zumindest über einen Feind verfügt, den es 'kennt' und schwer vorauszusagen ist, ob eine neue Regierung nicht noch antizionistischer ist."Außerdem in Opendemocracy.org: Sarah Hurst schreibt über die immer engere Verflechtung zwischen Institutionen und Ureinwohnern in Alaska und Ostsibirien.
Guernica (USA), 18.04.2011
 Nach fast dreißig Jahren Bürgerkrieg ist in Angola der Ölboom ausgebrochen. Scott Johnson berichtet aus dem doppelt verheerten Land, in dem amerikanische Konzerne, chinesische Staatsfirmen und die korrupte Präsidentenfamilie um ihre Anteile am Reichtum streiten. Ein amerikanischer Geschäftsmann schildert ihm das so: "Für sein Haus in Luanda zahlt er 26.000 Dollar Miete, und das ist ein Schnäppchen. Einige kosten 40.000 Dollar. Ein Mietwagen kostet im Monat 14.000 Dollar. Luanda, sagt er, ist die teuerste Hauptstadt der Welt. All das Ölgeld treibt in der Stadt die Gier an. Dieselben Angolaner, die einst diese Ecke Afrikas in ein Schlachtfeld verwandelt hattenen, machen sie nun zu einer der ineffizentesten und krassesten Kleptokratien der Welt. Auch wenn sich die Verschwendung auf jeden Winkel der Industrie erstreckt, wird sie im Ölsektor am deutlichsten. Amerikanische Öltanker, die eine Ladung von gerade aus dem Meer gepumpten Millionen Gallonen Rohöl entladen wollen, müssen für jedenTag, den sie vor einem Hafen warten, exorbitante Gebühren zahlen - manchmal bis zu 80.000 Dollar. Das ist ihnen egal, sagt Jim, sie verdienen so viel Geld, das sind Peanuts für sie. Das könnte sich ändern, fügt er hinzu. Die Angolaner sind gut in Korruption, aber die Chinesen machen sie besser. All die Milliarden-Kredite sind in die Taschen der reichsten Funktionäre geflossen."
Nach fast dreißig Jahren Bürgerkrieg ist in Angola der Ölboom ausgebrochen. Scott Johnson berichtet aus dem doppelt verheerten Land, in dem amerikanische Konzerne, chinesische Staatsfirmen und die korrupte Präsidentenfamilie um ihre Anteile am Reichtum streiten. Ein amerikanischer Geschäftsmann schildert ihm das so: "Für sein Haus in Luanda zahlt er 26.000 Dollar Miete, und das ist ein Schnäppchen. Einige kosten 40.000 Dollar. Ein Mietwagen kostet im Monat 14.000 Dollar. Luanda, sagt er, ist die teuerste Hauptstadt der Welt. All das Ölgeld treibt in der Stadt die Gier an. Dieselben Angolaner, die einst diese Ecke Afrikas in ein Schlachtfeld verwandelt hattenen, machen sie nun zu einer der ineffizentesten und krassesten Kleptokratien der Welt. Auch wenn sich die Verschwendung auf jeden Winkel der Industrie erstreckt, wird sie im Ölsektor am deutlichsten. Amerikanische Öltanker, die eine Ladung von gerade aus dem Meer gepumpten Millionen Gallonen Rohöl entladen wollen, müssen für jedenTag, den sie vor einem Hafen warten, exorbitante Gebühren zahlen - manchmal bis zu 80.000 Dollar. Das ist ihnen egal, sagt Jim, sie verdienen so viel Geld, das sind Peanuts für sie. Das könnte sich ändern, fügt er hinzu. Die Angolaner sind gut in Korruption, aber die Chinesen machen sie besser. All die Milliarden-Kredite sind in die Taschen der reichsten Funktionäre geflossen."Außerdem unterhält sich Bill Moyers mit dem Drehbuchautor David Simon über seine Serie "The Wire" und schreiendes soziales Unrecht, an denen auch der Journalismus nichts geändert hat. Seine Haltung: "Ich würde Drogen sofort entkriminalisieren. Ich würde all das Geld für die Verbote, die Inhaftierungen, die Ermittlungen, die Untersuchungshaft, all dieses Geld würde ich in Drogentherapien stecken, in berufliche Ausbildung und Arbeitsprogramme."
Kommentieren