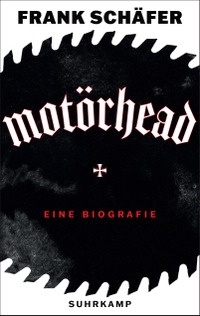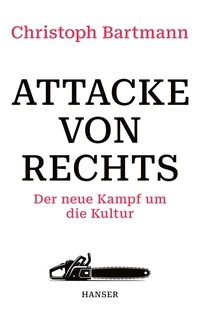Magazinrundschau
Gift ins Brot gemischt
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
30.11.2021. Der New Yorker blickt in die Kerker, in die libysche Milizen für die EU afrikanische Migranten sperren. Die LRB ringt in Delhi nach Luft. Eurozine stellt sich dem Hexenglauben in Papua-Neuguinea entgegen. Elet es Irodalom hofft, dass die ungarische Gesellschaft mit einer neuen Verfassung ihre Souveränität zurückgewinnt. Im Guardian wirft Jill Lepore einen Blick auf die Gesellschaft und zurück schaut ein blasses, übellauniges Wesen, das den ganzen Tag vor dem Bildschirm hockt. Le Monde raubt dem reaktionären Medienmogul Vincent Bolloré das Weihwasser. Und der Filmdienst setzt sich der Vehemenz des frömmelnden Kinos aus.
New Yorker (USA), 06.12.2021
 Ian Urbina folgt afrikanischen Migranten auf ihrem Weg nach Europa, der jedoch immer häufiger in einem Lager endet, das von libyschen Milizen betrieben und von der EU finanziert wird: "In den vergangenen sechs Jahren hat die EU, um den finanziellen und politischen Kosten einer Aufnahme von Migranten aus dem subsaharischen Afrika zu entgehen, ein Schatteneinwanderungssystem geschaffen, das die Menschen abfängt, bevor sie Europa erreichen. Es hat die libysche Küstenwache, eine quasi-militärische Organisation, die mit den Milizen des Landes in Verbindung steht, ausgerüstet und ausgebildet, um das Mittelmeer zu patrouillieren, humanitäre Rettungsaktionen zu sabotieren und Migranten festzusetzen. Die Menschen werden dann auf unbestimmte Zeit in einem Netzwerk von gewinnorientierten Gefängnissen festgehalten, die von den Milizen betrieben werden. Im September dieses Jahres waren dort rund 6.000 Migranten gefangen, viele davon in Al Mabani. Internationale Hilfsorganisationen haben eine Reihe von Misshandlungen dokumentiert: Häftlinge wurden mit Elektroschocks gefoltert, Kinder von Wärtern vergewaltigt, Familien um Lösegeld erpresst, Männer und Frauen in Zwangsarbeit verkauft. 'Die EU hat das viele Jahre lang geplant', so Salah Marghani, libyscher Justizminister von 2012 bis 2014. 'Es ist ein Höllenkreis, der die Menschen von Europa fernhält … Europa hat Libyen lange dazu gedrängt, die Migration einzudämmen. Muammar Gaddafi hat einst den Panafrikanismus angenommen und Afrikaner südlich der Sahara ermutigt, in den Ölfeldern des Landes zu arbeiten. 2008 dann unterzeichnete er mit dem italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi einen 'Freundschaftsvertrag', der ihn zu strengen Kontrollen verpflichtete. Gaddafi nutzte das als Verhandlungsmasse: 2010 drohte er damit, Europa 'schwarz zu machen', sollten die Hilfsgelder der EU ausbleiben. 2011 wurde Gaddafi gestürzt und getötet, Libyen versank im Chaos. Heute konkurrieren zwei Regierungen um die Legitimität: die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung der Nationalen Einheit und eine Regierung mit Sitz in Tobruk, die von Russland und der selbsternannten libyschen Nationalarmee unterstützt wird. Beide verlassen sich auf wechselnde Allianzen mit bewaffneten Milizen, die große Teile des Landes kontrollieren."
Ian Urbina folgt afrikanischen Migranten auf ihrem Weg nach Europa, der jedoch immer häufiger in einem Lager endet, das von libyschen Milizen betrieben und von der EU finanziert wird: "In den vergangenen sechs Jahren hat die EU, um den finanziellen und politischen Kosten einer Aufnahme von Migranten aus dem subsaharischen Afrika zu entgehen, ein Schatteneinwanderungssystem geschaffen, das die Menschen abfängt, bevor sie Europa erreichen. Es hat die libysche Küstenwache, eine quasi-militärische Organisation, die mit den Milizen des Landes in Verbindung steht, ausgerüstet und ausgebildet, um das Mittelmeer zu patrouillieren, humanitäre Rettungsaktionen zu sabotieren und Migranten festzusetzen. Die Menschen werden dann auf unbestimmte Zeit in einem Netzwerk von gewinnorientierten Gefängnissen festgehalten, die von den Milizen betrieben werden. Im September dieses Jahres waren dort rund 6.000 Migranten gefangen, viele davon in Al Mabani. Internationale Hilfsorganisationen haben eine Reihe von Misshandlungen dokumentiert: Häftlinge wurden mit Elektroschocks gefoltert, Kinder von Wärtern vergewaltigt, Familien um Lösegeld erpresst, Männer und Frauen in Zwangsarbeit verkauft. 'Die EU hat das viele Jahre lang geplant', so Salah Marghani, libyscher Justizminister von 2012 bis 2014. 'Es ist ein Höllenkreis, der die Menschen von Europa fernhält … Europa hat Libyen lange dazu gedrängt, die Migration einzudämmen. Muammar Gaddafi hat einst den Panafrikanismus angenommen und Afrikaner südlich der Sahara ermutigt, in den Ölfeldern des Landes zu arbeiten. 2008 dann unterzeichnete er mit dem italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi einen 'Freundschaftsvertrag', der ihn zu strengen Kontrollen verpflichtete. Gaddafi nutzte das als Verhandlungsmasse: 2010 drohte er damit, Europa 'schwarz zu machen', sollten die Hilfsgelder der EU ausbleiben. 2011 wurde Gaddafi gestürzt und getötet, Libyen versank im Chaos. Heute konkurrieren zwei Regierungen um die Legitimität: die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung der Nationalen Einheit und eine Regierung mit Sitz in Tobruk, die von Russland und der selbsternannten libyschen Nationalarmee unterstützt wird. Beide verlassen sich auf wechselnde Allianzen mit bewaffneten Milizen, die große Teile des Landes kontrollieren."Außerdem: Pankay Mishra überlegt, was uns Frantz Fanons postkolonialer Klassiker "Die Verdammten dieser Erde" heute sagen kann. Und Peter Schjeldahl erinnert an die tragende Rolle von Sophie Taeuber-Arp bei der Etablierung der abstrakten Kunst.
Guardian (UK), 29.11.2021
Und der Philosoph Kwame Anthony Appiah schreibt über die Verheerungen, die Corona für den globalen Süden bedeuten: Die Blumenindustrie in Kenia ist ebenso zusammengebrochen wie die Schokoladenernten in Ghana und der Elfenbeinküste. Aber auch gesundheitlich werden die afrikanischen Länder indirekt, aber schwer getroffen werden: "Eine tödliche Gefahr ist Covid vor allem, weil es das Management anderer Krankheiten wie HIV, Malaria und Tuberkulose einschränkt. Allein in Afrika leben 26 Millionen Menschen mit HIV, in einem ganz normalen Jahr sterben mehreren hunderttausend daran, während Malaria, die besonders für Säuglinge und Kleinkinder tödlich ist, annähernd 400.000 Leben fordert... Experten der Öffentliche Gesundheit erwarten als indirekte Folge der Pandemie, dass an Malaria doppelte so viele sterben könnten. An Tuberkulose könnten in den nächsten Jahren zusätzlich 400.000 Menschen sterben, eine halbe Million mehr an HIV. Kurz gesagt, die Reaktionen auf das Coronavirus haben in der ganzen Welt eine Schattenpandemie eingeleitet. Die wahre Todesrate des Coronavirus sollte daher nicht nur die einbeziehen, die an Covid gestorben sind, sondern auch die, deren Sterben an Malaria, TB, HIV oder Diabetes hätte verhindert werden können."
London Review of Books (UK), 02.12.2021
 Jährlich sterben zwischen sieben und zehn Millionen Menschen an Luftverschmutzung, das sind viermal mehr als an Covid, und zwanzigmal mehr als an Krieg, Terror und Mord zusammen, mahnt David Wallace-Wells in einem deprimierenden Artikel. Besonders schlimm ist es in Indien: "Mehrere hundert Millionen Menschen leben und atmen in Städten, deren Luft permanent durch giftige Abgase verunreinigt ist. Im November mussten die Behörden in Delhi Schulen und Universitäten für unbestimmte Zeit schließen, Bauarbeiten einstellen lassen und die Hälfte der Kohlekraftwerke dicht machen, nachdem der Oberste Gerichtshof in Indien Notmaßnahmen gegen den giftigen Smog angeordnet hatte. Dabei war der Smog nicht neu, die Reaktionen waren es. In der ganzen Stadt hängt der Ruß in Büros, Foyers und Wohnungen, selbst in denen mit Luftfiltern. Oft wird er so dick, dass er den Luftverkehr lahmlegt. Selbst den Eisenbahnverkehr hat er unterbrochen, weil die Lokführer durch den Smog hindurch nicht mehr die Gleise erkennen können. Taxifahrer benutzen Anlagen, die den Ruß aus der Luft filtern. Fußgänger können ihm nicht entkommen, was einer der Gründe ist, dass das Leben in Delhi, besonders an Smog-Tagen, dem Rauchen von mehreren Packungen Zigaretten am Tag gleichkommt. Die Stadt jat die höchste Rate an Lungenkrankheiten in der Welt: 60 Prozent der Einwohner, die mit mit COPD diagnostiziert werden, der Chronischen Lungenobstruktion, sind keine Raucher."
Jährlich sterben zwischen sieben und zehn Millionen Menschen an Luftverschmutzung, das sind viermal mehr als an Covid, und zwanzigmal mehr als an Krieg, Terror und Mord zusammen, mahnt David Wallace-Wells in einem deprimierenden Artikel. Besonders schlimm ist es in Indien: "Mehrere hundert Millionen Menschen leben und atmen in Städten, deren Luft permanent durch giftige Abgase verunreinigt ist. Im November mussten die Behörden in Delhi Schulen und Universitäten für unbestimmte Zeit schließen, Bauarbeiten einstellen lassen und die Hälfte der Kohlekraftwerke dicht machen, nachdem der Oberste Gerichtshof in Indien Notmaßnahmen gegen den giftigen Smog angeordnet hatte. Dabei war der Smog nicht neu, die Reaktionen waren es. In der ganzen Stadt hängt der Ruß in Büros, Foyers und Wohnungen, selbst in denen mit Luftfiltern. Oft wird er so dick, dass er den Luftverkehr lahmlegt. Selbst den Eisenbahnverkehr hat er unterbrochen, weil die Lokführer durch den Smog hindurch nicht mehr die Gleise erkennen können. Taxifahrer benutzen Anlagen, die den Ruß aus der Luft filtern. Fußgänger können ihm nicht entkommen, was einer der Gründe ist, dass das Leben in Delhi, besonders an Smog-Tagen, dem Rauchen von mehreren Packungen Zigaretten am Tag gleichkommt. Die Stadt jat die höchste Rate an Lungenkrankheiten in der Welt: 60 Prozent der Einwohner, die mit mit COPD diagnostiziert werden, der Chronischen Lungenobstruktion, sind keine Raucher."Perry Anderson rühmt die moldawische Philosophin und Historikerin Stella Ghervas, die sich mit ihrer europäischen Geschichte "Conquering Peace" in die Gruppe großer osteuropäischer Denker wie Dmitri Furman, Gáspár Tamás, Slavoj Žižek, Jan Zielonka einreihe: "Mit einem Titel von Shakespeare und Bildern von Tiepolo und Max Ernst behabndelt 'Conquering Peace' die verschiedenen Versuchen seit dem 18. Jahrhundert, Europa den Krieg auszutreiben. Für Ghervas waren die Friedensschlüsse, die jeden großen Ausbruch von Feindseligkeiten beendeten, ebenso bedeutsam wie die Konflikte selbst und oft von längerer Dauer. Jeder von ihnen wurde, so Ghervas, von einem bestimmten Zeitgeist inspiriert: Der Frieden von Utrecht 1714 vom Geist der Aufklärung, der Kongress von 1815 vom Geist von Wien; die Gründung des Völkerbundes 1920 vom Geist von Genf; in Europa nach 1945 Geist der Nachkriegsordnung vom Geist der Nachkriegsordnung; und schließlich das Ende des Kalten Krieges seit 1991 vom Geist des erweiterten Europas. All diese Regelungen seien durch einen 'Ariadnefaden' miteinander verbunden, das Streben nach Einheit und Frieden auf dem Kontinent. Ghervas zufolge waren diese Ziele untrennbar miteinander verbunden, auch wenn bei weitem nicht alle Akteure diese Sicht teilten. Dagegen standen die aufeinander folgenden Bestrebungen verschiedener Despotien - bourbonisch, napoleonisch, wilhelminisch, nationalsozialistisch, sowjetisch - nach einem universellen Imperium in Europa. Eine Periodisierung der Geschichte des Kontinents als Abfolge von Ideen, die seine langfristige Entwicklung bestimmen, kann kaum vermeiden, in den Verdacht des Idealismus zu geraten - nicht nur im moralischen Sinne des Begriffs, sondern in seiner philosophischen Bedeutung, deren Gegenteil der Realismus ist."
Le Monde (Frankreich), 16.11.2021
Wer diesen Artikel liest, wird ernste Zweifel an der demokratischen Zukunft Frankreichs bekommen. Frankreich war schon immer ein Museum politischer Strömungen: Bis vor kurzem gab es drei trotzkistische Parteien, zwei monarchistische Strömungen (Legitimisten und Orleanisten) und auch noch ein paar Bonapartisten unterschiedlicher Couleur. Und selbstverständlich gibt es noch die von Balzac besungene superreaktionäre katholische Tradition in der Bretagne (die mehrheitlich heute sehr viel moderner ist). In dieser fundamentalistisch-katholischen Tradition steht Vincent Bolloré, einer der reichsten Männer Frankreichs, den Raphaëlle Bacqué und Ariane Chemin in einem epischen Artkel für Le Monde porträtieren. Bolloré ist größter Aktionär des Vivendi-Konzerns und besitzt die halbe französische Medienlandschaft von Buchverlagen über Canal Plus bis zu "Info"-Sendern wie CNews, wo er Eric Zemmour groß machte. Bolloré verhinderte, dass Canal Plus einen Film von François Ozon über Missbrauch in der Katholischen Kirche kaufte (er lief auf der Berlinale, mehr hier) und er hasst Charlie Hebdo wie sonst nur woke Linke, die er natürlich auch hasst. Er hofft, dass Zemmour im Bündnis mit der gemäßigten Rechten den Elysée-Palast erobert, "mit einem Köhlerglauben inklusive frommen Bildchen in seinem Portemonnaie und einem bretonischen Synkretismus , der zwischen keltischer Tradition und Marienverehrung schwankt. Die Devise der Familie ist seit 1789 gleichgeblieben: 'Auf den Knien vor Gott, aufrecht vor den Menschen.' Da er abergläubisch ist, hat er stets eine kleine Marienstatue in Reichweite und trägt Fläschchen mit Weihwasser aus Lourdes mit sich herum, wo er einmal jährlich hinpilgert..."
Elet es Irodalom (Ungarn), 30.11.2021
 Seit mehreren Wochen diskutiert die ungarische Opposition, wie sie überhaupt das Land regieren könnte, da Viktor Orban und seine Fidesz-Partei mit einem Grundgesetz dafür gesorgt haben, dass etliche Gesetze, aber auch die personelle Zusammensetzung von Behörden und Institutionen nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden können. Was könnte eine künftige Mehrheit tun: Es bei der Eliminierung einzelne Paragraphen belassen oder das gesamte Grundgesetz aufheben? Der Jurist und Ökonom Péter Róna argumentiert, dass das aktuelle Grundgesetz weder historisch noch rechtlich eine Verfassung darstellt, und schreibt: "Es könnte sein, dass der Neoabsolutismus von Viktor Orbán eine Antwort auf die Modernisierungskrise der ungarischen Gesellschaft war wie die absolutistischen Monarchien eine Antwort auf den westeuropäischen Feudalismus waren. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied: Während die absolutistischen Herrscher die Autonomie der Zivilgesellschaft, die auf Regeln aufbauende Bürokratie, die Entwicklung der Technologien und die gesellschaftliche Mobilität vorantrieben (noblesse de robe), betrachtet Orbán die Aufhebung der Zivilgesellschaft, die Zerschlagung der öffentlichen Verwaltung und das Einfrieren der gesellschaftlichen Mobilität als seine Mission, also in ihrer Gänze den Aufbau einer Machtkonstruktion östlichen Typs, bei der die übertriebene Idee der nationalen Souveränität den gesellschaftlichen Fortschritt verhindert. Die Überwindung dieser Konstruktion ist der bevorstehende politische und historische Spieleinsatz. Die große Frage ist somit, ob die ungarische Gesellschaft soweit ist, dass sie eine vertragliche Einrichtung gegenüber der Macht einfordert, ob sie überhaupt eine ehrliche Verfassung will, oder ob sie ihre eigene Tilgung aus der Kontrolle der Macht akzeptiert. Wenn sie bereit ist, dann wird es den Vertrag in Form einer neuen Verfassung geben. Wenn nicht, dann ist alles gleich."
Seit mehreren Wochen diskutiert die ungarische Opposition, wie sie überhaupt das Land regieren könnte, da Viktor Orban und seine Fidesz-Partei mit einem Grundgesetz dafür gesorgt haben, dass etliche Gesetze, aber auch die personelle Zusammensetzung von Behörden und Institutionen nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden können. Was könnte eine künftige Mehrheit tun: Es bei der Eliminierung einzelne Paragraphen belassen oder das gesamte Grundgesetz aufheben? Der Jurist und Ökonom Péter Róna argumentiert, dass das aktuelle Grundgesetz weder historisch noch rechtlich eine Verfassung darstellt, und schreibt: "Es könnte sein, dass der Neoabsolutismus von Viktor Orbán eine Antwort auf die Modernisierungskrise der ungarischen Gesellschaft war wie die absolutistischen Monarchien eine Antwort auf den westeuropäischen Feudalismus waren. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied: Während die absolutistischen Herrscher die Autonomie der Zivilgesellschaft, die auf Regeln aufbauende Bürokratie, die Entwicklung der Technologien und die gesellschaftliche Mobilität vorantrieben (noblesse de robe), betrachtet Orbán die Aufhebung der Zivilgesellschaft, die Zerschlagung der öffentlichen Verwaltung und das Einfrieren der gesellschaftlichen Mobilität als seine Mission, also in ihrer Gänze den Aufbau einer Machtkonstruktion östlichen Typs, bei der die übertriebene Idee der nationalen Souveränität den gesellschaftlichen Fortschritt verhindert. Die Überwindung dieser Konstruktion ist der bevorstehende politische und historische Spieleinsatz. Die große Frage ist somit, ob die ungarische Gesellschaft soweit ist, dass sie eine vertragliche Einrichtung gegenüber der Macht einfordert, ob sie überhaupt eine ehrliche Verfassung will, oder ob sie ihre eigene Tilgung aus der Kontrolle der Macht akzeptiert. Wenn sie bereit ist, dann wird es den Vertrag in Form einer neuen Verfassung geben. Wenn nicht, dann ist alles gleich."Respekt (Tschechien), 28.11.2021
 Tschechien befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Deutschland - die neue Regierung ist noch nicht im Amt, die Infektionszahlen sind hoch und die Debatte über eine Impfpflicht kocht hoch. Erik Tabery erkennt in der tschechischen Coronakrise eine generelle Vertrauenskrise: "So oft haben wir (und andere) es schon geschrieben: Eine moderne demokratische Gesellschaft kann nur auf der Basis eines grundlegenden Vertrauens funktionieren. Und das geht verloren. Das kann in gewisser Hinsicht fatal sein, denn wenn man es zu Ende denkt, kann man ohne ein gewisses Vertrauen rein gar nichts machen. Wer garantiert einem, dass keiner Gift in das Brot gemischt hat, das man einkauft? Dass die Medikamente gegen Bluthochdruck, gegen Erektions- oder Herzprobleme nicht einen Zusatzstoff erhalten, der uns in zehn Jahren die Gesundheit ruiniert? Wir steigen schließlich auch in einen Autobus, ohne den Chauffeur und seine Fahrfähigkeiten zu kennen, wissen nicht, was er gestern getrunken oder ob er eine Depression hat … Das Interessante ist, je sicherer unsere Alltagswelt ist, desto größere Ängste und umso geringeres Vertrauen haben viele. Wir müssen uns darauf einstellen, dass ein hohes Maß an Misstrauen einige Zeit lang Bestandteil unseres öffentlichen Lebens sein wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dies nach der Pandemie abklingt. Das Misstrauen wird sich nur ein anderes Thema suchen."
Tschechien befindet sich in einer ähnlichen Situation wie Deutschland - die neue Regierung ist noch nicht im Amt, die Infektionszahlen sind hoch und die Debatte über eine Impfpflicht kocht hoch. Erik Tabery erkennt in der tschechischen Coronakrise eine generelle Vertrauenskrise: "So oft haben wir (und andere) es schon geschrieben: Eine moderne demokratische Gesellschaft kann nur auf der Basis eines grundlegenden Vertrauens funktionieren. Und das geht verloren. Das kann in gewisser Hinsicht fatal sein, denn wenn man es zu Ende denkt, kann man ohne ein gewisses Vertrauen rein gar nichts machen. Wer garantiert einem, dass keiner Gift in das Brot gemischt hat, das man einkauft? Dass die Medikamente gegen Bluthochdruck, gegen Erektions- oder Herzprobleme nicht einen Zusatzstoff erhalten, der uns in zehn Jahren die Gesundheit ruiniert? Wir steigen schließlich auch in einen Autobus, ohne den Chauffeur und seine Fahrfähigkeiten zu kennen, wissen nicht, was er gestern getrunken oder ob er eine Depression hat … Das Interessante ist, je sicherer unsere Alltagswelt ist, desto größere Ängste und umso geringeres Vertrauen haben viele. Wir müssen uns darauf einstellen, dass ein hohes Maß an Misstrauen einige Zeit lang Bestandteil unseres öffentlichen Lebens sein wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dies nach der Pandemie abklingt. Das Misstrauen wird sich nur ein anderes Thema suchen."Eurozine (Österreich), 29.11.2021
 In einem Artikel aus The New Humanist erinnert Miranda Forsyth daran, dass in etlichen Ländern der Welt der Vorwurf der Hexerei noch immer Tausende von Opfern fordert: Das Witchcraft and Human Rights Information Network listet für die vergangenen zehn Jahre 5.250 Morde und 14.700 Mordversuche auf, vor allem in Papua-Neuguinea, Indien und afrikanischen Ländern. Was dagegen tun? "Ein erster Schritt muss ein besseres Verständnis sein. So wird beispielsweise oft angenommen, dass die Hauptopfer von Hexenjagden marginalisierte Frauen sind, während es in Wirklichkeit viele Kategorien von Opfern gibt. In Papua-Neuguinea sind Frauen und Mädchen in den Highlands die Hauptopfer, während in Bougainville eher Männer angeklagt werden. In manchen Gegenden ist es der 'Poisenman', der seine Zauberkraft ausübt, indem er Substanzen in weggeworfene Haare oder Fingernägel einstreut, während in anderen Gegenden eine 'Sanguma' ('Hexe') dafür bekannt ist, das Herz ihres Opfers zu 'essen'. Wie ein Virus mutieren diese Erzählungen, um sich an neue Bedingungen anzupassen, wie die wachsende Zahl von Geschichten über 'Sanguma', die Mobiltelefone benutzen, zeigt. Die Armen und Ausgegrenzten sind oft das Ziel, aber auch die wirtschaftliche oder politische Elite. Der Vorwurf der Hexerei kann ein sehr wirksames Instrument der Machtlosen sein, da es schwierig ist, sich dagegen zu wehren."
In einem Artikel aus The New Humanist erinnert Miranda Forsyth daran, dass in etlichen Ländern der Welt der Vorwurf der Hexerei noch immer Tausende von Opfern fordert: Das Witchcraft and Human Rights Information Network listet für die vergangenen zehn Jahre 5.250 Morde und 14.700 Mordversuche auf, vor allem in Papua-Neuguinea, Indien und afrikanischen Ländern. Was dagegen tun? "Ein erster Schritt muss ein besseres Verständnis sein. So wird beispielsweise oft angenommen, dass die Hauptopfer von Hexenjagden marginalisierte Frauen sind, während es in Wirklichkeit viele Kategorien von Opfern gibt. In Papua-Neuguinea sind Frauen und Mädchen in den Highlands die Hauptopfer, während in Bougainville eher Männer angeklagt werden. In manchen Gegenden ist es der 'Poisenman', der seine Zauberkraft ausübt, indem er Substanzen in weggeworfene Haare oder Fingernägel einstreut, während in anderen Gegenden eine 'Sanguma' ('Hexe') dafür bekannt ist, das Herz ihres Opfers zu 'essen'. Wie ein Virus mutieren diese Erzählungen, um sich an neue Bedingungen anzupassen, wie die wachsende Zahl von Geschichten über 'Sanguma', die Mobiltelefone benutzen, zeigt. Die Armen und Ausgegrenzten sind oft das Ziel, aber auch die wirtschaftliche oder politische Elite. Der Vorwurf der Hexerei kann ein sehr wirksames Instrument der Machtlosen sein, da es schwierig ist, sich dagegen zu wehren."Magyar Narancs (Ungarn), 24.11.2021
 Der Verleger und Literaturhistoriker Krisztián Nyáry glaubt nicht daran, dass Interventionen des Staates auf dem Büchermarkt funktionieren können: "Wenn es keinen Leser gibt, dann lohnt es sich nicht. Auch bei unseren Verlagen kommt es manchmal vor, dass ein äußerer Akteur eine erhebliche Zuwendung verspricht, wenn wir ein Buch veröffentlichen, was wir ablehnen. In solchen Fällen sagen wir nicht nur aus moralischen, sondern auch aus geschäftlichen Gründen und Prinzipien Nein. Der Wert eines Verlages ergibt sich aus seinen Autoren und wenn wir einen aus welchen Gründen auch immer unpassenden Autor veröffentlichten, würden wir mehr verlieren, denn die Marke wäre beschädigt. Ich denke, dass auch aus diesem Grunde die Politik nicht in den durch die Verlage bestimmten Kanon eingreifen könnte, weil ein Verlag als Produkt nicht greifbar ist: Es ist ein Konglomerat aus Autoren, Lesern und den in langer Zeit entstandenen Traditionen. Natürlich könnte man sich mit Geld in einen Verlag einkaufen, doch dies verändert das Angebot, die Leser gehen und der Verlag wäre am Ende."
Der Verleger und Literaturhistoriker Krisztián Nyáry glaubt nicht daran, dass Interventionen des Staates auf dem Büchermarkt funktionieren können: "Wenn es keinen Leser gibt, dann lohnt es sich nicht. Auch bei unseren Verlagen kommt es manchmal vor, dass ein äußerer Akteur eine erhebliche Zuwendung verspricht, wenn wir ein Buch veröffentlichen, was wir ablehnen. In solchen Fällen sagen wir nicht nur aus moralischen, sondern auch aus geschäftlichen Gründen und Prinzipien Nein. Der Wert eines Verlages ergibt sich aus seinen Autoren und wenn wir einen aus welchen Gründen auch immer unpassenden Autor veröffentlichten, würden wir mehr verlieren, denn die Marke wäre beschädigt. Ich denke, dass auch aus diesem Grunde die Politik nicht in den durch die Verlage bestimmten Kanon eingreifen könnte, weil ein Verlag als Produkt nicht greifbar ist: Es ist ein Konglomerat aus Autoren, Lesern und den in langer Zeit entstandenen Traditionen. Natürlich könnte man sich mit Geld in einen Verlag einkaufen, doch dies verändert das Angebot, die Leser gehen und der Verlag wäre am Ende."Film-Dienst (Deutschland), 27.11.2021
 In Deutschland spielen die sogenannten "faith based movies" kaum eine nennenswerte Rolle, in den USA bilden diese auf ein gläubiges Publikum zugeschnittenen Filme mittlerweile ein ziemlich lukratives Segment im mittleren Sektor der Produktion, das außerhalb frommer Zusammenhänge allerdings kaum wahrgenommen wird. Für den katholischen Filmdienst hat Martin Ostermann einen Blick in diese Welt geworfen. Gesehen hat er als Tatsachenberichte dargereichte Filme über "die Kraft des Glaubens", in der Dinge geschehen, die man als Wunder auffassen könnte. Übel stößt ihm allerdings die frömmelnde Vehemenz dieser Filme auf: "Die Inszenierung lässt keinen Spielraum für alternative Deutungen des Geschehens. Wer dennoch bestreitet, dass die Ursache der Rettung beziehungsweise Heilung der feste Glaube und ein durch Gott gewirktes Wunder war, wird als entweder blind oder mindestens gefühlskalt dargestellt. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, was eigentlich ein Wunder im christlichen Sinne ist, wird vom Film nicht ermöglicht ... Diese fehlende Vermittlung zwischen Glaubenden und nicht Glaubenden - die in einer pluralen Gesellschaft unbedingt notwendig wäre - kann sogar noch dadurch verstärkt werden, dass andere Haltungen als fehlerhaft oder sogar schädlich verstanden werden, es also zu einer direkten Entgegensetzung kommt. ... Die Art und Weise der Darstellung dieser christlichen Inhalte ist aber nicht nur ein formaler Rückfall in die mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Zeiten der biblischen Monumentalfilme; er wirkt vor allem wie eine Weigerung, sich in einer pluralen Gesellschaft mit kritischen Anfragen an den Glauben und an die biblischen Quellen auseinanderzusetzen."
In Deutschland spielen die sogenannten "faith based movies" kaum eine nennenswerte Rolle, in den USA bilden diese auf ein gläubiges Publikum zugeschnittenen Filme mittlerweile ein ziemlich lukratives Segment im mittleren Sektor der Produktion, das außerhalb frommer Zusammenhänge allerdings kaum wahrgenommen wird. Für den katholischen Filmdienst hat Martin Ostermann einen Blick in diese Welt geworfen. Gesehen hat er als Tatsachenberichte dargereichte Filme über "die Kraft des Glaubens", in der Dinge geschehen, die man als Wunder auffassen könnte. Übel stößt ihm allerdings die frömmelnde Vehemenz dieser Filme auf: "Die Inszenierung lässt keinen Spielraum für alternative Deutungen des Geschehens. Wer dennoch bestreitet, dass die Ursache der Rettung beziehungsweise Heilung der feste Glaube und ein durch Gott gewirktes Wunder war, wird als entweder blind oder mindestens gefühlskalt dargestellt. Eine Auseinandersetzung mit der Frage, was eigentlich ein Wunder im christlichen Sinne ist, wird vom Film nicht ermöglicht ... Diese fehlende Vermittlung zwischen Glaubenden und nicht Glaubenden - die in einer pluralen Gesellschaft unbedingt notwendig wäre - kann sogar noch dadurch verstärkt werden, dass andere Haltungen als fehlerhaft oder sogar schädlich verstanden werden, es also zu einer direkten Entgegensetzung kommt. ... Die Art und Weise der Darstellung dieser christlichen Inhalte ist aber nicht nur ein formaler Rückfall in die mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegenden Zeiten der biblischen Monumentalfilme; er wirkt vor allem wie eine Weigerung, sich in einer pluralen Gesellschaft mit kritischen Anfragen an den Glauben und an die biblischen Quellen auseinanderzusetzen."
Kommentieren