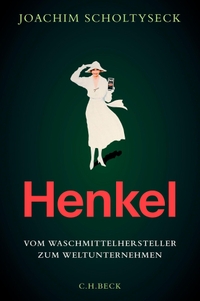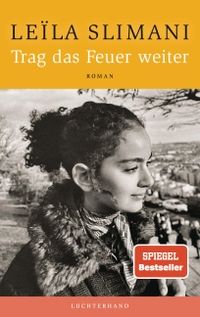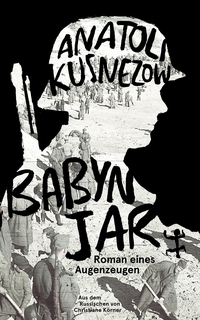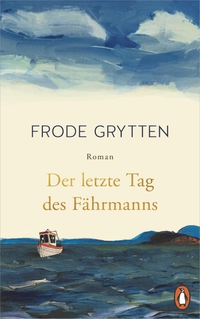9punkt - Die Debattenrundschau
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
Februar 2018
28.02.2018. In der New York Times schreibt der Journalist Ahmet Altan, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, über den Schock, den ein solches Urteil auslöst. Der Stern und andere Medien gehen dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak nach: Möglicherweise hatte er Beziehungen zwischen Politikern und der 'Ndrangheta offengelegt. Für Bestürzung sorgt in Frankreich ein Blogeintrag Jean-Luc Mélenchons über die "Systemeffekte" der "Medienpartei". In konkret will der Impresario und Medienkritiker Berthold Seliger nicht einfach den Status quo bei den Öffentlich-Rechtlichen verteidigen.
27.02.2018. Entsetzen herrscht in der Slowakei und in europäischen Medien über die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und seiner Freundin. Laut Bund macht der bekannte slowakische Autor Michal Hvorecky den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico, der gegen Journalisten hetzte, mitverantwortlich. Die New York Times berichtet, wie schwer es Google und Facebook fällt, Verschwörungstheorien gegen Opfer des Massakers von Parkland zu unterbinden. Und im Freitag attackiert Guillaume Paoli die überhebliche taz.
26.02.2018. Die PiS-Partei untergräbt die polnische Demokratie in einer Art und Weise, die man noch gar nicht wahrgenommen hat, warnt das Verfassungsblog: Zum Beispiel sucht sie einen immer direkteren Zugriff auf die Organisation von Wahlen. Politico.eu erklärt, wie sich Jeremy Corbyn den Brexit vorstellt: maßgeschneidert. Was einst die Ideologieabteilung in der KP war, ist unter Putin die orthodoxe Kirche, erklärt die russische Schriftstellerin Elena Chizhova in der NZZ. In Berlin kursiert eine Erklärung "pro Neutralitätsgesetz", die unter anderem von Seyran Ates und Necla Kelek unterzeichnet wurde.
24.02.2018. Doch, der Westen hätte etwas tun können, kommentiert Spiegel online mit Blick auf Ost-Ghuta - Israel hat gezeigt, wie's geht. Die No Billag-Abstimmung in der Schweiz, die vielen in Europa Angst macht, steht bevor: Die taz besucht Florian Maier, den Initiator der Abstimmung über die Rundfunkgebühren. Standard und NZZ blicken sich mit Unbehagen im Superinternet der Dinge um. Würden sich wirklich nochmal britische Soldaten nach Nordirland verschiffen lassen, um dort das Gesetz durchzusetzen, fragt der Guardian.
23.02.2018. Zwischen Gesetzen gegen die Leugnung der Shoah und dem polnischen Holocaust-Gesetz gibt es einen feinen Unterschied - die Meinungsfreiheit, rufen Moshe Zimmermann und Schimon Stein in der Zeit in Richtung Polen. Die NZZ fürchtet, dass China seinen Bürgern den Freiheitsdrang per Genmanipulation entfernt. Die Destabilisierung des Friedens in Nordirland nehmen die Brexiteers als Kollateralschaden gern in Kauf, fürchtet politico. Auf republik.ch wirft Didier Eribon Mark Lilla reaktionären Populismus vor. SZ und FR ahnen, dass die EU in Sachen Digitalisierung den Anschluss verliert.
22.02.2018. Linke Identitätspolitik führt direkt in den Kulturrelativismus, warnt Francis Fukuyama in der NZZ. In der FAZ skizziert Sergej Lebedew anlässlich des Prozesses gegen den Historiker Jurij Dmitrijew die Verwandtschaft der heutigen russischen Machthaber mit den Stalinschen Henkern. Der politische Zerfall der Mittelklasse droht auch die SPD zu zerreißen, warnt in der Zeit der Kultursoziologe Andreas Reckwitz. Die SZ erklärt, warum #metoo in Japan kaum Erfolg hat. Nur in Österreich ist die Stimmung gut, meldet die FAZ.
21.02.2018. Die Syrer bombardieren gemeinsam mit ihren russischen Hintermännern Ost-Ghuta. Humanitäre Appelle lassen sie verhallen. Zivilisten sterben zu Hunderten. Der Guardian vergleicht das Geschehen mit Srebrenica. Die Washington Post bringt Bilder. In der NZZ beharrt Steven Pinker auf den Vorteilen der Aufklärung. Im Deutschlandfunk erzählt der Historiker David Motadel von der Sympathie der Nazis für den Islam. In der Welt erinnert Alan Posener an den jüdischen Beitrag zu 1968.
20.02.2018. Facebook wehrt sich gegen den Vorwurf, die Russen hätten über seinen Dienst die amerikanischen Wahlen manipuliert - und entschuldigt sich dann beim FBI, berichten New York Times und Wired. In der FR begibt sich Bernhard Pörksen auf die Spur der "großen Gereiztheit". Die FAZ staunt über die Staatsferne der ARD-Offiziellen. In der Welt plädiert die Museumsdirektorin Nanette Snoep für "transkulturelle" statt ethnologischer Museen. Und die Briten warnen bei politico.eu: Wenn sie keinen Freihandelsdeal bekommen, zahlen sie nicht.
19.02.2018. Der Satz des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, es hätte auch jüdische Täter im Holocaust gegeben, empört unter anderem taz und Welt. Im Weekly Standard erklärt Steven Pinker, warum Identitätspolitik nicht aufgeklärt ist. In der NZZ zieht Ivan Krastev eine Parallele zwischen der liberalen Revolution in Osteuropa 1989 und heutigen Migrationsbewegungen. Wenn das Buch verschwindet, verschwindet auch die Wahrheit, fürchtet Florian Felix Weyh in seinem Dlf-Essay,
17.02.2018. Deniz Yücel ist frei - aber das zeigt auch noch einmal, wie unfrei die türkische Justiz ist, sagt Can Dündar in Zeit online. "Atemberaubend" nennt die New York Times nach einer FBI-Anklage das Ausmaß und die Raffinesse russischer Einflussnahme im amerikanischen Wahkampf. Wieviel Chancen gibt es auf eine muslimische Demokratie, nachdem selbst Indonesien im schwarzen Loch des Islamismus verschwindet, fragt Marco Stahlhut in der FAZ. Die Basler Zeitung erkundet antisemitische Tendenzen in der Labour-Partei. Und Sibylle Lewitscharoff sagt in der NZZ, auch wenn sie an Jacob Taubes denkt, nicht #MeToo.
16.02.2018. Die AfD wird immer unflätiger und fühlt sich dabei immer besser. Die klassischen Parteien haben kaum ein Mittel, diese Blase zu durchstechen, analysiert Richard Volkmann bei den Salonkolumnisten. Politico.eu stellt die italienische Zentrumspolitikerin Beatrice Lorenzin vor, die mit einer neuen Partei gegen die Impfgegner in den populistischen Parteien kämpft. In Frankreich organisieren muslimische Organisationen eine Soli-Kampagne für Tariq Ramadan, berichtet Libération. Und: Herfried Münkler gibt in der NZZ und Welt Auskunft über den aktuellen Stand der Kriegsführung.
15.02.2018. Steven Pinker in der SZ und Bernhard Pörksen in der NZZ diagnostizieren im Blick auf die Debatte in den Demokratien eine "große Gereiztheit". Liegt's am Internet oder an der Wiederkehr der Romantik? Die katholische Kirche in Deutschland ist in Finanzskandale verstrickt, konstatiert die FAZ - Aber der Theologe Jan-Heiner Tück hat in derselben Zeitung nur eine Sorge: In Unis zu lehren, in denen kein Kreuz im Hörsaal hängt. In der NZZ prangert Roseann Rife von Amnesty International die Unterdrückung der Uiguren durch China an.
14.02.2018. Deniz Yücel ist heute seit einem Jahr in türkischer Haft. Nach neuesten Meldungen gibt es jetzt Hoffnung, dass er freigelassen wird. Sein Fall hat Aufmerksamkeit für die Lage aller drangsaliserten Journalisten in der Türkei geschaffen, meint Georg Löwisch in der taz. In der SZ macht sich Aleida Assmann Sorgen um die Zukunft der Erinnerung in Deutschland. Im Guardian geht Natalie Nougayrède einen Schritt weiter und fordert eine europäische Erinnerungskultur. Der Berliner Integrationsbeauftragte Andreas Germershausen erklärt in der taz, dass er sich als politischen Repräsentanten der muslimischen Verbände ansieht - auch in der Kopftuchfrage.
13.02.2018. In der SZ schimpft Ronald Lauder über deutsche Bräsigkeit bei der Restitution geraubter Kunst. In Großbritannien und Frankreich gibt es Debatten über das koloniale Erbe - unter anderem entzaubern Alain Mabanckou und Achille Mbembe im NouvelObs die Idee der "Frankophonie". In der Berliner Zeitung findet Götz Aly deutliche Worte: "Wenn es in Deutschland heute eine versiffte Ekelecke gibt, dann in der AfD." Und warum glaubten alle Journalisten unisono an Martin Schulz, fragt Hans-Martin Tillack im Stern.
12.02.2018. In der NZZ beklagt Hans Ulrich Gumbrecht das Verschwinden der Zukunft und das Schrumpfen der Gegenwart in der heutigen Politik. Die SZ schildert den Putin-Kult in Russland, in der FAZ warnen drei Politologen vor der "Soft Power" Chinas und Russland, die in Wahrheit eine "Sharp Power" sei. China beweist es, indem es den Hongkonger Buchhändler Gui Minhai zu Videogeständnissen zwingt, berichtet die taz. Und außerdem hat die FAZ die FR verkauft.
10.02.2018. Seit einem Jahr sitzt Deniz Yücel ohne Aklage in der Türkei in Haft, die taz bringt seine Texte aus dem Gefängnis. Wo sind die lockenden Kühe?, fragt die Berliner Zeitung die traurigen Matadore in der SPD-Arena. Der Tagesspiegel blickt nach Frankreich, von wo ihm eine ausgemergelte Vogelscheuche winkt. Die FAZ beobachtet beschämt die Kotaus des Dieter Zetsche vor Pekings Machthabern. Und der Guardian steht ratlos vor dem nordirischen Trilemma.
09.02.2018. Die Welt wirbt um Verständnis für polnische Empfindlichkeiten in der Bewältigung der Vergangenheit. NZZ und SZ fragen, wie künftig mit dem Erbe des Kolonialismus umzugehen sei. Focus online meldet, dass die AfD einen eigenen Newsroom aufmachen und die sozialen Medien mit ihren Inhalten bespielen will - mit zwanzig Redakteuren 24 Stunden am Tag und in den Räumen der Bundestagsfraktion. Recode.net freut sich: Die Digitalstrategie der New York Times geht auf, alle wollen sie abonnieren.
08.02.2018. Zwei Jahre nach dem Putsch ist in der Türkei die Luft raus, der Feldzug gegen Afrin geschieht auch aus Populismus, konstatiert Bülent Mumay in der FAZ. Die taz kritisiert die EU-Politik im Westbalkan: Warum schreitet sie nicht gegen die Nationalisten ein? Und warum bestimmen Transhumanisten über Künstliche Intelligenz, fragt der Kultursoziologe Thomas Wagner in der NZZ. In der Welt sieht Tilman Krause Theodor W. Adorno als Vater der policitcal correctness.
07.02.2018. In der taz ruft Waris Dirie, Aktivistin gegen Genitalverstümmelung, die #MeToo-Bewegung zu Solidarität mit afrikanischen Frauen auf. Die SZ berichtet über den Hongkonger Verleger Gui Minhai, der zum wiederholten Mal von chinesischen Behörden verschleppt wurde. Krise des Lesens? Rüdiger Wischenbart erinnert die Buchbranche im Perlentaucher an ihre Ursprünge in der Massenkultur. Politico.eu beleuchtet die Fremdenfeindlichkeit in Italien. Und die NZZ fragt: Was soll eigentlich die "konservative Revolution" sein?
06.02.2018. Die Historikerin Marci Shore zeichnet für die New York Times ein Psychogramm der polnischen Geschichtspolitik. Die taz kommt im Buch eines ehemaligen britischen Diplomaten der Logik der Brexiteers auf die Spur. Politico.eu schildert einen portugiesischen Streit über die Rolle der Stadt Lissabon im Sklavenhandel. In der FR skizziert der Historiker John Röhl Kaiser Wilhelm II. als ziemlich armes Würstchen. Und Le Monde fragt: Ist Galanterie feministisch?
05.02.2018. Wer sind die Frauen, die sich im Iran auf Stromkästen stellen und ihr Kopftuch wie eine Fahne schwenken, fragt die New York Times. Slavoj Zizek in der NZZ und Oliver Nachtwey in Zeit online suchen nach Alternativen zum Kapitalismus. Karl Marx war gar nicht mal so religionskritisch, meint Gerd Koenen in Christ und Welt. Im Tagesspiegel klagt Herfried Münkler mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen: "Es setzt sich eine Konsumentenhaltung gegenüber der Politik durch."
03.02.2018. Tariq Ramadan ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Untersuchungshaft. Die französische Vanity Fair bringt eine große Reportage zu den Vorwürfen. In der NZZ denkt Pascal Bruckner über die Zwiespältigkeit des kolonialen Erbes nach. Könnten die Iraner abstimmen, würden siebzig Prozent gegen das Mullah-Regime votieren, schreibt der Politologe Ali Fathollah-Nejad in der taz. Ohne 68 keine Hartz-4-Reformen, meint Heinz Bude in der Welt. Und: Die Berliner Mauer ist genau so lange gefallen, wie sie einst stand!
02.02.2018. Polen befindet sich auf dem Weg in einen Kulturkampf, konstatieren Zeit online und FR nach den neuesten Volten der polnischen Geschichtspolitik. Der Guardian schreibt Theresa May die Rede, die sie halten sollte - und die auf die "Norwegen-Option" hinausliefe. Die SZ schildert die terminatorische Zensur- und Überwachungspolitik Chinas. Das Europäische Leistungsschutzrecht und Upload-Filter sind in der EU auf einem traurigen Weg zur Verwirklichung, fürchtet Netzpolitik.
01.02.2018. Alles was nicht gezeigt wird: Im Tagesspiegel erklärt die Lehrerin Fereshta Ludin, die gegen das Neutralitätsgesetz in Berlin klagte, dass sie ihre Haare nicht aus religiösen Gründen nicht zeigt. Und die Bundesregierung macht zum Entsetzen der SZ eine Helmut-Schmidt-Gedenkmünze, die auch etwas nicht zeigt. Die NZZ bringt ein Pro und Kontra zu No Billag. Und glaubten die 68er ernstlich an 68?, fragt Heinz Bude in der FR.