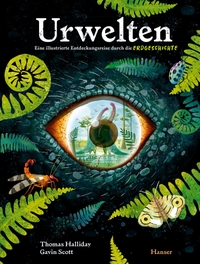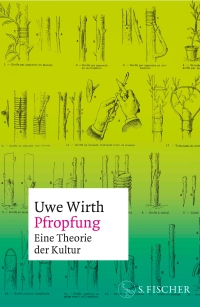Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
24.03.2003. Die Lettre schildert die Wiederkehr der Zauberer in Afrika. In der NY Review of Books erzählt Tim Judah, warum die Kurden keine Angst vor den Irakern haben. In Atlantic Monthly stellt Robert D. Kaplan die nächsten beiden Ziele im Krieg gegen den Terror vor: Eritrea und Jemen. Literaturen erklärt, wie man nicht über Sex schreiben sollte. Prospect diskutiert die Demokratiefähigkeit arabischer Staaten. Der New Yorker erklärt, wie Washington und London einen gefälschten Bericht über das irakische Atomwaffenprogramm lanciert haben. Der Economist sieht mit dem Irakkrieg Nuclear-Möchtegerne gewarnt. In der London Review of Books empfiehlt Edward Said eine Studie über britischen Kolonialismus.
Outlook India (Indien), 31.03.2003
 Bis zuletzt wurde in den Redaktionsstuben der Outlook India der Atem angehalten, die neue Ausgabe musste warten - doch vergeblich. Sie haben es nicht geschafft, die Inder; die "Men in Blue" waren der "Supermacht" erlegen, und die heißt im Cricket Australien. Jetzt, nach der Finalniederlage am Sonntag, fragt sich Sandipan Deb: "Ist das australische Team menschlich? (...) Was sind das für Chips in ihren Köpfen, die darauf programmiert sind, mit extremer Strenge jeden Gedanken abzutöten, der auch entfernt in die Richtung eines schmutzigen Wortes mit fünf Buchstaben steuert, das mit einem "d" beginnt, ein stummes "b" enthält und mit einem "t" endet? Machen sich diese Typen auch manchmal Gedanken?" Und trotzdem glaubt er: "Sie waren schlagbar. (...) Wir haben sie gewinnen lassen."
Bis zuletzt wurde in den Redaktionsstuben der Outlook India der Atem angehalten, die neue Ausgabe musste warten - doch vergeblich. Sie haben es nicht geschafft, die Inder; die "Men in Blue" waren der "Supermacht" erlegen, und die heißt im Cricket Australien. Jetzt, nach der Finalniederlage am Sonntag, fragt sich Sandipan Deb: "Ist das australische Team menschlich? (...) Was sind das für Chips in ihren Köpfen, die darauf programmiert sind, mit extremer Strenge jeden Gedanken abzutöten, der auch entfernt in die Richtung eines schmutzigen Wortes mit fünf Buchstaben steuert, das mit einem "d" beginnt, ein stummes "b" enthält und mit einem "t" endet? Machen sich diese Typen auch manchmal Gedanken?" Und trotzdem glaubt er: "Sie waren schlagbar. (...) Wir haben sie gewinnen lassen." Auch Manu Joseph hadert, analysiert, erlaubt sich ein bisschen Pathos und fragt: "Sollten wir weinen? Nein." Hoch das Haupt! Und egal, was irgendjemand jetzt sagt, immer daran denken: "Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Doch das heißt nicht, das sie richtig ist."
Weitere Artikel: Paul Danahar war in Bagdad, als die Hunde zu heulen begannen und wenig später die ersten Cruise Missiles einschlugen. Er kann sich nicht vorstellen, warum irgendjemand in der Stadt die Amerikaner für Befreier halten sollte.
Seema Sirohi hat einen Report zum Gesundheitszustand indischer Amerikaner gelesen und räumt auf mit dem "weichen und flauschigen" Mythos von der hochgebildeten und gut verdienenden Model Minority. Immigranten aus Indien bekommen öfter Krebs als der Durchschnitt der Amerikaner, fast ein Viertel von ihnen hat keine Krankenversicherung und die Rate häuslicher Gewalt gegen Frauen ist in ihren Familien überdurchschnittlich hoch. Die häufigste Todesursache bei 15 bis 24jährigen ist Selbstmord. Little India hat drastische gesundheitliche und soziale Probleme; es ist, schreibt Sirohi, "ein Mikrokosmos von Big India mitsamt seiner kulturellen Fragilitäten, Annahmen und Tabus."
Lettre International (Deutschland), 01.04.2003
 Mit der Wiederkehr okkulter Gewalt in Afrika hat sich Johannes Harnischfeger befasst. Er berichtet von dem nigerianischen "Propheten Eddie", der wegen des Vorwurfs der Zauberei von den "Bakassi Boys", einer bewaffneten Miliz, die ausdrücklich auch gegen Okkultismus kämpft, exekutiert wurde. "Der Mann Gottes, so spekulierten Zeitungen, habe 93 Menschen getötet, um mit Hilfe von Leichenteilen besonders wirksame Zaubermittel herzustellen. In der Gegend von Onitsha, einer Großstadt im Igboland, im Südosten Nigerias, zum Beispiel vermutete man, daß Eddy seine Hände im Spiel hatte, als aus der Entbindungsstation eines Krankenhauses in einer Nacht 16 Babys gestohlen wurden. Wegen seiner enormen Kräfte, die es ihm ermöglicht hatten, sich jahrelang jeder Verfolgung durch die Staatsbehörden zu entziehen, stand Edward Okeke im Verdacht, kein gewöhnlicher Sterblicher zu sein, sondern ein Mischwesen: 'halb Mensch, halb Geist'. Auf Plakaten, die auf allen größeren Märkten im Igboland zu kaufen waren, ist er daher mit doppeltem Gesicht abgebildet: einer Engelsmaske, die sich von einer tierartigen Dämonenfratze abhebt..." Harnischfeger sieht den Ursprung von Okkultismus und Hexenverfolgung in einem "moralischen Trauma. Der soziale und politische Niedergang hat die Bewohner Nigerias in eine Welt versetzt, in der das Verhältnis von Gut und Böse, Schuld und Sühne aus der Balance geraten ist ... Da sich keine Wege aus dem Elend öffnen, kreisen die Gedanken immer wieder um mögliche Verschwörungen, die mit monströsen Mitteln ins Werk gesetzt werden."
Mit der Wiederkehr okkulter Gewalt in Afrika hat sich Johannes Harnischfeger befasst. Er berichtet von dem nigerianischen "Propheten Eddie", der wegen des Vorwurfs der Zauberei von den "Bakassi Boys", einer bewaffneten Miliz, die ausdrücklich auch gegen Okkultismus kämpft, exekutiert wurde. "Der Mann Gottes, so spekulierten Zeitungen, habe 93 Menschen getötet, um mit Hilfe von Leichenteilen besonders wirksame Zaubermittel herzustellen. In der Gegend von Onitsha, einer Großstadt im Igboland, im Südosten Nigerias, zum Beispiel vermutete man, daß Eddy seine Hände im Spiel hatte, als aus der Entbindungsstation eines Krankenhauses in einer Nacht 16 Babys gestohlen wurden. Wegen seiner enormen Kräfte, die es ihm ermöglicht hatten, sich jahrelang jeder Verfolgung durch die Staatsbehörden zu entziehen, stand Edward Okeke im Verdacht, kein gewöhnlicher Sterblicher zu sein, sondern ein Mischwesen: 'halb Mensch, halb Geist'. Auf Plakaten, die auf allen größeren Märkten im Igboland zu kaufen waren, ist er daher mit doppeltem Gesicht abgebildet: einer Engelsmaske, die sich von einer tierartigen Dämonenfratze abhebt..." Harnischfeger sieht den Ursprung von Okkultismus und Hexenverfolgung in einem "moralischen Trauma. Der soziale und politische Niedergang hat die Bewohner Nigerias in eine Welt versetzt, in der das Verhältnis von Gut und Böse, Schuld und Sühne aus der Balance geraten ist ... Da sich keine Wege aus dem Elend öffnen, kreisen die Gedanken immer wieder um mögliche Verschwörungen, die mit monströsen Mitteln ins Werk gesetzt werden."In einem Schwerpunkt befasst sich die Lettre mit Europa. Pierre Rosanvallon (mehr hier) versucht, Europas Gestalt vor dem Hintergrund der Globalisierung zu bestimmen und kommt zu dem Schluss, dass aufgrund des fehlenden europäischen demos auf die Nationalstaaten nicht verzichtet werden kann. Trotzdem ist er der Meinung, "dass die Gestaltung Europas auf ihre Weise heute erneut darauf abzielen muss, eine bestimmte Form des Universellen im kleinen zu realisieren, eine Universalität, die durch globale Regulierung nicht zu erreichen ist".
Karl Schlögel (mehr hier) denkt über "das östliche und mittlere Europa als grandiosen Verschiebebahnhof" nach und fordert angesichts der bevorstehenden Osterweiterung eine Auseinandersetzungen mit der "Tragödie der Vertreibung" nach dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Beiträge zum Thema "Fragiles Europa" kommen von Emile Tode, Karl Markus Gauß und Ulf Peter Hallberg.
Auszugsweise online lesen dürfen wie außerdem ein Gesprächt zwischen Swetlana Alexijewitsch und Paul Virilio (mehr hier und hier) über die Auswirkungen des Tschernobyl-GAUs auf unser Weltbild: "Die Katastrophe von Tschernobyl ist deshalb außergewöhnlich, weil sie die astronomische Zeit betrifft, die Zeit der Generationen, der Jahrhunderte und Jahrtausende." Und der Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz erklärt den weltweiten Antiamerikanismus als Reaktion auf die neoliberale Globalisierung und kritisiert das "Mantra der Deregulierung".
Im Print bietet diese Lettre-Ausgabe genug Stoff für die nächsten drei Monate: Giorgio Agamben fragt nach der rechtlichen Legitimität des Ausnahmezustands. Gavan McCormack beschreibt in einer langen Reportage "Nordkorea unter Zwang". Amitav Ghosh denkt über Terror und Geschichte nach. Abdelwahab Meddeb erinnert an Blütezeiten des Islam. Außerdem finden sich literarische Texte von Ian McEwan, Raymond Queneau und Bora Cosic sowie Poesie von Kenneth White und Etel Adnan. Für optischen Genuss sorgen die wunderbar organischen Fotografien von Ann Mandelbaum.
New York Review of Books (USA), 10.04.2003
Der Historiker Tony Judt (mehr hier) vermisst in der derzeitigen amerikanische Debatte nicht so sehr das Wissen um die Geschichte, sondern ein Gespür für ihre Tragik. "Dass die USA in der modernen Zeit eine solche Reihe von außenpolitischen Erfolgen vorweisen können, liegt in großem Maße daran, wie Dean Acheson einmal sagte, dass 'wir Glück mit unseren Gegnern hatten'. Das muss nicht so bleiben. Wir hatten auch Glück mit unseren Führern. Das ist definitiv nicht so geblieben. Es gibt im Moment viel zuversichtliches Gerede über das kommende Amerikanische Jahrhundert, doch vor hundert Jahren glaubten auch viele, dass Deutschland den Schlüssel für eine neue Ära in der Hand halten würde. Wie Raymond Aron bemerkte: Das zwanzigste Jahrhundert hätte das Deutsche Jahrhundert werden können."
Tim Judah (mehr hier) berichtet aus den Autonomie-Gebieten im Norden Iraks, wo er vor Beginn des Krieges den kurdischen Vertreter der Stadt Shoresh, Hajar Mullah Omar, getroffen hat: "Omar sah nicht sonderlich besorgt aus. So weit ich sehen konnte, bestand seine einzige Vorbereitung auf den Krieg in einer Kalschnikow, die in Reichweite seines Schreibtischs lag. Draußen spielten Kinder weiterhin in der Sonne, Frauen erledigten die Wäsche und die Männer schienen gar nichts zu machen. Omar glaubt nicht, dass hier viel passieren wird. Seiner Aussage nach schlüpfen irakische Offiziere und Soldaten mehrmals in der Woche über die Grenze und bitten die Kurden, nicht anzugreifen, wenn der Krieg beginnt. Er behauptet: "Sie sagen, sie werden nicht kämpfen: 'Greift uns nur nicht an, sondern gebt uns Zeit, zu Euch überzulaufen oder zu entkommen.'"
Zu lesen ist auch der Brief des amerikanischen Diplomaten John Brady Kiesling an seinen Chef Colin Powell, mit dem dieser seinen Dienst quittiert hat: "Bis zu dieser Regierung habe ich glauben können, dass ich, wenn ich die Politik meines Präsidenten vertrete, auch die Interessen der amerikanischen Bevölkerung und der Welt vertrete. Das kann ich nicht mehr... Wir haben begonnen, dass größte und effektivste Netz internationaler Beziehungen zu zerreißen, das die Welt je gekannt hat. Unser gegenwärtiger Kurs wird Instabilität und Gefahr bringen, aber keine Sicherheit."
Etwas abseits vom Weltgeschehen blickt Doris Lessing (mehr hier) auf Zimbabwe, das einstige "Juwel Afrikas", das seit seiner Unabhängigkeit vom Mugabe-Regime stetig heruntergewirtschaftet wurde - unter dem Schweigen der liberalen Öffentlichkeit. "Welche Verbrechen wurden im Namen der politischen Korrektheit begangen! Ein Mann konnte mit Mord davonkommen, wenn er nur schwarz war. Mugabe tat dies viele Jahre lang."
Besprochen werden die Leonardo-Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum, Stuart Banners amerikanische Geschichte der Todesstrafe und Jospeh Roths Berlin-Report "What I saw" (deutsch: "Joseph Roth in Berlin").
Tim Judah (mehr hier) berichtet aus den Autonomie-Gebieten im Norden Iraks, wo er vor Beginn des Krieges den kurdischen Vertreter der Stadt Shoresh, Hajar Mullah Omar, getroffen hat: "Omar sah nicht sonderlich besorgt aus. So weit ich sehen konnte, bestand seine einzige Vorbereitung auf den Krieg in einer Kalschnikow, die in Reichweite seines Schreibtischs lag. Draußen spielten Kinder weiterhin in der Sonne, Frauen erledigten die Wäsche und die Männer schienen gar nichts zu machen. Omar glaubt nicht, dass hier viel passieren wird. Seiner Aussage nach schlüpfen irakische Offiziere und Soldaten mehrmals in der Woche über die Grenze und bitten die Kurden, nicht anzugreifen, wenn der Krieg beginnt. Er behauptet: "Sie sagen, sie werden nicht kämpfen: 'Greift uns nur nicht an, sondern gebt uns Zeit, zu Euch überzulaufen oder zu entkommen.'"
Zu lesen ist auch der Brief des amerikanischen Diplomaten John Brady Kiesling an seinen Chef Colin Powell, mit dem dieser seinen Dienst quittiert hat: "Bis zu dieser Regierung habe ich glauben können, dass ich, wenn ich die Politik meines Präsidenten vertrete, auch die Interessen der amerikanischen Bevölkerung und der Welt vertrete. Das kann ich nicht mehr... Wir haben begonnen, dass größte und effektivste Netz internationaler Beziehungen zu zerreißen, das die Welt je gekannt hat. Unser gegenwärtiger Kurs wird Instabilität und Gefahr bringen, aber keine Sicherheit."
Etwas abseits vom Weltgeschehen blickt Doris Lessing (mehr hier) auf Zimbabwe, das einstige "Juwel Afrikas", das seit seiner Unabhängigkeit vom Mugabe-Regime stetig heruntergewirtschaftet wurde - unter dem Schweigen der liberalen Öffentlichkeit. "Welche Verbrechen wurden im Namen der politischen Korrektheit begangen! Ein Mann konnte mit Mord davonkommen, wenn er nur schwarz war. Mugabe tat dies viele Jahre lang."
Besprochen werden die Leonardo-Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum, Stuart Banners amerikanische Geschichte der Todesstrafe und Jospeh Roths Berlin-Report "What I saw" (deutsch: "Joseph Roth in Berlin").
The Atlantic (USA), 01.04.2003
 Zum Irakkrieg hat Atlantic Monthly eine ganze Reihe älterer Artikel aus dem Archiv geholt und freigeschaltet:
Zum Irakkrieg hat Atlantic Monthly eine ganze Reihe älterer Artikel aus dem Archiv geholt und freigeschaltet: Zum Beispiel Mark Bowdens ausführliches Porträt Saddam Husseins: "Der Gesalbte, der glorreiche Führer, der direkter Nachkomme des Propheten, Präsident des Irak, Vorsitzende des revolutionären Kommandorates und Doktor seiner eigenen Rechte steht um drei Uhr morgens auf. Er schläft in der Nacht nur drei oder vier Stunden. Sobald er aufgestanden ist, geht er schwimmen. All seine Paläste haben Pools. Wasser ist ein Symbol des Wohlstands in einem Wüstenstaat wie dem Irak, und Saddam verspritzt es überall ... Er hat einen schlimmen Rücken, und Schwimmen hilft. Es hält natürlich auch fit. Das befriedigt seine Eitelkeit, die geradezu episch ist, aber Fitness ist auch aus einem anderen Grund wichtig. Er ist jetzt sechsundfünfzig, ein alter Mann, aber da seine Macht in Angst, nicht in Zustimmung gründet, darf man ihm das Altern nicht ansehen. Der Tyrann kann es sich nicht leisten, gebeugt, gebrechlich und grau zu werden."
Oder Robert D. Kaplans Post-Saddam-Szenario, das sich nicht besonders ermutigend liest, aber wahrscheinlich recht realistisch ist: "Unser Ziel im Irak sollte eine säkulare Übergangs-Diktatur sein, die die kaufmännischen Klassen über die konfessionellen Trennungslinien hinweg vereint."
Für das aktuelle Heft hat sich Kaplan in Eritrea und dem Jemen umgesehen, den wahrscheinlich nächsten Etappen im "Krieg gegen den Terror". Während es Eritrea dank "albanischer Abschottung" und "maoistischer Mobilisierung" zu einem halbwegs stabilen Staat gebracht hat, so Kaplan, sieht es im Jemen ziemlich düster aus: "Nehmen Sie den Wadi Hadhramaut, eine hundert Meilen lange Oase in Südosten des Jemen, bewohnt seit 1000 vor Christus. Trotz seiner Abgeschiedenheit und einer Geschichte von Stammesfeindschaften, hat die Region über Jahrhunderte Verbindungen zu Indien und Indonesien aufrechterhalten. Der Nizam von Hyderabad hat seine Bodyguards ausschließlich unter den Kriegern der Hadhrami rekrutiert. Auch mit Saudi-Arabien ist die Gegend verbunden, über die alten Karawanen-Routen der Beduinen. Heute ergibt dies alles das passende soziale und ökonomische Netzwerk, in dem eine Organisation wie Al Qaida ihr globales Geschäft betreiben kann - vor allem weil Osama bin Ladens Familie genau in dieser Hadhramaut-Gegend ihren Ursprung hat."
Weitere Artikel: Christopher Hitchens (mehr hier) wirft einer ganzen Reihe Autoren - von Salman Rushdie über Oriana Falaci bis zu V.S. Naipaul - vor, in ihrer Kritik am Islam nicht stringent genug zu sein. Einzige Ausnahme ist ihm Stephen Schwartz, der gerade das Buch "The Two Faces of Islam" veröffentlicht hat, in dem er mit der Wahabitischen Ausrichtung hart ins Gericht geht, wie auch in einem online zu lesenden Interview. Michael Kelly bemerkt mit Blick auf einige "lamentierende" oder gar Antikriegsgedichte schreibende Autoren, wie "schwer, gefährlich, verdammt mutig, selbstlos und wirklich einsam" es im Moment sein muss, das Gewissen der amerikanischen Nation zu sein. James Wood fragt, wie gut der Romancier Henry James eigentlich wirklich war. Perry Anderson zeigt sich enttäuscht von William Taubmans Chruschtschow-Biografie. Außerdem sind die Kurzgeschichte "We have a Pope" von Christopher Buckley zu lesen sowie Gedichte von Jesse Iott, W. D. Snodgrass und T. R. Hummer.
Nur im Print: Der Historiker und Journalist Richard Brookhiser zeichnet ein ausführliches Porträt George W. Bushs. In einem Online-Interview erklärt er, wie Bush "tickt" und versichert, dass der Mann zwar absolut uncharismatisch und unfähig sei, zwei Sätze hintereinander zu sagen, dabei aber ziemlich intelligent und ein hervorragender Manager sei.
Literaturen (Deutschland), 01.04.2003
 Schluss mit den Patriarchen, und der übermächtigen Aufarbeitung von Vaterkonflikten in der Literatur: jetzt erobern die Mütter die Szenerie der literarischen Betrachtung. Aber weder die "Blut-und-Boden-Heldenmütter" noch die "deutschen Übermuttis der Nachkriegszeit", sondern neue Mütter, die ihre Autonomie schon mal auf Kosten anderer ausleben.
Schluss mit den Patriarchen, und der übermächtigen Aufarbeitung von Vaterkonflikten in der Literatur: jetzt erobern die Mütter die Szenerie der literarischen Betrachtung. Aber weder die "Blut-und-Boden-Heldenmütter" noch die "deutschen Übermuttis der Nachkriegszeit", sondern neue Mütter, die ihre Autonomie schon mal auf Kosten anderer ausleben.Und so hat sich Sigrid Löffler in zwei Katia-Mann-Biografien nach der Figur der Matriarchin umgesehen. Allerdings ohne Erfolg, wie sich herausstellt, denn sowohl in Inge und Walter Jens' "Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim" als auch in Kirsten Jüngling und Brigitte Rossbecks "Katia Mann. Die Frau des Zauberers" ist von der strahlenden Matriarchin nichts zu sehen: "Sie ist den femininen Seiten ihres Mannes mit ihrer eigenen Vermännlichung entgegengekommen, wie die Altersbilder des Paares deutlich machen, die einen gezierten Thomas und eine stämmige Katia mit männlichem Haarschnitt und Outfit zeigen." Aufopferungsvoll und doch zu männlich, um eine gute Mutter zu sein, erscheint sie, was Sigrid Löffler zu dem skurrilen Fazit führt: "Vielleicht könnte man ja Thomas Mann als Katharina Pringsheims erfolgreichstes Hätschelkind betrachten. Daran, dass sie der einzige Mann in der Familie gewesen ist, kann kaum ein Zweifel bestehen."
Zum selben Thema - allerdings nur in der Printausgebe - gibt es auch das Literaturen-Gespräch, in dem die Autorin Zsuzsa Bank, die Verlegerin Antje Kunstmann und die Schauspielerin Eva Mattes über weiblich Rollenerwartung und Selbstwahrnehmung diskutieren. Und schließlich wird nach neuen Weiblichkeitskonzepten Ausschau gehalten: Caroline Neubaur sucht im Sachbuch und Frauke Meyer-Gossau im Roman.
Aus London berichtet David Flusfeder über den britischen "Bad-Sex"-Preis (mehr hier), der laut seinem Erfinder Auberon Waugh zum Ziel hat, "die Aufmerksamkeit auf die kruden, geschmacklosen, oft nachlässig geschriebenen und redundanten sexuellen Passagen in modernen Romanen zu lenken, um solches künftig zu verhindern". Denn nicht immer will man Dinge lesen wie: "Und dann brach mein Körper, wie eine Kathedrale, in Geläut aus. Der bucklige Glöckner im Turm war losgesprungen und schwang jetzt wie verrückt an seinem Glockenseil." Dann schon eher so etwas: "Während die Erregung des Majors steigt, wechselt er von 'Halali!' zu 'Auf geht's!' und das Bett stöhnt bei dem Versuch, seine strukturelle Integrität aufrechtzuerhalten." Oder doch nicht?
Weitere Artikel: Richard David Precht erinnert sich an die Welle der "Little Big Men" in den achtziger Jahren, eine Zeit, in der ein Autor vom Trickbetrüger bis zum Nachtwächter schon alles gewesen sein musste, um glaubwürdig zu wirken. Aram Lintzel ist im virtuellen kulturellen Wien herumgeschlendert und hat vor allem "alten Glanz" vorgefunden.
Prospect (UK), 01.04.2003
 Ist Demokratie westlichen Zuschnitts in der arabischen Welt möglich? Oder widerspricht sie grundsätzlich der traditionellen politischen Kultur der islamischen Zivilisation? Der Prospect stellt in seiner Titelgeschichte Ansichten und Prognosen zur umstrittenen Frage nebeneinander:
Ist Demokratie westlichen Zuschnitts in der arabischen Welt möglich? Oder widerspricht sie grundsätzlich der traditionellen politischen Kultur der islamischen Zivilisation? Der Prospect stellt in seiner Titelgeschichte Ansichten und Prognosen zur umstrittenen Frage nebeneinander:"Arabischen Gesellschaften", schreibt Adam Garfinkle, "fehlen drei Voraussetzungen zur Demokratie: Die Überzeugung, dass die Quelle politischer Autorität innerhalb der Gesellschaft liegt, die Vorstellung einer Mehrheitsregierung und die Akzeptanz der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz." Regierungsgewalt beruhe auf einem Konsensmodell, dem die Annahme einer äußeren Autorität und natürlicher Hierarchien innerhalb der Gesellschaft zugrunde liegen. All das sei keineswegs gleichbedeutend mit Tyrannei. Wer aber dem Irak Demokratie aufzwingen wolle, warnt Garfinkle, müsse mit einem Bumerangeffekt rechnen. Robin Banerji ergänzt: Arabische Autokratien seien deshalb so sattelfest, weil die Gesellschaften aus Patronatsgeflechten bestehen, in denen fast alle sich einer väterlichen Macht unterordnen, um so die eigene Stellung zu sichern und gehört zu werden. Ahmad Samih Khalidi sucht nach einem Mittelweg, der demokratisches Wahlrecht mit traditionellen Regierungsformen versöhnen könnte, während Kenneth M. Pollack und Daniel L. Byman solche Überlegungen zurückweisen: Alles andere als ein konsequenter Weg Iraks zur Demokratie, meinen sie, hätte entweder schwache Regierungen oder neue Saddams zur Folge - und in jedem Fall keine stärkere Repräsentation der Mehrheit der Bürger. Und es sei falsch, dass Demokratie arabischen Gesellschaften zu fremd und deshalb dort nicht durchsetzbar sei: "Demokratie ist nicht nur richtig, sie ist auch realistisch." Da hat Fouad Ajami zwar seine Zweifel, er wäre aber schon mit einer Semi-Demokratie zufrieden und erklärt, warum er ein föderalistisches Staatsmodell im Irak für die beste Idee hält.
Es gibt keine bindende Wahrheit mehr, nur noch Versionen davon? Haben wir nur noch die Wahl zwischen Relativismus und Skeptizismus? Des Weges kommt die nach Ansicht vieler "pferdefüßige und dreifach gehörnte Figur des Richard Rorty" und meint: Es geht doch gar nicht um die richtige Repräsentation der Welt, sondern nur um den überzeugenderen Diskurs - wer mehr Anhänger hat, setzt seine Werkzeuge besser ein. Hört also endlich auf, nach der Wahrheit zu suchen und daraus Autorität abzuleiten. Simon Blackburn findet, dass Rorty selber nichts anderes macht und empfiehlt einen Reality Check.
Weitere Artikel: William I. Hitchcock berichtet über die in den USA vorherrschende Wahrnehmung vom Zweiten Weltkrieg - amerikanische junge Männer, die Demokratie im Herzen tragend, besiegen ohne nennenswerte alliierte Hilfe die deutschen Faschisten - und zeigt, wem der heroische Mythos gerade jetzt wieder nützt. Ken Worpole erklärt mit Bedauern, auf welche Weise sich die Kultur des Begräbnisses im vergangenen Jahrhundert gewandelt hat und wie man das an der Architektur unserer Friedhöfe ablesen kann. Und Anthony Gottlieb kommentiert John Horgans Versuch, hinter das Geheimnis nichtreligiöser mystischer Bewegungen zu kommen, auch wenn er selber keines entdecken kann.
New Yorker (USA), 24.03.2003
 Ziemlich viel Lesestoff in dieser Ausgabe. Nicholas Lemann rekonstruiert in einem "Letter from Washington" Bushs Entscheidungsprozess für einen Krieg , und Jon Lee Anderson beschreibt aus Bagdad die Berichtslage in einer belagerten Stadt.
Ziemlich viel Lesestoff in dieser Ausgabe. Nicholas Lemann rekonstruiert in einem "Letter from Washington" Bushs Entscheidungsprozess für einen Krieg , und Jon Lee Anderson beschreibt aus Bagdad die Berichtslage in einer belagerten Stadt.Seymour M. Hersh hat schließlich recherchiert, wie es dazu kam, dass die US-Regierung einen gefälschten Bericht über das irakische Atomwaffenprogramm akzeptierte und fragt sich, wer hier eigentlich wen belogen hat. Grundlage ist ein geheimer Bericht der CIA und ihres Chefs George Tenet vom 24. September vergangenen Jahre, wonach der Irak zwischen 1999 und 2001 versucht habe, "fünfhundert Tonnen Uran aus Niger zu beziehen, dem weltweit größten Produzenten." Das Material könne "bei entsprechender Verarbeitung auch zum Waffenbau verwendet" werden. "Am gleichen Tag veröffentlichte in London Tony Blairs Regierung einen Bericht, der viele der Informationen enthielt, die dem US-Senat als geheimes Material übergeben worden waren - der Irak habe versucht, 'bedeutetende Mengen an Uran' von einem nichtgenannten afrikanischen Land zu kaufen, 'obwohl (der Irak) kein laufendes Atomwaffenprogramm hat, wofür er es brauchen kann'." Zwei Tage später habe Colin Powell bei einer Anhörung vor dem Foreign Relations Committee diesen Versuch des Irak als "Beweis für bestehende Atompläne" gewertet. "Die Aussagen von Tenet und Powell trugen dazu bei, die Demokraten zu beruhigen, und zwei Wochen später die überwältigenden Mehrheit der Resolution zu ermöglichen, die dem Präsidenten das Kongressmandat für einen Angriff gegen den Irak gab."
Des weiteren zu lesen: die Erzählung "When I Woke Up This Morning Everything I Had Was Gone" von T. Coraghessan Boyle (mehr hier). David Remnick denkt über die Bedeutung von "Demut" nach einer geschlagenen Schlacht nach, Nancy Franklin kommentiert die amerikanischen TV-Kriegsberichterstattung, und Anthony Lane analysiert noch einmal die möglichen Beweggründe für die Politik von Tony Blair.
Besprechungen: John Updike sieht Don DeLillo (mehr hier) in seinem neuen Roman "Cosmopolis" (Scribner) auf seiner "nach-christlichen Suche nach einer tieferen Ordnung" bei der "globalen Computerisierung" angekommen: "der Null-Eins-heit der Welt, dem digitalen Imperativ, der jeden Atemzug der Milliarden Erdenbewohner definiert." Robert Conquest rezensiert eine Studie des Politikwissenschaftlers William Taubman über Nikita Chruchtschow "The Man and His Era" (Norton), außerdem gibt es Kurzbesprechungen, darunter von einer Kulturgeschichte der Masturbation.
Alex Ross berichtet über ein Berlioz-Festival im Lincoln Center, Nancy Franklyn stellt die beiden TV-Krimiserien "Without a Trace" und "The Shield" vor und schwärmt von Emmy-Gewinner Michael Chiklis in letzterer. David Denby war im Kino und sah die Stephen King-Verfilmung "Dreamcatcher" von Lawrence Kasdan, in dem ein "grässlicher Wurm" die Rolle des Monsters spielt, sowie die Independent-Produktion "Raising Victor Vargas" von Peter Sollett.
Nur in der Printausgabe: eine Betrachtung über "Isolation und Einfluss" von Noam Chomsky, ein Bericht über Golfen in Manhatten (da fragt man sich schon, wo dafür eigentlich Platz sein soll) und Lyrik von Franz Wright und Richard Wilbur.
Espresso (Italien), 27.03.2003
 CNN ist im zweiten Golfkrieg großgeworden durch schnelle, professionelle und unabhängige Berichterstattung. Zumindest mit der Unabhängigkeit ist es mittlerweile vorbei und CNN zum Staatsfernsehen verkommen, schimpft Giorgio Bocca. Ja, der ganze "amerikanische Journalismus hat in wenigen Jahren seine Grundsätze der Autonomie, der Unabhängigkeit aufgegeben, die zwar immer schon zum großen Teil ein Marketingmärchen waren, aber trotzdem ein Gegengewicht dargestellt haben. Heute hat der amerikanische Journalismus ebenso wie der europäische begriffen, dass sie der Politik untergeordnet sind, der Regierung, dem unangefochtenen Protagonisten: die ersten Seiten sind den Worten von George W. Bush und seinen Ministern gewidmet oder zitieren die Führer der Opposition, das wirkliche, reale Land ist aus der Berichterstattung verschwunden." Geld ist heutzutage zum einzigen Wert geworden, klagt Bocca, und die Regierung, die das Geld druckt, die wirkliche Macht. "In den amerikanischen Zeitungen und im Fernsehen ist es mittlerweile sehr gefährlich, sich gegen diese beiden Mächte zu stellen." (Ach ja? Da soll er uns erst mal den Seymour Hersh Italiens zeigen!)
CNN ist im zweiten Golfkrieg großgeworden durch schnelle, professionelle und unabhängige Berichterstattung. Zumindest mit der Unabhängigkeit ist es mittlerweile vorbei und CNN zum Staatsfernsehen verkommen, schimpft Giorgio Bocca. Ja, der ganze "amerikanische Journalismus hat in wenigen Jahren seine Grundsätze der Autonomie, der Unabhängigkeit aufgegeben, die zwar immer schon zum großen Teil ein Marketingmärchen waren, aber trotzdem ein Gegengewicht dargestellt haben. Heute hat der amerikanische Journalismus ebenso wie der europäische begriffen, dass sie der Politik untergeordnet sind, der Regierung, dem unangefochtenen Protagonisten: die ersten Seiten sind den Worten von George W. Bush und seinen Ministern gewidmet oder zitieren die Führer der Opposition, das wirkliche, reale Land ist aus der Berichterstattung verschwunden." Geld ist heutzutage zum einzigen Wert geworden, klagt Bocca, und die Regierung, die das Geld druckt, die wirkliche Macht. "In den amerikanischen Zeitungen und im Fernsehen ist es mittlerweile sehr gefährlich, sich gegen diese beiden Mächte zu stellen." (Ach ja? Da soll er uns erst mal den Seymour Hersh Italiens zeigen!)Der Espresso gibt neuerdings zu vielen Artikeln eine ganze Reihe von zusätzlichen Quellen im Netz an, in diesem Fall etwa zu einer irakischen Tageszeitung, dem Staatsfernsehen und der Nachrichtenagentur, außerdem zu amerikanischen 'oppositionellen' Medien wie der Seite von Ken O'Keefe, dem Anführer der menschlichen Schutzschilde, und ein offener Brief von Michael Moore, in dem er dem Präsidenten vorwirft, mit dem Krieg nur von den immensen Problemen im eigenen Land ablenken zu wollen. Verwiesen wird außerdem auf zwei neue Bücher zum Thema Journalismus in Amerika, die vergangene Woche in der Book Review der New York Times besprochen wurden (siehe vorige Magazinrundschau).
Ansonsten gibt es diese Woche vor allem Kriegsberichterstattung, etwa ein Porträt des amerikanischen Oberbefehlshabers Tommy Franks.
New York Times (USA), 23.03.2003
 Als ein "funkelndes Gespräch über die Darstellung des Leids" preist ein begeisterter John Leonard das neue Buch von Susan Sontag, "Regarding the Pain of Others" (erstes Kapitel). Sontag schreibt über das Geschäft des Kriegsfotografen, der von Krise zu Krise reist. "Sie folgt den Spuren des Fotojournalismus von Roger Fenton im Tal des Todes nach dem Angriff der Light Brigade ... zu Hungersnöten in Indien und Massakern in Biafra und Napalm in Vietman und ethnischen Säuberungen auf dem Balkan ... Sie hat ungewöhnliche Dinge zu sagen über Kolonialkriege, Gedenkstätten, christliche Ikonographie, Lynchpostkarten, Virginia Woolf, Andy Warhol, Georges Bataille und St. Sebastian", meint Leonard. "Und sie provoziert, in gewohnter Weise." Zum Abschluss versucht der Rezensent noch ein Kompliment. "Während sie so viele ernstzunehmende Denker bewundert hat, ist sie selbst zu einem geworden." Dieser Film über den Kriegsfotografen James Nachtwey könnte Sontag inspiriert haben.
Als ein "funkelndes Gespräch über die Darstellung des Leids" preist ein begeisterter John Leonard das neue Buch von Susan Sontag, "Regarding the Pain of Others" (erstes Kapitel). Sontag schreibt über das Geschäft des Kriegsfotografen, der von Krise zu Krise reist. "Sie folgt den Spuren des Fotojournalismus von Roger Fenton im Tal des Todes nach dem Angriff der Light Brigade ... zu Hungersnöten in Indien und Massakern in Biafra und Napalm in Vietman und ethnischen Säuberungen auf dem Balkan ... Sie hat ungewöhnliche Dinge zu sagen über Kolonialkriege, Gedenkstätten, christliche Ikonographie, Lynchpostkarten, Virginia Woolf, Andy Warhol, Georges Bataille und St. Sebastian", meint Leonard. "Und sie provoziert, in gewohnter Weise." Zum Abschluss versucht der Rezensent noch ein Kompliment. "Während sie so viele ernstzunehmende Denker bewundert hat, ist sie selbst zu einem geworden." Dieser Film über den Kriegsfotografen James Nachtwey könnte Sontag inspiriert haben.Judith Shulevitz hat für den Close Reader ein interessantes Buch gelesen, ''Transgressions: The Offenses of Art" von Anthony Julius. Der fragt sich, ob es wirklich immer Kunst ist, wenn man, wie es die Avantgarde heute fast ausschließlich tut, ein beliebiges Tabu der Gesellschaft aufspürt und verletzt. "Andres Serranos Foto von einem in Urin getauchten Kruzifix, Barbara Krugers anklagende Slogans oder Robert Mapplethorpes Selbstporträt mit einer Peitsche, die aus seinem Anus ragt, um einige gefeierte Beispiele zu nennen, sind eindeutig dazu bestimmt, wenigstens manche Betrachter zu beleidigen. Bloß, die Bemerkung, dass Regelverletzungen, indem sie zur Norm wurden, banal geworden sind, wird langsam selbst banal, und erklärt lange nicht so viel wie es scheint."
Außerdem besprochen: Suzanne Rutas empfiehlt "The Point of no Return" (erstes Kapitel), das Debüt von Siddhartha Deb, die Geschichte vom "indischen Don Quichote" Dr. Dam, ein idealistischer Republikaner, der immer zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Laura Miller erinnert Scott Spencers neuer Roman "A Ship Made of Paper" (erstes Kapitel) an einen Gerichtsprozess, in dem die Protagonisten Iris und Daniel, Liebende und Ehebrecher, die Welt auf die Anklagebank laden. William Finnegan schwärmt von "Reporting Civil Rights" (erstes Kapitel), zwei voluminösen Bänden mit nahezu 200 Essays, Reden, Artikeln und Reportagen zum Kampf um die Bürgerrechte von 1941 bis 1973. Neben der umfassenden Darstellung der verschiedenen Strömungen und Entwicklungen aus erster Hand sind die Sammelbände zudem ein "schmeichelndes" Porträt des amerikanischen Journalismus, notiert Finnegan.
Economist (UK), 21.03.2003
 Der Economist fragt sich, ob der militärische Eingriff im Irak nicht auch positive Folgen haben könnte, indem er zukünftigen Konfliktpartnern in Sachen Massenvernichtungwaffen nahelegt, in Anbetracht der eventuellen Konsequenzen den Konflikt auf diplomatische Weise zu lösen. "Um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einzudämmen, muss der Preis für Möchtegern-Wucherer in die Höhe getrieben und der Nutzen, den man glaubt, durch solche Waffen zu haben, geschmälert werden. Indem Amerika es mit dem Irak aufnimmt, demonstriert es anderen Nuklear-Möchtegernen, wie hoch der Preis für einen Regelverstoß sein kann."
Der Economist fragt sich, ob der militärische Eingriff im Irak nicht auch positive Folgen haben könnte, indem er zukünftigen Konfliktpartnern in Sachen Massenvernichtungwaffen nahelegt, in Anbetracht der eventuellen Konsequenzen den Konflikt auf diplomatische Weise zu lösen. "Um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einzudämmen, muss der Preis für Möchtegern-Wucherer in die Höhe getrieben und der Nutzen, den man glaubt, durch solche Waffen zu haben, geschmälert werden. Indem Amerika es mit dem Irak aufnimmt, demonstriert es anderen Nuklear-Möchtegernen, wie hoch der Preis für einen Regelverstoß sein kann."Weitere Artikel: Wie der Vater, so der Sohn? Nicht ganz, meint der Economist. Denn George Bush Seniors Golfkrieg war ein anderer als der seines Sohnes. Es scheint sogar, als sei der zweite Golfkrieg das genaue Gegenteil des ersten: weniger Alliierte und mehr Zustimmung in der amerikanischen Bevölkerung. Mit dem parlamentarischen Beschluss einer militärischen Beteiligung Großbritanniens im Irak scheint sich das Schicksal zu Tony Blairs Gunsten gewendet zu haben. Und das, so der Economist, verdankt er vor allem den Fehlern seiner Gegner. Zwar lobt der Economist das von Gerhard Schröder vorgelegte ambitionierte Reformpaket, doch wird der Kanzler an dessen Umsetzung gemessen werden. Gelobt wird auch Dana Priests Buch "The Mission: Waging War and Keeping Peace with America's Military", in dem die Pentagon-Spezialistin harsche Kritik übt an der lautlosen Übernahme der politischen Spitze Amerikas durch Uniformträger. Schließlich gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Psychologie der Verschwörungstheorien und deren sofortige Anwendung auf die Firmenbeteiligung am geplanten Wiederaufbau im Irak, denn die Hauptlizenz bekommt wahrscheinlich Halliburton, die frühere Firma des amerikanischen Vize-Präsidenten Dick Cheney.
Außerdem, ein verschmitzter Nachruf auf den mit 104 Jahren gestorbenen Mediziner William Sunderman: "Er erzählte von Freunden, die sich nach Florida zurückgezogen hatten. Zuerst, sagte er, hätten sie regelmäßig Golf gespielt und vor dem Abendessen ein Glas getrunken. Später spielten sie weniger Golf und fingen um die Mittagszeit mit dem Trinken an. 'Dann vergaßen sie das Golfspielen ganz, wurden Alkoholiker und starben.' Doktor Sunderman sagte, er persönlich habe zuviele Interessen um sich zurückzuziehen."
Nur im Print zu lesen ist die Frage, was für ein Sieg im Irak zu erwarten ist.
London Review of Books (UK), 20.03.2003
 Was Catherine Halls Studie ("Civilising Subjects: Metropole and Colony in the English Imagination 1830-67") über Jamaica als Brennpunkt des britischen Kolonialismus zu etwas Besonderem macht, ist, dass sie "geladen ist mit der existentiellen Dringlichkeit gelebter Leben, mit hart gewonnenen Einsichten, umkämpften Anliegen und epochalen Veränderungen ", findet Edward Said. Dies beruhe vor allem darauf, dass Hall selbst unzertrennlich mit dem Thema verwoben sei, da die Pfarrerstochter einerseits aus dem baptistischen Missionszentrum Birmingham stamme, von dem die Missionierung Jamaicas ausging, und zudem mit dem Jamaica-britischen Historiker Stuart Hall verheiratet sei. Und auch wenn Said Hall vorwirft, schriftliche Dokumente als Beweise zu werten, ohne deren spezifischen - etwa literarischen oder philosophischen - Status zu hinterfragen, und die Kultur nicht genug als historisch differenziertes Konzept zu behandeln, dessen Bedeutung und Verflechtungen sich wandeln, bleibt diese Studie seiner Ansicht nach "im besten Sinne dialektisch" und wird sicher interessante Denkanstöße für Empire-Historiker und politische Aktivisten liefern, "für die es kein Scherz sein kann, dass George Bushs Hauptwählerschaft, jetzt da er auszieht, die Welt erst zu bestrafen und dann mit amerikanischer Macht wiederaufzubauen, siebzig Millionen evangelische und fundamentalistische amerikanische Christen sind, von denen viele Baptisten sind."
Was Catherine Halls Studie ("Civilising Subjects: Metropole and Colony in the English Imagination 1830-67") über Jamaica als Brennpunkt des britischen Kolonialismus zu etwas Besonderem macht, ist, dass sie "geladen ist mit der existentiellen Dringlichkeit gelebter Leben, mit hart gewonnenen Einsichten, umkämpften Anliegen und epochalen Veränderungen ", findet Edward Said. Dies beruhe vor allem darauf, dass Hall selbst unzertrennlich mit dem Thema verwoben sei, da die Pfarrerstochter einerseits aus dem baptistischen Missionszentrum Birmingham stamme, von dem die Missionierung Jamaicas ausging, und zudem mit dem Jamaica-britischen Historiker Stuart Hall verheiratet sei. Und auch wenn Said Hall vorwirft, schriftliche Dokumente als Beweise zu werten, ohne deren spezifischen - etwa literarischen oder philosophischen - Status zu hinterfragen, und die Kultur nicht genug als historisch differenziertes Konzept zu behandeln, dessen Bedeutung und Verflechtungen sich wandeln, bleibt diese Studie seiner Ansicht nach "im besten Sinne dialektisch" und wird sicher interessante Denkanstöße für Empire-Historiker und politische Aktivisten liefern, "für die es kein Scherz sein kann, dass George Bushs Hauptwählerschaft, jetzt da er auszieht, die Welt erst zu bestrafen und dann mit amerikanischer Macht wiederaufzubauen, siebzig Millionen evangelische und fundamentalistische amerikanische Christen sind, von denen viele Baptisten sind."Weitere Artikel: Mark Ford ist ziemlich beeindruckt vom mehrschichtig verzweigten Erzählen eines Harry Matthews, dem einzigen Amerikaner in der von Raymond Queneau mitbegründeten französischen Literaturbewegung des OuLiPo (Ouvroir de Litterature Potentielle), und der Anthropologe Michael Gilsenan hat sich auf die Spur der arabischen Diaspora in Sudostasien gemacht. Schließlich schreibt Thomas Jones in Short Cuts über gefühlte und tatsächliche soziale Ungerechtigkeiten im britischen Schulsystem. Als Schmankerl gibt es dazu die dritte Seite von Art Spiegelmans Comic "In the Shadow of No Towers".
Nur im Print zu lesen, unter anderem, Hal Fosters Einschätzung der Pläne für Ground Zero.
Times Literary Supplement (UK), 19.03.2003
 Graham Robb zieht seinen Hut vor Theophile Gautier, der lieber mittelmäßig als ein Genie sein wollte - und dabei doch ein recht passabler Literat und brillanter Journalist geworden ist, wie die neu erschienene Werkausgabe "Romans, Contes et Nouevelles" beweise. "Genies sind sehr engstirnig. Der Mangel an Intelligenz hält sie davon ab, die Hindernisse zwischen sich und ihren Zielen zu sehen."
Graham Robb zieht seinen Hut vor Theophile Gautier, der lieber mittelmäßig als ein Genie sein wollte - und dabei doch ein recht passabler Literat und brillanter Journalist geworden ist, wie die neu erschienene Werkausgabe "Romans, Contes et Nouevelles" beweise. "Genies sind sehr engstirnig. Der Mangel an Intelligenz hält sie davon ab, die Hindernisse zwischen sich und ihren Zielen zu sehen." Claire Tomalin registriert mit großer Befriedigung, dass die viktorianische Fotografin Julia Margaret Cameron (mehr hier) nicht mehr nur als amüsante, aber lächerliche Person dargestellt wird, sondern endlich wieder als "kluge und kreative" Künstlerin, "deren Bilder einmal in einem Atemzug mit den Gemälden von Tizian und Rembrandt genannt wurden".
Richard D. Altick erzählt die Geschichte des viktorianischen Skandalpaares Arthur Munby und Hannah Cullwick, über das es auch eine neue, doch in seinen Augen enttäuschend unoriginelle Biografie von Diane Atkinson gibt. Besprochen wird außerdem die Aufführung von Jean-Claude Carrieres Stück "The Little Black Book" in den Riverside Studios in Hammersmith.
Spiegel (Deutschland), 24.03.2003
 Der Titel - wie immer online nur gegen Bezahlung zugänglich - umfasst siebzig Seiten zum Irakkrieg. Darunter ein Artikel über die aktuelle Friedensbewegung, die sich vor allem aus "jungen Menschen" rekrutiere, bei denen ein "ebenso echter wie schlichter Glaube an das Gute" inzwischen alle anderen denkbaren Grundlagen ihres Protestes ersetzt habe.
Der Titel - wie immer online nur gegen Bezahlung zugänglich - umfasst siebzig Seiten zum Irakkrieg. Darunter ein Artikel über die aktuelle Friedensbewegung, die sich vor allem aus "jungen Menschen" rekrutiere, bei denen ein "ebenso echter wie schlichter Glaube an das Gute" inzwischen alle anderen denkbaren Grundlagen ihres Protestes ersetzt habe.Nicht online lesen dürfen wir das Gespräch mit Heinrich August Winkler über das Ende der Weimarer Republik sowie eines mit Louis Begley über "seine Erinnerungen an die Bombardierung Warschaus".