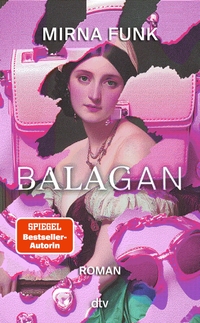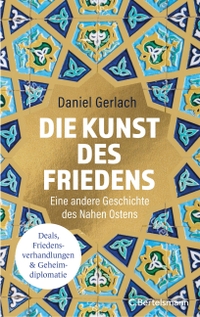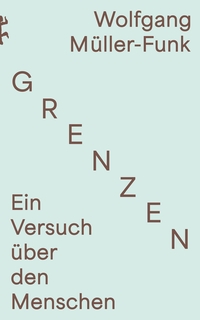Magazinrundschau
Miklos Tamas Gaspar: Für die Diktatur gibt es keine Entschuldigung
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
20.11.2007. In der Gazeta Wyborcza hält der Philosoph Michael Sandel nichts von weltanschaulicher Neutralität. In Bookforum widmet sich John Banville der Pulp-Literatur. Im Express aktualisiert Garri Kasparow die völlig veraltete Liste des Westens von russischen Oligarchen. Il Foglio sieht die Mitgift-Morde an Ehefrauen von Informatikern in Bangalore steigen. Outlook India erklärt, warum sich so viele Frauen im Londoner Vorort Southall vor den Zug werfen. In Elet es Irodalom macht sich der Philosoph Miklos Tamas Gaspar Gedanken über die posthume Wirkung der Securitate. Die New York Times untersucht den schlaf-industriellen Komplex.
Gazeta Wyborcza (Polen), 17.11.2007
 Diskussionen über Werte und Moral gehören zur Demokratie, und ein Kompromiss ist nicht immer möglich, konstatiert im Interview der amerikanische Philosoph Michael Sandel. "Keine Gesellschaft ist im Stande, in moralischen Fragen Einigkeit zu erzielen. In der Demokratie gibt die Meinung der Mehrheit den Ausschlag, aber in einer offenen Debatte muss diese Mehrheit die moralischen oder religiösen Anschauungen anderer ernst nehmen. Wichtig ist, dass das System offen bleibt." Sandel geht von der Unvereinbarkeit gegensätzlicher Moralvorstellungen zum Beispiel in der Abtreibungsdebatte aus. Hier versuchen einige Politiker, "weltanschauliche Neutralität vorzutäuschen, statt von Werten überhaupt zu sprechen. So zu tun, als ob reale Unterschiede und Konflikte nicht existierten, ist oft schlimmer als eine freie und offene Debatte."
Diskussionen über Werte und Moral gehören zur Demokratie, und ein Kompromiss ist nicht immer möglich, konstatiert im Interview der amerikanische Philosoph Michael Sandel. "Keine Gesellschaft ist im Stande, in moralischen Fragen Einigkeit zu erzielen. In der Demokratie gibt die Meinung der Mehrheit den Ausschlag, aber in einer offenen Debatte muss diese Mehrheit die moralischen oder religiösen Anschauungen anderer ernst nehmen. Wichtig ist, dass das System offen bleibt." Sandel geht von der Unvereinbarkeit gegensätzlicher Moralvorstellungen zum Beispiel in der Abtreibungsdebatte aus. Hier versuchen einige Politiker, "weltanschauliche Neutralität vorzutäuschen, statt von Werten überhaupt zu sprechen. So zu tun, als ob reale Unterschiede und Konflikte nicht existierten, ist oft schlimmer als eine freie und offene Debatte."Was ist den jugoslawischen Gastarbeitern geblieben? fragt Dubravka Ugresic. Und antwortet selbst: "Nichts. Geld, das sinnlos ausgegeben wurde für protzige Grabmäler, Häuser, die im Bürgerkrieg zerstört wurden und Autos. Das war das einzige, womit sie ihr gedemütigtes Ego beruhigen konnten. Sie waren Diener in Ländern, die sie nie als eigene akzeptiert haben, und sie waren Diener im ehemaligen Jugoslawien, wo sie als erste nationalistischen Anführern aus Serbien. Bosnien und Kroatien nachliefen."
Außerdem: Juliusz Kurkiewicz zeichnet ein längeres Porträt des Journalisten und Schriftstellers Bruce Chatwin ("Wer war er? Diejenigen, die ihn kannten, wissen es bis heute nicht.") Und: die Debatte um den kulturellen Nachlass des Realsozialismus hat nach der Architektur die Neonwerbung erreicht: Eine polnische Fotografin aus London hat daraus eine Ausstellung gemacht (hier ein paar Bilder), die ausgerechnet im Warschauer Kulturpalast gezeigt wird. "Das entstehende Museum für Moderne Kunst hatte sich jetzt bereit erklärt, die Neonreklame in ihr Programm zu integrieren. Es soll eine Freilichtausstellung entstehen, und ihre Geschichte erforscht werden", kündigt die Gazeta Wyborcza an.
New Statesman (UK), 19.11.2007
 David Matthews untersucht die Beziehung afro-karibischer Briten zu den Konservativen. Im Augenblick stimmen bei Wahlen ca. 80 Prozent für Labour. Doch sobald sie die soziale Leiter etwas höher gestiegen sind, könnte sich das ändern, denn Afro-Kariben und Afrikaner sind "in vieler Hinsicht maßgeschneidert für die Tories", meint Matthews. "1962 kamen meine Eltern von British Guayana (heute Guayana) nach England. Sie waren klassische Immigranten: hart arbeitend, unabhängig, Hausbesitzer. Maßgeschneiderte Tories. Kulturell ist die Diaspora immer noch konservativ. Die Einstellung zu kindlicher Disziplin, Abtreibung und Homosexualität ist tief reaktionär. Vor ein paar Jahren zeigte eine Umfrage, dass 96 Prozent aller Jamaikaner gegen die Legalisierung der Homosexualität sind. Die afrikanische Diözese der Anglikanischen Kirche ist jetzt so rechts, dass sogar Gott sich fühlt wie ein schuldiger weißer Liberaler. Aber bedeutet sozialer und kultureller Konservatismus auch politischer Konservatismus?" Noch nicht, aber es könnte dazu kommen, denn nach über 50 Jahren, in denen er Labour gewählt hat, fragt sich zum Beispiel mancher schwarze Brite: Wo sind die schwarzen Parlamentarier auf den vorderen Labour Bänken?
David Matthews untersucht die Beziehung afro-karibischer Briten zu den Konservativen. Im Augenblick stimmen bei Wahlen ca. 80 Prozent für Labour. Doch sobald sie die soziale Leiter etwas höher gestiegen sind, könnte sich das ändern, denn Afro-Kariben und Afrikaner sind "in vieler Hinsicht maßgeschneidert für die Tories", meint Matthews. "1962 kamen meine Eltern von British Guayana (heute Guayana) nach England. Sie waren klassische Immigranten: hart arbeitend, unabhängig, Hausbesitzer. Maßgeschneiderte Tories. Kulturell ist die Diaspora immer noch konservativ. Die Einstellung zu kindlicher Disziplin, Abtreibung und Homosexualität ist tief reaktionär. Vor ein paar Jahren zeigte eine Umfrage, dass 96 Prozent aller Jamaikaner gegen die Legalisierung der Homosexualität sind. Die afrikanische Diözese der Anglikanischen Kirche ist jetzt so rechts, dass sogar Gott sich fühlt wie ein schuldiger weißer Liberaler. Aber bedeutet sozialer und kultureller Konservatismus auch politischer Konservatismus?" Noch nicht, aber es könnte dazu kommen, denn nach über 50 Jahren, in denen er Labour gewählt hat, fragt sich zum Beispiel mancher schwarze Brite: Wo sind die schwarzen Parlamentarier auf den vorderen Labour Bänken?Ein gewisser Neid erfüllt Kira Cochrane, wenn sie nach Schweden sieht: "Die Schweden scheinen ohne jede Anstrengung in praktisch allem, das erstrebenswert ist, auf den ersten Platz zu rutschen, stimmt's? Sie sind gesund - sie haben eine der längsten Lebenserwartungen in der Welt. Sie sind freundlich - sie wurden gerade als das beste Land in Europa genannt, wenn es darum geht, Immigranten zu begrüßen und ihnen zu helfen, sich niederzulassen. Sie sind intelligent - sie haben den höchsten pro-Kopf-Anteil an Nobelpreisträgern. Sie gaben uns Abba, die karaokefreundlichste Popgruppe aller Zeiten.... Und als ob das nicht genug wäre, wurden sie jetzt zum zweiten Mal als das Land ausgezeichnet, das am meisten für die Gleichberechtigung getan hat."
Weiteres: Besprochen werden die neue CD von Burial (hier ein paar Hörproben) und Thomas Schüttes Skulptur am Trafalgar Square.
Outlook India (Indien), 26.11.2007
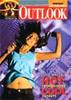 Auf einem kurzen Streckenabschnitt in Southall im Westen Londons ereignen sich jährlich ein Drittel aller Selbstmorde auf den Bahnstrecken Großbritanniens. Die meisten Opfer sind Frauen - und zwar Sikhs aus dem Pandschab, erklärt Sanjay Sury: "Viele dieser Bräute aus dem Pandschab gelangen auf dem direkten Weg in die Hölle. Viele von denen, die sich umbringen, sind gebildet und kommen aus durchaus wohlhabenden Familien im Pandschab - eine der Frauen, die sich kürzlich in Southall vor den Zug warf, hatte einen Wirtschaftsabschluss. Genau darin scheint ein Teil des Problems zu liegen. 'Es ist ein Kulturschock', sagt [der Parlamentsabgeordnete für Southall Virender] Sharma. 'Die meisten dieser Mädchen aus dem Pandschab haben Uni-Abschlüsse. Ich habe Mädchen mit einem Master in Englisch, in Wirtschaft erlebt. Ihre Familien arrangieren Ehen mit Männern, die keine vergleichbare Ausbildung haben." Die Männer, an die diese jungen Frauen verheiratet werden, "sind meistens Händler, die oft ganz gut verdienen, aber keine große Erziehung haben. Den Gefallen, nach England geholt zu werden, müssen die Frauen üblicherweise mit häuslicher Sklaverei bezahlen, die manchmal gelockert wird, wenn sie schnell einen Sohn gebären."
Auf einem kurzen Streckenabschnitt in Southall im Westen Londons ereignen sich jährlich ein Drittel aller Selbstmorde auf den Bahnstrecken Großbritanniens. Die meisten Opfer sind Frauen - und zwar Sikhs aus dem Pandschab, erklärt Sanjay Sury: "Viele dieser Bräute aus dem Pandschab gelangen auf dem direkten Weg in die Hölle. Viele von denen, die sich umbringen, sind gebildet und kommen aus durchaus wohlhabenden Familien im Pandschab - eine der Frauen, die sich kürzlich in Southall vor den Zug warf, hatte einen Wirtschaftsabschluss. Genau darin scheint ein Teil des Problems zu liegen. 'Es ist ein Kulturschock', sagt [der Parlamentsabgeordnete für Southall Virender] Sharma. 'Die meisten dieser Mädchen aus dem Pandschab haben Uni-Abschlüsse. Ich habe Mädchen mit einem Master in Englisch, in Wirtschaft erlebt. Ihre Familien arrangieren Ehen mit Männern, die keine vergleichbare Ausbildung haben." Die Männer, an die diese jungen Frauen verheiratet werden, "sind meistens Händler, die oft ganz gut verdienen, aber keine große Erziehung haben. Den Gefallen, nach England geholt zu werden, müssen die Frauen üblicherweise mit häuslicher Sklaverei bezahlen, die manchmal gelockert wird, wenn sie schnell einen Sohn gebären."Außerdem hat Outlook einen Schwerpunkt zum Thema Technik, in dem es etwa um die Konvergenztendenzen der neuesten Geräte, um Nanotechnologie und die Notwendigkeit einer grünen Revolution in Indien geht.
Bookforum (USA), 19.11.2007
 In einem großen Artikel bespricht der irische Autor John Banville - als Kriminalromanautor schreibt er unter dem Pseudonym Benjamin Black - eine große Anthologie der Schundliteratur: "The Black Lizard Big Book of Pulp". Die Bedeutung der billigen Kriminalgeschichten liegt, wie er meint, weniger in ihren literarischen Qualitäten als darin, dass sie der treffende rohe Ausdruck roher Zeiten sind: "Die Kriminalliteratur blüht in schwierigen Zeiten. Die Fiktion spiegelt die Zeitläufe und die Zeitläufe geben der Fiktion ihre Farbe. Es gibt eine Rohheit in den Pulp-Geschichten, sogar in denen der 'literarischen' Autoren wie Chandler und Hammett, die sich nicht ausschließlich den Notwendigkeiten des Marktes verdankt. Die Stärke - und vielleicht auch die Schwäche - dieser Geschichten ist es, dass sie etwas von der großen Unversöhnlichkeit und dem unbezähmbaren Optimismus der USA zwischen den Kriegen wiedergeben... Man wird sich kaum über die Beliebtheit der Pulp-Literatur wundern angesichts der düsteren, verlogenen Jahrzehnte, in der sie sich millionenfach verkaufte. Die Welt war gerade aus einem verhängnisvollen Weltkrieg entkommen und rollte in einer Handkarre auf den nächsten zu - dazwischen galt es noch die Depressionsjahre zu überleben."
In einem großen Artikel bespricht der irische Autor John Banville - als Kriminalromanautor schreibt er unter dem Pseudonym Benjamin Black - eine große Anthologie der Schundliteratur: "The Black Lizard Big Book of Pulp". Die Bedeutung der billigen Kriminalgeschichten liegt, wie er meint, weniger in ihren literarischen Qualitäten als darin, dass sie der treffende rohe Ausdruck roher Zeiten sind: "Die Kriminalliteratur blüht in schwierigen Zeiten. Die Fiktion spiegelt die Zeitläufe und die Zeitläufe geben der Fiktion ihre Farbe. Es gibt eine Rohheit in den Pulp-Geschichten, sogar in denen der 'literarischen' Autoren wie Chandler und Hammett, die sich nicht ausschließlich den Notwendigkeiten des Marktes verdankt. Die Stärke - und vielleicht auch die Schwäche - dieser Geschichten ist es, dass sie etwas von der großen Unversöhnlichkeit und dem unbezähmbaren Optimismus der USA zwischen den Kriegen wiedergeben... Man wird sich kaum über die Beliebtheit der Pulp-Literatur wundern angesichts der düsteren, verlogenen Jahrzehnte, in der sie sich millionenfach verkaufte. Die Welt war gerade aus einem verhängnisvollen Weltkrieg entkommen und rollte in einer Handkarre auf den nächsten zu - dazwischen galt es noch die Depressionsjahre zu überleben."Weitere Artikel: Colm Toibin, der selbst einen gefeierten Roman über Henry James geschrieben hat, bespricht den zweiten Band - "The Mature Master" - von Sheldon M. Novicks Biografie des Autors. Der Literaturwissenschaftler Peter Brooks hat die soeben erschienenen ersten zwei Bände mit Henry James' Briefen gelesen.
Express (Frankreich), 19.11.2007
 Der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow, scharfer Putin-Kritiker und einer der Gründer des oppositionellen Bündnisses Das andere Russland, wird im März 2008 als dessen Kandidat bei den russischen Präsidentschaftswahlen antreten. In einem Interview spricht er über seine politischen Ziele, die Gründe für die Angst der Eliten vor freien Wahlen und das Problem der Korruption in seinem Land. "Die Frage, ob Putin korrupt ist oder nicht, läuft auf die Frage hinaus, ob Stalin etwas für den Terror, die Exekutionen, den Gulag konnte... Der an der Spitze der Pyramide ist verantwortlich für das, was von oben bis unten geschieht. Und Putin steht an der Spitze der Korruption. Glauben Sie, dass er noch über einen Rest an unfehlbarer Integrität verfügt, wenn seine engsten Freunde und Verbündeten, die alle wie er aus St. Petersburg kommen, den größten Teil der russischen Wirtschaft kontrollieren? Im Westen existiert eine längst veraltete Liste von Oligarchen. Ein gewisser Gennadi Timtschenko, Boss der Ölhandelsgesellschaft Gunvor mit Sitz in Genf, hat erheblich mehr gestohlen als ein Boris Berezowsky. Er kontrolliert ein Drittel der russischen Ölexporte. Und er ist ein Vertrauter von Putin, genau wie die Brüder Michail und Juri Kowaltschuk, denen die Bank Rossija gehört. Diese Leute haben sich in einem Tempo bereichert, das beispiellos ist."
Der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow, scharfer Putin-Kritiker und einer der Gründer des oppositionellen Bündnisses Das andere Russland, wird im März 2008 als dessen Kandidat bei den russischen Präsidentschaftswahlen antreten. In einem Interview spricht er über seine politischen Ziele, die Gründe für die Angst der Eliten vor freien Wahlen und das Problem der Korruption in seinem Land. "Die Frage, ob Putin korrupt ist oder nicht, läuft auf die Frage hinaus, ob Stalin etwas für den Terror, die Exekutionen, den Gulag konnte... Der an der Spitze der Pyramide ist verantwortlich für das, was von oben bis unten geschieht. Und Putin steht an der Spitze der Korruption. Glauben Sie, dass er noch über einen Rest an unfehlbarer Integrität verfügt, wenn seine engsten Freunde und Verbündeten, die alle wie er aus St. Petersburg kommen, den größten Teil der russischen Wirtschaft kontrollieren? Im Westen existiert eine längst veraltete Liste von Oligarchen. Ein gewisser Gennadi Timtschenko, Boss der Ölhandelsgesellschaft Gunvor mit Sitz in Genf, hat erheblich mehr gestohlen als ein Boris Berezowsky. Er kontrolliert ein Drittel der russischen Ölexporte. Und er ist ein Vertrauter von Putin, genau wie die Brüder Michail und Juri Kowaltschuk, denen die Bank Rossija gehört. Diese Leute haben sich in einem Tempo bereichert, das beispiellos ist."Foglio (Italien), 17.11.2007
Carlo Buldrini besucht nach langer Zeit hier und hier wieder einmal Bangalore und ist erstaunt, was aus dem einstigen Garten Indiens geworden ist. Beschaulich ist es längst nicht mehr. Die Ansprüche steigen. "Jeden Tag werden drei oder vier junge Frauen mit Verbrennungen am ganzen Körper ins Victoria Krankenhaus des Bangalore Medical College eingeliefert. Viele sterben. In den Polizeiberichten heißt es: 'Explosion des gasbetriebene Herds'. Die Sozialarbeiter sprechen hingegen von 'Mitgift-Morden'. In den Monaten in denen ich in Bangalore war, gab es 81 dieser Vorfälle. Die Kultur des globalen Konsums hat auf die Stadt übergegriffen und hat die Summe der Mitgift enorm in die Höhe getrieben. Informatiker sind dank ihres hohen Einkommens nun ganz oben auf der Liste der begehrten Männer."
New Yorker (USA), 26.11.2007
 Ryan Lizza nimmt den möglichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama und seine neu gestartete Kampagne mit dem Slogan "Harte Wahrheiten" unter die Lupe und geht der Frage nach, ob er damit seine Konkurrentin Hillary Clinton noch überholen kann. Er zitiert Obama unter anderem mit dieser Aussage: "Ich glaube, Hillary hat sich auf einen viel konventionelleren Ansatz festgelegt. Ich glaube, dass wir unkonventionellen Bedrohungen gegenüberstehen, und das erfordert ein Maß an persönlicher Diplomatie des Präsidenten, die den Schaden ausbügeln kann, den George Bush angerichtet hat. Ich denke, das bedeutet, dass der Präsident direkt an Gesprächen mit unseren Feinden beteiligt sein sollte - und nicht nur mit unseren Freunden. Er sollte sich weniger um Konventionen scheren, Sie wissen schon, mit wem treffen wir uns, Gesandte welche Dienstgrads werden geschickt und so weiter."
Ryan Lizza nimmt den möglichen demokratischen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama und seine neu gestartete Kampagne mit dem Slogan "Harte Wahrheiten" unter die Lupe und geht der Frage nach, ob er damit seine Konkurrentin Hillary Clinton noch überholen kann. Er zitiert Obama unter anderem mit dieser Aussage: "Ich glaube, Hillary hat sich auf einen viel konventionelleren Ansatz festgelegt. Ich glaube, dass wir unkonventionellen Bedrohungen gegenüberstehen, und das erfordert ein Maß an persönlicher Diplomatie des Präsidenten, die den Schaden ausbügeln kann, den George Bush angerichtet hat. Ich denke, das bedeutet, dass der Präsident direkt an Gesprächen mit unseren Feinden beteiligt sein sollte - und nicht nur mit unseren Freunden. Er sollte sich weniger um Konventionen scheren, Sie wissen schon, mit wem treffen wir uns, Gesandte welche Dienstgrads werden geschickt und so weiter."Anthony Lane sah im Kino Todd Haynes' von Bob Dylan inspirierten Film "I'm Not There" und Frank Darabonts Stephen-King-Verfilmung "The Mist". Über letzteren spottet er: "Der Satz 'Da ist was im Dunst' ist eine direkte Übernahme des Satzes 'Da ist was im Nebel', der vor 27 Jahren in John Carpenter's 'The Fog' gesprochen wurde. Er zeigt uns, dass diese Filme keine Meditationen über die Tragödie der menschlichen Selbstüberschätzung sind. Sie sind Wetterberichte. Ist das nicht schaurig genug?"
Weiteres: Nora Ephron glossiert einen Fall restlos verwirrender Vermischung von Filmhandlungen und literarischer Vorlage. James Wood bespricht eine Neuübersetzung von Tolstois "Krieg und Frieden" ("War and Peace", Knopf). Gary Giddins porträtiert die brasilianische Bossa-Nova-Sängerin Rosa Passos, die als "weibliches Pendant von Joao Gilberto" gilt. Nancy Franklin stellt die neue TV-Serie "Gossip Girls" über reiche Privatschüler an der Upper Eastside vor. Zu lesen ist außerdem die Erzählung "Alvaro Rousselots Journey" von Roberto Bolano und Lyrik von Adam Zagajewski und Louise Glück.
Nur im Print: eine Reportage über die Motorisierung Chinas und ein Porträt des Viertels "Little Colombia" alias Jackson Heights in Queens.
Elet es Irodalom (Ungarn), 16.11.2007
 Die Stiftung "Chance für die benachteiligten Kinder" führt Prozesse gegen Schulen und (als deren Träger) gegen Kommunen, um diese von der gesetzlich verbotenen Praxis der Segregation von Roma-Kindern abzubringen Das Vorbild dafür lieferten die bekannten Bürgerrechtsprozesse aus den USA (wie zum Beispiel "Brown kontra Schulamt"). "Solche Prozesse sind nötig", sagt der Präsident der Stiftung Andras Ujlaky im Interview mit Eszter Radai, "weil die Roma unser Meinung nach keine effektive politische Repräsentation in Ungarn haben - weder in der Gesetzgebung noch in den Kommunen oder in der Exekutive. Das unabhängige Gericht bleibt der einzige Ort, an dem sie ihre Interessen vertreten können. Denn der Staat verabschiedet zwar die Gesetze, aber die Kontrolle wird den Gemeinden überlassen, die dann machen, was sie wollen." Für Ujlaky ist das eine Tragödie: "Statistiken zufolge verlassen heute 25 Prozent der Kinder Ungarns die Grundschulen als funktionale Analphabeten, dies sind größtenteils Roma-Kinder. Sie werden, da sie keine Möglichkeiten zur Weiterbildung haben, ihr Leben lang arbeitslos bleiben, und das ist nicht nur für sie und ihre Kinder eine Tragödie ... es ist auch ein riesiger volkswirtschaftlicher Schaden, denn wir, die Steuerzahler werden sie ihr Leben lang unterhalten müssen, statt dass sie selbst zu Steuerzahlern werden."
Die Stiftung "Chance für die benachteiligten Kinder" führt Prozesse gegen Schulen und (als deren Träger) gegen Kommunen, um diese von der gesetzlich verbotenen Praxis der Segregation von Roma-Kindern abzubringen Das Vorbild dafür lieferten die bekannten Bürgerrechtsprozesse aus den USA (wie zum Beispiel "Brown kontra Schulamt"). "Solche Prozesse sind nötig", sagt der Präsident der Stiftung Andras Ujlaky im Interview mit Eszter Radai, "weil die Roma unser Meinung nach keine effektive politische Repräsentation in Ungarn haben - weder in der Gesetzgebung noch in den Kommunen oder in der Exekutive. Das unabhängige Gericht bleibt der einzige Ort, an dem sie ihre Interessen vertreten können. Denn der Staat verabschiedet zwar die Gesetze, aber die Kontrolle wird den Gemeinden überlassen, die dann machen, was sie wollen." Für Ujlaky ist das eine Tragödie: "Statistiken zufolge verlassen heute 25 Prozent der Kinder Ungarns die Grundschulen als funktionale Analphabeten, dies sind größtenteils Roma-Kinder. Sie werden, da sie keine Möglichkeiten zur Weiterbildung haben, ihr Leben lang arbeitslos bleiben, und das ist nicht nur für sie und ihre Kinder eine Tragödie ... es ist auch ein riesiger volkswirtschaftlicher Schaden, denn wir, die Steuerzahler werden sie ihr Leben lang unterhalten müssen, statt dass sie selbst zu Steuerzahlern werden.""Peter Marosi kenne ich noch aus der Redaktion der Zeitschrift Utunk in Kolozsvar (Cluj/Klauseburg), aber auch als Schachpartner meines Vaters", erinnert sich der Philosoph Miklos Tamas Gaspar an den Kritiker und Literaturwissenschaftler aus Siebenbürgen, dessen Vergangenheit als Spitzel für die rumänische Securitate kürzlich bekannt wurde. "Ob ich jetzt anders über ihn denke? Seltsamerweise kaum. Wer wusste denn nicht, wie das System war? Das System stalinistischen Ursprungs, das immer, heute noch, unsere Verachtung verdient. Es gibt keinen Grund zur Milde, zur Vergebung, zur Relativierung aus der historischen Perspektive. Das System machte fehlbare Menschen zu moralischen Leichen, und wischt nun - mit unserem rauhen Urteil - seine Stiefel noch einmal an ihnen ab, es ist sogar als Gespenst riesig." Dennoch will er Transparenz: "Sämtliche Daten aus der Zeit der Diktatur müssen veröffentlicht werden. Für die Diktatur gibt es keine Entschuldigung. Auch die Erbärmlichkeit der Demokratie ist keine Entschuldigung."
Espresso (Italien), 16.11.2007
 In den USA und besonders Kalifornien ist sogar schon die Feuerwehr privatisiert, seufzt Naomi Klein auf der Kommentarseite. "Während ungeheure Feuerwalzen ganze Landstriche in der Region verwüstet haben, sind einige Häuser im Herzen des Infernos ohne einen Kratzer davongekommen, als wären sie von einer höheren Macht beschützt worden. Aber es war nicht die Hand Gottes: in einigen Fällen war es das Werk von Firebreak Spray. Firebreak ist ein spezieller Service, der Kunden des Versicherungsriesen American International Group angeboten wird, aber nur jenen, deren Adressen die Postleitzahlen der reichsten Gegenden der Vereinigten Staaten aufweisen. Diese Privatklienten bezahlen im Durchschnitt 19.000 Dollar, um ihr Haus mit einem feuerbeständigen Mittel einzusprühen. Während der Brände waren zudem mobile Einheiten mit Höchstgeschwindigkeit in ihren roten Pritschenwagen unterwegs, um die Feuer zu löschen, die die Häuser ihrer Kunden bedrohten." Und nur die.
In den USA und besonders Kalifornien ist sogar schon die Feuerwehr privatisiert, seufzt Naomi Klein auf der Kommentarseite. "Während ungeheure Feuerwalzen ganze Landstriche in der Region verwüstet haben, sind einige Häuser im Herzen des Infernos ohne einen Kratzer davongekommen, als wären sie von einer höheren Macht beschützt worden. Aber es war nicht die Hand Gottes: in einigen Fällen war es das Werk von Firebreak Spray. Firebreak ist ein spezieller Service, der Kunden des Versicherungsriesen American International Group angeboten wird, aber nur jenen, deren Adressen die Postleitzahlen der reichsten Gegenden der Vereinigten Staaten aufweisen. Diese Privatklienten bezahlen im Durchschnitt 19.000 Dollar, um ihr Haus mit einem feuerbeständigen Mittel einzusprühen. Während der Brände waren zudem mobile Einheiten mit Höchstgeschwindigkeit in ihren roten Pritschenwagen unterwegs, um die Feuer zu löschen, die die Häuser ihrer Kunden bedrohten." Und nur die. New York Review of Books (USA), 06.12.2007
Die chinesische Umweltaktivistin Dai Qing schildert, wie die chinesischen Behörden den Raubbau an den Wasserresourcen des Landes vor den Olympischen Spielen noch einmal kräftig gesteigert haben. Obwohl das Wasser knapp und für die Bauern bereits rationiert ist, werden in Peking künstliche Seen, Hunderte von Golfplätzen und gewaltige Springbrunnen angelegt: "Um den dramatischen Wasser-Mangel auszugleichen, pumpt Peking derzeit 80 Prozent seines Wasserbedarfs aus dem Grundwasser. Aber es tut dies in weitaus schnellerem Maße, als sich die Vorkommen wieder auffüllen könnten, wodurch unter der Hauptstadt der Grundwasserspiegel abstürzte und der Boden in einem 2.000 Quadratkilometer weiten Trichter absackte. Zum Ausgleich wird nun Wasser von den zunehmend verärgerten Nachbarprovinzen Hebei und Shanxi nach Peking gepumpt. Chinas Neureiche und das von der Bürokratie aus Partei und Staat kontrollierte Finanzkapital dehnen sich in alarmierendem Maße auf die Weltmärkte aus. Sie haben einen bisher unbekannten Reichtum geschaffen, doch ist dieser nur durch den gierigen Verbrauch natürlicher Ressourcen zustande gekommen."
Frederick C. Crews erzählt von einem Coup der Pharmaindustrie: Der Konzern GlaxoSmithKline ließ gegen ein offenbar stattliches Honorar den Football-Spieler Ricky Williams in Oprah Winfreys Talkshow bekennen, dass er ein Leben lang "unter Schüchternheit" gelitten habe. Dabei, so lernen wir, handelt es sich nicht um einen verbreiteten Wesenszug, sondern eine Krankkeit - genannt Social anxiety disorder. "Medikamentehersteller erzielen ihre enormen Profite mit einer kleine Anzahl von marktführenden Produkten, für die immer wieder neue Anwendungen gesucht werden. Wenn diese nicht in Experimenten oder durch Zufall auftauchen, können sie durch das 'Condition-Branding' heraufbeschwört werden - das heißt, bringt die Massen dazu zu glauben, dass ein üblicher, wenn auch unangenehmer Zustand tatsächlich eine Störung ist, die mit Medikamenten behandelt werden muss. Poetischer nennt man dies 'künstlichen Rasen auslegen'."
Weiteres: William Pfaff kann sich noch immer keinen rechten Reim auf Nicolas Sarkozy machen: "Seine Interesse gilt der Macht an sich, nicht weil er eine persönliche Vorstellung hätte, was er mit ihr anfangen soll." Besprochen werden Philip Roth' neuer Roman "Exit Ghost", David Shulmans Bekenntnis zum Frieden in Nahost "Dark Hope", Robert Reichs Buch über den undemokratischen "Supercapitalism" unserer Tage sowie Jack Goldsmith' Studie "The Terror Presidency", die beschreibt, wie die Regierung Bush mit Hilfe des Juristen David Addington die Folter zu legalisieren versucht.
Frederick C. Crews erzählt von einem Coup der Pharmaindustrie: Der Konzern GlaxoSmithKline ließ gegen ein offenbar stattliches Honorar den Football-Spieler Ricky Williams in Oprah Winfreys Talkshow bekennen, dass er ein Leben lang "unter Schüchternheit" gelitten habe. Dabei, so lernen wir, handelt es sich nicht um einen verbreiteten Wesenszug, sondern eine Krankkeit - genannt Social anxiety disorder. "Medikamentehersteller erzielen ihre enormen Profite mit einer kleine Anzahl von marktführenden Produkten, für die immer wieder neue Anwendungen gesucht werden. Wenn diese nicht in Experimenten oder durch Zufall auftauchen, können sie durch das 'Condition-Branding' heraufbeschwört werden - das heißt, bringt die Massen dazu zu glauben, dass ein üblicher, wenn auch unangenehmer Zustand tatsächlich eine Störung ist, die mit Medikamenten behandelt werden muss. Poetischer nennt man dies 'künstlichen Rasen auslegen'."
Weiteres: William Pfaff kann sich noch immer keinen rechten Reim auf Nicolas Sarkozy machen: "Seine Interesse gilt der Macht an sich, nicht weil er eine persönliche Vorstellung hätte, was er mit ihr anfangen soll." Besprochen werden Philip Roth' neuer Roman "Exit Ghost", David Shulmans Bekenntnis zum Frieden in Nahost "Dark Hope", Robert Reichs Buch über den undemokratischen "Supercapitalism" unserer Tage sowie Jack Goldsmith' Studie "The Terror Presidency", die beschreibt, wie die Regierung Bush mit Hilfe des Juristen David Addington die Folter zu legalisieren versucht.
Weltwoche (Schweiz), 15.11.2007
 Susan Greenfield stammt aus der Arbeiterklasse und ist heute Baroness. Sie hat Literaturwissenschaften studiert und brachte es dann als Hirnforscherin zu einem Lehrstuhl in Oxford. Die Frage nach der Entstehung des Bewusstseins beantwortet sie im Interview mit Peer Teuwsen so: "Das ist eine der großen ungelösten Fragen der Wissenschaft. Ich habe aber eine Theorie, die sich auf meine Forschungen stützt. Bewusstsein entsteht dadurch, dass ein Ereignis, ein Gefühl, ein Bild Neuronen im Hirn auslöst, diese feuern mit 360 Stundenkilometern synchron durchs Hirn. Dann kommt eine nächste Stimulierung, die parallel existieren kann. Was ganz wichtig ist und wo ich auch mit anderen Hirnforschern nicht einig bin: Es gibt keine bestimmte Region im Hirn, der bestimmte Gefühle zugeordnet werden können. Bewusstsein entsteht und vergeht im ganzen Hirn." Und auf die Frage nach der Willensfreiheit hat sie eine beeindruckend simple Antwort: "Wenn man denkt, man habe einen freien Willen, hat man einen freien Willen."
Susan Greenfield stammt aus der Arbeiterklasse und ist heute Baroness. Sie hat Literaturwissenschaften studiert und brachte es dann als Hirnforscherin zu einem Lehrstuhl in Oxford. Die Frage nach der Entstehung des Bewusstseins beantwortet sie im Interview mit Peer Teuwsen so: "Das ist eine der großen ungelösten Fragen der Wissenschaft. Ich habe aber eine Theorie, die sich auf meine Forschungen stützt. Bewusstsein entsteht dadurch, dass ein Ereignis, ein Gefühl, ein Bild Neuronen im Hirn auslöst, diese feuern mit 360 Stundenkilometern synchron durchs Hirn. Dann kommt eine nächste Stimulierung, die parallel existieren kann. Was ganz wichtig ist und wo ich auch mit anderen Hirnforschern nicht einig bin: Es gibt keine bestimmte Region im Hirn, der bestimmte Gefühle zugeordnet werden können. Bewusstsein entsteht und vergeht im ganzen Hirn." Und auf die Frage nach der Willensfreiheit hat sie eine beeindruckend simple Antwort: "Wenn man denkt, man habe einen freien Willen, hat man einen freien Willen."Weitere Artikel: Georg Kreis verteidigt entschieden das Schweizer Antirassismusgesetz. Urs Gehriger versucht abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Krise in Pakistan mit Atombomben in den Händen von Islamisten enden könnte. Thomas Gottschalk gratuliert seinem Jugendidol Gunter Sachs zum 75. Geburtstag. Markus Somm kommentiert einen Bericht des World Economic Forum, aus dem hervorgeht, "dass die Schweiz in Sachen Gleichstellung von Mann und Frau eines der rückständigsten Länder des Westens" ist.
Economist (UK), 17.11.2007
 Kaum ein klassischer Künstler scheint in den USA derzeit so beliebt wie Gustav Klimt. Hier ein paar erstaunliche Superlative: "Warum ist Gustav Klimt, ein österreichischer Künstler, von 1862 bis 1918 lebte, so populär? Noch vor ihrem Erscheinen am 12. November waren sowohl die englische als auch die deutsche Ausgabe des fünf Kilo schweren 'catalogue raisonne' von Alfred Weidinger (Prestel) ausverkauft. 6000 Besucher hatten sich in der ersten Woche der Klimt-Ausstellung in der Neuen Galerie in New York gedrängelt, die am 12. Oktober eröffnet wurde und noch bis zum 30. Juni 2008 zu sehen ist. Ein Sprecher der Galerie hält es für möglich, dass es die erfolgreichste Ausstellung seit Eröffnung der Galerie im Jahr 2001 werden könnte - damit stäche sie sogar Vincent van Gogh aus."
Kaum ein klassischer Künstler scheint in den USA derzeit so beliebt wie Gustav Klimt. Hier ein paar erstaunliche Superlative: "Warum ist Gustav Klimt, ein österreichischer Künstler, von 1862 bis 1918 lebte, so populär? Noch vor ihrem Erscheinen am 12. November waren sowohl die englische als auch die deutsche Ausgabe des fünf Kilo schweren 'catalogue raisonne' von Alfred Weidinger (Prestel) ausverkauft. 6000 Besucher hatten sich in der ersten Woche der Klimt-Ausstellung in der Neuen Galerie in New York gedrängelt, die am 12. Oktober eröffnet wurde und noch bis zum 30. Juni 2008 zu sehen ist. Ein Sprecher der Galerie hält es für möglich, dass es die erfolgreichste Ausstellung seit Eröffnung der Galerie im Jahr 2001 werden könnte - damit stäche sie sogar Vincent van Gogh aus."Weitere Artikel: Vorgestellt wird der Clover (Foto), eine neue Kaffeemaschine, die gerade Riesenerfolge feiert, obwohl sie "sowohl langsamer als auch sehr viel teurer ist als andere Maschinen". Ein ausführlicher Nachruf ist Norman Mailer gewidmet. Besprochen werden unter anderem Aliza Marcus' Geschichte der PKK "Blood and Belief", der dritte Band von John Richardsons Picasso-Biografie und Sean Penns jüngster Film "Into the Wild".
Babelia (Spanien), 19.11.2007
"Glauben Sie an den Teufel?" Cecilia Dreymüller interviewt Alexander Kluge anlässlich des Erscheinens der spanischen Ausgabe seines Buches "Die Lücke, die der Teufel lässt": "Ich glaube, dass der Mensch Teufel erzeugt, wenn er sich über seine Taten nicht vollständig Rechenschaft ablegt. Wenn wir unser Wissen teilweise ausblenden, kommt vom Horizont her etwas auf uns zu, was wir als Teufel bezeichnen können. Ein alter Weggefährte, der die Erfahrungen der Menschheit in seinem Spiegel sammelt. Ich glaube aber auch, dass man einen Ausweg aufzeigen muss: Wenn die Welt so schrecklich ist wie in Verdun oder Auschwitz, möchte ich begreifen, wie das Böse konstruiert wird, aber auch, wie es sich dekonstruieren lässt."
Von der Kochkunst lernen, heißt siegen lernen - Vicente Verdu stellt zehn Grundregeln auf, die ein würdiges Fortleben des Romans im 21. Jahrhundert ermöglichen sollen: "Schluss mit einer Literatur, die den Leser am Kragen packt und keuchend und schlaflos zur ultimativen Offenbarung auf der letzten Seite schleift. Ein Roman, der den Namen zeitgenössisch verdient, folgt dem Vorbild der Slow Food-Bewegung und nimmt Rücksicht auf die vielfältige, zur Interaktion fähige Sensibilität seiner Rezipienten, verführt durch Formschönheit und ästhetische Effizienz."
Von der Kochkunst lernen, heißt siegen lernen - Vicente Verdu stellt zehn Grundregeln auf, die ein würdiges Fortleben des Romans im 21. Jahrhundert ermöglichen sollen: "Schluss mit einer Literatur, die den Leser am Kragen packt und keuchend und schlaflos zur ultimativen Offenbarung auf der letzten Seite schleift. Ein Roman, der den Namen zeitgenössisch verdient, folgt dem Vorbild der Slow Food-Bewegung und nimmt Rücksicht auf die vielfältige, zur Interaktion fähige Sensibilität seiner Rezipienten, verführt durch Formschönheit und ästhetische Effizienz."
New York Times (USA), 19.11.2007
 Das Magazine widmet seine Titelgeschichte dem "schlaf-industriellen Komplex", einem Geschäftszweig, der seit wenigen Jahren in ganz erstaunlicher Weise prosperiert: "Es gibt einen Schlafboom, oder auch, wie die Zeitschrift Forbes es im letzten Jahr formulierte, "eine Schlaf-Abzocke". Das Magazin Business 2.0 schätzt, dass die amerikanische Schlafwirtschaft etwa zwanzig Milliarden Dollar im Jahr umsetzt - eingeschlossen sind darin sowohl die mehr als tausend anerkannten Schlafkliniken (manche davon in Bädern), die über Nacht Apnoe-Tests durchführen, als auch zahllose rezeptfreie und pflanzliche Schlafhilfen, Schlafratgeber, Talismane und anderer schlaffördernder Krimskrams. Zia Sleep Sanctuary (Zia Schlafasyl), ein einzigartiger Luxus-Schlafzubehör-Laden in Eden Prairie, Minnesota, hat 'Lichttherapie'-Blendschutzsbrillen, den Zen-Wecker, das Mombasa-Majesty-Moskitonetz und 600 Dollar teure geräuschabweisende Ohrwatte sowie sechzehn verschiedene Matratzen und dreißig Kissen im Angebot. Am stärksten hat freilich die Schlaftabletten-Industrie profitiert. Neunundvierzig Millionen Rezepte wurde im letzten Jahr ausgestellt, das ist eine Zunahme um dreiundfünfzig Prozent seit 2001.
Das Magazine widmet seine Titelgeschichte dem "schlaf-industriellen Komplex", einem Geschäftszweig, der seit wenigen Jahren in ganz erstaunlicher Weise prosperiert: "Es gibt einen Schlafboom, oder auch, wie die Zeitschrift Forbes es im letzten Jahr formulierte, "eine Schlaf-Abzocke". Das Magazin Business 2.0 schätzt, dass die amerikanische Schlafwirtschaft etwa zwanzig Milliarden Dollar im Jahr umsetzt - eingeschlossen sind darin sowohl die mehr als tausend anerkannten Schlafkliniken (manche davon in Bädern), die über Nacht Apnoe-Tests durchführen, als auch zahllose rezeptfreie und pflanzliche Schlafhilfen, Schlafratgeber, Talismane und anderer schlaffördernder Krimskrams. Zia Sleep Sanctuary (Zia Schlafasyl), ein einzigartiger Luxus-Schlafzubehör-Laden in Eden Prairie, Minnesota, hat 'Lichttherapie'-Blendschutzsbrillen, den Zen-Wecker, das Mombasa-Majesty-Moskitonetz und 600 Dollar teure geräuschabweisende Ohrwatte sowie sechzehn verschiedene Matratzen und dreißig Kissen im Angebot. Am stärksten hat freilich die Schlaftabletten-Industrie profitiert. Neunundvierzig Millionen Rezepte wurde im letzten Jahr ausgestellt, das ist eine Zunahme um dreiundfünfzig Prozent seit 2001.