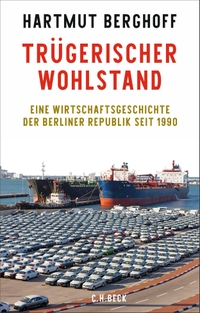Magazinrundschau
Wie mit weißer Tinte geschrieben
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
14.10.2014. Drei amerikanische Medien sehen schwarz in Afrika: Die Newsweek überprüft George Clooneys Engagement für den Südsudan. Der New Yorker schildert die von Frankreich gerade so gestoppte Selbstzerfleischung der Zentralafrikanischen Republik. In der New Republic bezweifelt Martha Nussbaum den Sinn westlichen Engagements. Ungarische Magazine beschreiben, wie Intellektuelle sich vom Regime glattschleifen lassen. Im New Statesman unterhält sich Grayson Perry mit Martin Amis. Télérama widmet sich der krisenhaften Beziehung von Truffaut und Godard.
Newsweek | Hitfix | La regle du jeu | Playboy | Himal | New York Times | Elet es Irodalom | New Yorker | New Republic | HVG | Guardian | n+1 | Telerama | New Statesman
Newsweek (USA), 13.10.2014
 In einem monumentalen Text (gut 25 DIN A4-Seiten) überprüft Alex Perry George Clooneys Engagement für den Südsudan und kommt am Ende zu mehr als zwiespältigien, allerdings auch pauschalisierenden Ergebnissen. Clooneys Ernsthaftigkeit zieht er nicht in Zweifel, prangert aber das Engagement von Celebrities für Menschenrechte in anderen Kulturen an, dem er tendenziell Islamophobie unterstellt (ausgerechnet den Bosnien-Kämpfer Bernard-Henri Lévy erklärt er hier zu einem Protagonisten). Der wütende Text ist dennoch sehr lesenswert, weil er an manchen Stellen das Dilemma des Engagments deutlich macht. Im Südsudan ging das Morden nach der Unabhängigkeit von Khartum nämlich in bestialischster Form weiter (was in der trüben deutschen Öffentlichkeit kaum bemerkt wurde), weil sich die ethnischen Gruppen nun untereinander bekriegten. In einem kleinen modellhaften Dialog mit einem alten Diplomaten kommt das Dilemma zum Ausdruck: "Auf die Frage, was die Welt in Südsudan vermocht hatte, antwortete er: "Ich denke, wir haben eine Menge Leben gerettet." Aber ebenso konnte man einwenden, dass zwei Generationen der Einmischung den genau umgekehrten Effekt hatte, so der Diplomat. "Haben wir das geschaffen?", fragte er. "Wären wir vor zwanzig Jahren abgehauen, wäre das Land heute politisch reifer? Wahrscheinlich ja." Einige Minuten später bemerkte ich, dass der Diplomat mit den Tränen kämpfte... "Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand Antworten hat.""
In einem monumentalen Text (gut 25 DIN A4-Seiten) überprüft Alex Perry George Clooneys Engagement für den Südsudan und kommt am Ende zu mehr als zwiespältigien, allerdings auch pauschalisierenden Ergebnissen. Clooneys Ernsthaftigkeit zieht er nicht in Zweifel, prangert aber das Engagement von Celebrities für Menschenrechte in anderen Kulturen an, dem er tendenziell Islamophobie unterstellt (ausgerechnet den Bosnien-Kämpfer Bernard-Henri Lévy erklärt er hier zu einem Protagonisten). Der wütende Text ist dennoch sehr lesenswert, weil er an manchen Stellen das Dilemma des Engagments deutlich macht. Im Südsudan ging das Morden nach der Unabhängigkeit von Khartum nämlich in bestialischster Form weiter (was in der trüben deutschen Öffentlichkeit kaum bemerkt wurde), weil sich die ethnischen Gruppen nun untereinander bekriegten. In einem kleinen modellhaften Dialog mit einem alten Diplomaten kommt das Dilemma zum Ausdruck: "Auf die Frage, was die Welt in Südsudan vermocht hatte, antwortete er: "Ich denke, wir haben eine Menge Leben gerettet." Aber ebenso konnte man einwenden, dass zwei Generationen der Einmischung den genau umgekehrten Effekt hatte, so der Diplomat. "Haben wir das geschaffen?", fragte er. "Wären wir vor zwanzig Jahren abgehauen, wäre das Land heute politisch reifer? Wahrscheinlich ja." Einige Minuten später bemerkte ich, dass der Diplomat mit den Tränen kämpfte... "Ich glaube nicht, dass hier noch irgendjemand Antworten hat.""New Yorker (USA), 20.10.2014
 Ähnliche Erfahrungen beschreibt Jon Lee Anderson in seiner Reportage aus der Zentralafrikanischen Republik. Dort schlachten sich seit dem Einmarsch muslimischer Rebellen 2012 in einem unglaublich brutalen Bürgerkrieg Muslime und Christen gegenseitig ab. Frankreich hat Soldaten geschickt, die UN ebenso. Hat es geholfen? "In einer Rede vor den französischen Botschaftern am 28. August gratulierte François Hollande seinen Friedenstruppen. "Letzten Dezember intervenierten wir in der Zentralafrikanischen Republik", sagte er. " Wir haben das Schlimmste verhindert, und ich meine das Schlimmste." Die meisten Leute mit denen ich gesprochen habe, waren ebenfalls der Ansicht, dass die internationalen Streitkräfte einen Genozid verhindert haben. Kasper Agger, von der NGO Enough Project, meinte: "Ihre Anwesenheit half, dass das Töten nicht völlig außer Kontrolle geriet. Sie war möglicherweise ein Game Changer." Aber niemand glaubt, dass die Unterdrückung der Gewalt ausreichen wird, die Zentralafrikanische Republik in einen zusammenhängenden Staat zu verwandeln. Viele wiesen darauf hin, dass die Kämpfe nur deshalb aufgehört hatten, weil das Land mit Hilfe der Friedenstruppen wirksam in christliche und muslimische Regionen geteilt worden war."
Ähnliche Erfahrungen beschreibt Jon Lee Anderson in seiner Reportage aus der Zentralafrikanischen Republik. Dort schlachten sich seit dem Einmarsch muslimischer Rebellen 2012 in einem unglaublich brutalen Bürgerkrieg Muslime und Christen gegenseitig ab. Frankreich hat Soldaten geschickt, die UN ebenso. Hat es geholfen? "In einer Rede vor den französischen Botschaftern am 28. August gratulierte François Hollande seinen Friedenstruppen. "Letzten Dezember intervenierten wir in der Zentralafrikanischen Republik", sagte er. " Wir haben das Schlimmste verhindert, und ich meine das Schlimmste." Die meisten Leute mit denen ich gesprochen habe, waren ebenfalls der Ansicht, dass die internationalen Streitkräfte einen Genozid verhindert haben. Kasper Agger, von der NGO Enough Project, meinte: "Ihre Anwesenheit half, dass das Töten nicht völlig außer Kontrolle geriet. Sie war möglicherweise ein Game Changer." Aber niemand glaubt, dass die Unterdrückung der Gewalt ausreichen wird, die Zentralafrikanische Republik in einen zusammenhängenden Staat zu verwandeln. Viele wiesen darauf hin, dass die Kämpfe nur deshalb aufgehört hatten, weil das Land mit Hilfe der Friedenstruppen wirksam in christliche und muslimische Regionen geteilt worden war."Weitere Artikel: Sehr lesenswert ist Louis Menands Artikel über die Entwicklung des Copyrights in den USA. George Packer schickt eine Reportage über die amerikanische Dokumentarfilmerin Laura Poitras, die amerikanischen Überwachungsexperten, die in Berlin leben, weil sie sich in den USA nicht mehr sicher fühlen und ihren gerade in New York vorgeführten Film "Citizenfour" über Snowden und die NSA-Affäre. Alex Ross stellt eine Reihe neuer Bücher über Beethoven aus den letzten drei Jahren vor. Peter Schjeldahl besucht die Matisse-Ausstellung im Museum of Modern Art. Und Anthony Lane sah im Kino Alejandro González Iñárritus "Birdman" mit Michael Keaton und Damien Chazelles "Whiplash".
New Republic (USA), 09.10.2014
 Die Philosophin Martha Nussbaum unterzieht Angus Deatons Studie "The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality" (Auszug) einer sehr gründlichen Lektüre, obwohl sie es durchaus einer gewissen Leichthändigkeit der Argumentation beschuldigt. Auch Deaton fragt (wie Perry oben in Newsweek) nach dem Dilemma westlichen Engagements in Entwicklungsländern, beschäftigt sich aber weniger mit Militärinterventionen als mit Entwicklungshilfe. Bei aller Reserve scheint Nussbaum Deatons Thesen weitgehend zuzustimmen: "In den wahrscheinlich streitbarsten Kapiteln seines Buchs argumentiert Deaton, dass die Probleme globaler Armut von ausländischer Hilfe und privaten Hilfsorganisationen wohl nicht nur nicht gelöst, sondern eher noch verschlimmert werden. Die Menschen in den reichen Ländern wollen helfen, sie fühlen eine moralische Verpflichtung. Aber wenn sie armen Ländern Geld geben, lösen sie damit nicht das Problem. Wie der Ökonom Peter Bauer vor langem darlegte: Wenn alle Bedingungen für Entwicklung gegeben sind, außer Kapital, dann wird das Kapital früher oder später lokal gebildet oder als Kredit zur Verfügung gestellt... Deaton ergänzt einige Argumente: Erstens wird die Hilfe selten von den Nöten der Bedürftigen geleitet, sondern von den Prioritäten und Interessen der Geberländer. Zweitens wird Hilfe in der Regel Regierungen gegeben, die kein Interesse daran haben, ihren eigenen Leuten zu helfen."
Die Philosophin Martha Nussbaum unterzieht Angus Deatons Studie "The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality" (Auszug) einer sehr gründlichen Lektüre, obwohl sie es durchaus einer gewissen Leichthändigkeit der Argumentation beschuldigt. Auch Deaton fragt (wie Perry oben in Newsweek) nach dem Dilemma westlichen Engagements in Entwicklungsländern, beschäftigt sich aber weniger mit Militärinterventionen als mit Entwicklungshilfe. Bei aller Reserve scheint Nussbaum Deatons Thesen weitgehend zuzustimmen: "In den wahrscheinlich streitbarsten Kapiteln seines Buchs argumentiert Deaton, dass die Probleme globaler Armut von ausländischer Hilfe und privaten Hilfsorganisationen wohl nicht nur nicht gelöst, sondern eher noch verschlimmert werden. Die Menschen in den reichen Ländern wollen helfen, sie fühlen eine moralische Verpflichtung. Aber wenn sie armen Ländern Geld geben, lösen sie damit nicht das Problem. Wie der Ökonom Peter Bauer vor langem darlegte: Wenn alle Bedingungen für Entwicklung gegeben sind, außer Kapital, dann wird das Kapital früher oder später lokal gebildet oder als Kredit zur Verfügung gestellt... Deaton ergänzt einige Argumente: Erstens wird die Hilfe selten von den Nöten der Bedürftigen geleitet, sondern von den Prioritäten und Interessen der Geberländer. Zweitens wird Hilfe in der Regel Regierungen gegeben, die kein Interesse daran haben, ihren eigenen Leuten zu helfen.""Amazon muss gestoppt werden", titelt Franklin Foer programmatisch und erzählt, wie sich irgendwann in den Sechzigerjahren die Auffassung durchsetzte, dass der Kampf gegen Monopole nicht dem Schutz kleinerer Unternehmen dient, sondern dem Schutz der Konsumenten. Als Konsequenz daraus sind heutige Monopolisten wie Walmart und Amazon ausgesprochen verbraucherfreundlich und beuten stattdessen ihre Angestellten und Zulieferer aus. Die Auswirkungen sind nicht weniger zerstörerisch, aber der öffentliche Protest hält sich in Grenzen, weil die Kunden von dem kannibalistischen Geschäftsmodell profitieren: "Wir alle sind verführt worden von den niedrigen Preisen, den automatischen monatlichen Windellieferungen, den kostenlosen Prime-Filmen, der Geschenkverpackung, dem kostenlosen Zwei-Tage-Versand, der Möglichkeit, Schuhe und Bücher und Toilettenpapier und Pintobohnen am selben Ort kaufen zu können. Aber inzwischen ist es über Verführung hinausgegangen. Jetzt erwarten wir diese Bequemlichkeit, als wäre sie ein Geburtsrecht. Sie hat sich eingebrannt in unsere Vorstellung davon, wie Konsumenten behandelt werden sollten. Diese Erwartung führt zu unserer kollektiven Verleugnung von Amazons Wesen." Und das wird uns am Ende, so Foer, wie alle Monopole eine geringere Auswahl und Qualität verglichen mit heute anbieten.
HVG (Ungarn), 01.10.2014
 Seit 2010 wurde der staatliche Zuschuss für die unabhängige Theatergruppe Krétakör systematisch gekürzt. Seit diesem Jahr gibt es nun gar nichts mehr. Mit dem Regisseur und Gründer von Krétakör, Árpád Schilling, sprach Zsuzsa Mátraházi über Projekte der Gruppe (eine neue Inszenierung mit dem Titel "Loser" und eine Faust-Inszenierung Schillings im Frühjahr), sowie über die Intellektuellen in Ungarn. ""Loser" wollen wir durch Crowdfunding finanzieren. (…) Als Hilferuf gedacht, geht es dabei um die Intellektuellen, die vom Staat abhängen und sich immer wieder einreden, weiter ruhig zu bleiben. Das Problem sei noch nicht so groß. Wenn es wirklich schlimm werde, dann werde man sich auch zu Wort melden. So steigen wir ab. Ich war schockiert, als Imre Kertész die Auszeichnung Viktor Orbáns annahm. Sollten wir das tun? (…) Wir beschränken uns heute nicht mehr auf das Künstlerische. Wir werfen gesellschaftliche Fragen auf und ziehen so das Publikum an. Zu einem Theaterereignis kommen mehr Menschen als zu einer Konferenz oder einem Forum. Daneben gibt es ein gemeinsames Schülerprogramm mit dem Goethe-Institut (Freie Schule), bei dem wir gesellschaftliche Probleme mit Schülern aus Budapest, Miskolc und Berlin aufarbeiten."
Seit 2010 wurde der staatliche Zuschuss für die unabhängige Theatergruppe Krétakör systematisch gekürzt. Seit diesem Jahr gibt es nun gar nichts mehr. Mit dem Regisseur und Gründer von Krétakör, Árpád Schilling, sprach Zsuzsa Mátraházi über Projekte der Gruppe (eine neue Inszenierung mit dem Titel "Loser" und eine Faust-Inszenierung Schillings im Frühjahr), sowie über die Intellektuellen in Ungarn. ""Loser" wollen wir durch Crowdfunding finanzieren. (…) Als Hilferuf gedacht, geht es dabei um die Intellektuellen, die vom Staat abhängen und sich immer wieder einreden, weiter ruhig zu bleiben. Das Problem sei noch nicht so groß. Wenn es wirklich schlimm werde, dann werde man sich auch zu Wort melden. So steigen wir ab. Ich war schockiert, als Imre Kertész die Auszeichnung Viktor Orbáns annahm. Sollten wir das tun? (…) Wir beschränken uns heute nicht mehr auf das Künstlerische. Wir werfen gesellschaftliche Fragen auf und ziehen so das Publikum an. Zu einem Theaterereignis kommen mehr Menschen als zu einer Konferenz oder einem Forum. Daneben gibt es ein gemeinsames Schülerprogramm mit dem Goethe-Institut (Freie Schule), bei dem wir gesellschaftliche Probleme mit Schülern aus Budapest, Miskolc und Berlin aufarbeiten."Guardian (UK), 13.10.2014
 William Boyd feiert die malerische Kraft und Intensität von Egon Schiele, dem die Courtauld Gallery die Ausstellung "The Radikal Nude" widmet. Er versteht Schieles Werk als Attacke auf das bürgerliche Wien, das zwar bereits Freud und Wittgenstein, Mahler und Schönberg hinter sich hatte: "Immer und immer wieder kehrte er zu den posierenden nackten Figuren zurück, männlichen und weiblichen - die ultimative Bewährungsprobe für den Rang eines Künstlers und seine malerische Fähigkeiten, wie der Kritiker Robert Hughes meinte. Und doch gibt es eine nicht zu leugnende fast pornografische Intensität in vielen seiner Zeichnungen, und diese dienten ihm zur sexuelle Anregung, wie er auch viele Porträtstudien seiner selbst anfertigt, während er masturbierte. Er war überhaupt einer der am meisten fotografierten Künstler, der Posen schuf, die selbst heute noch erstaunlich zeitgenössisch wirken." (Bild: Egon Schiele, Kniender Selbstakt, 1910. Leopold Museum, Wien)
William Boyd feiert die malerische Kraft und Intensität von Egon Schiele, dem die Courtauld Gallery die Ausstellung "The Radikal Nude" widmet. Er versteht Schieles Werk als Attacke auf das bürgerliche Wien, das zwar bereits Freud und Wittgenstein, Mahler und Schönberg hinter sich hatte: "Immer und immer wieder kehrte er zu den posierenden nackten Figuren zurück, männlichen und weiblichen - die ultimative Bewährungsprobe für den Rang eines Künstlers und seine malerische Fähigkeiten, wie der Kritiker Robert Hughes meinte. Und doch gibt es eine nicht zu leugnende fast pornografische Intensität in vielen seiner Zeichnungen, und diese dienten ihm zur sexuelle Anregung, wie er auch viele Porträtstudien seiner selbst anfertigt, während er masturbierte. Er war überhaupt einer der am meisten fotografierten Künstler, der Posen schuf, die selbst heute noch erstaunlich zeitgenössisch wirken." (Bild: Egon Schiele, Kniender Selbstakt, 1910. Leopold Museum, Wien)Weitere Artikel: Rupert Thomson verteidigt Nobelpreisträger Patrick Modiano gegen den Vorwrf der Nostalgie. David Shariatmadari liest Karen Armstrongs "Fields of Blood" über Religion und Gewalt. Besprochen werden unter anderem auch David Cronenbergs Roman "Consumed" (Verzehrt) und Colm Toíbíns Roman "Nora Webster".
n+1 (USA), 30.09.2014
 Anlässlich der Grammy-Verleihung und der traditionellen Vorabend-Party des legendären Musikproduzenten Clive Davis reist David Samuels ins Herz der amerikanischen Musikindustrie nach Los Angeles. In einer lesenswerten, anekdotenreichen Reportage beschreibt er eine Branche im Umbruch, die noch die Genies des zwanzigsten Jahrhunderts feiert, während ihr Geschäftsmodell - das Verkaufen von Musik - unüberhörbar ans Ende gekommen ist: "Dass Songwriter zur Zeit das meiste Geld mit Radio-Airplay verdienen, wirkt sich deutlich auf die Art von Songs aus, die zu schreiben für sie interessant ist. Ein Nummer-Eins-Hit in Amerika spielt wohl zwischen 1,5 und 2 Millionen Dollar durch Airplay ein, während ein Song auf einem Platin-Album - also von einem Album, das sich über eine Million mal verkauft hat, was mittlerweile sehr selten geworden ist - nur rund 90.000 Dollar einbringt."
Anlässlich der Grammy-Verleihung und der traditionellen Vorabend-Party des legendären Musikproduzenten Clive Davis reist David Samuels ins Herz der amerikanischen Musikindustrie nach Los Angeles. In einer lesenswerten, anekdotenreichen Reportage beschreibt er eine Branche im Umbruch, die noch die Genies des zwanzigsten Jahrhunderts feiert, während ihr Geschäftsmodell - das Verkaufen von Musik - unüberhörbar ans Ende gekommen ist: "Dass Songwriter zur Zeit das meiste Geld mit Radio-Airplay verdienen, wirkt sich deutlich auf die Art von Songs aus, die zu schreiben für sie interessant ist. Ein Nummer-Eins-Hit in Amerika spielt wohl zwischen 1,5 und 2 Millionen Dollar durch Airplay ein, während ein Song auf einem Platin-Album - also von einem Album, das sich über eine Million mal verkauft hat, was mittlerweile sehr selten geworden ist - nur rund 90.000 Dollar einbringt."Telerama (Frankreich), 12.10.2014
 Weshalb muss man als Muslim den Terrorismus öffentlich verdammen? Über diese Frage unterhält sich Gilles Heuré mit dem Essayisten Akram Belkaïd, der in den entsprechenden Appellen nach der Enthauptung des französischen Bergführers Hervé Gourdels durch algerische Islamisten die Fortdauer eines französischen Unbehagens sieht. "In diesen Appellen kommt ein fundamentaler Widerspruch zum Ausdruck: einerseits warnt man die Muslime vor jeglicher Form des Kommunitarismus; andererseits fordert man sie auf diese schändliche Tat als Muslim offiziell zu verurteilen. Auf diese Weise bestätigt man, dass Muslime im republikanischen Modell noch immer eine Sonderstellung innehaben. Es ist gleichgültig, welcher Mensch diese entsetzlichen Verbrechen missbilligt. Man muss niemanden auffordern, sich zu distanzieren oder seinen Abscheu zum Ausdruck zu bringen: das ist doch logisch."
Weshalb muss man als Muslim den Terrorismus öffentlich verdammen? Über diese Frage unterhält sich Gilles Heuré mit dem Essayisten Akram Belkaïd, der in den entsprechenden Appellen nach der Enthauptung des französischen Bergführers Hervé Gourdels durch algerische Islamisten die Fortdauer eines französischen Unbehagens sieht. "In diesen Appellen kommt ein fundamentaler Widerspruch zum Ausdruck: einerseits warnt man die Muslime vor jeglicher Form des Kommunitarismus; andererseits fordert man sie auf diese schändliche Tat als Muslim offiziell zu verurteilen. Auf diese Weise bestätigt man, dass Muslime im republikanischen Modell noch immer eine Sonderstellung innehaben. Es ist gleichgültig, welcher Mensch diese entsetzlichen Verbrechen missbilligt. Man muss niemanden auffordern, sich zu distanzieren oder seinen Abscheu zum Ausdruck zu bringen: das ist doch logisch."Außerdem ist ein Gespräch mit Arnaud Guigue zu lesen, Autor des Buchs "Truffaut & Godard, la querelle des images". Der fragt sich in seinem Vowort, wie es überhaupt möglich sein konnte, dass diese beiden Regisseure je Freunde waren.
New Statesman (UK), 13.10.2014
 Die aktuelle Ausgabe des New Statesman hat der Künstler Grayson Perry (aka die töpfernde Transe) gestaltet. Mit Martin Amis unterhält sich Perry über das Drama des weißen Mannes, das Glück und die Kunst:
Die aktuelle Ausgabe des New Statesman hat der Künstler Grayson Perry (aka die töpfernde Transe) gestaltet. Mit Martin Amis unterhält sich Perry über das Drama des weißen Mannes, das Glück und die Kunst: "GP: Von einem Künstler haben die Leute oft dieses Klischee im Kopf, dass man die Existenz unter mörderischen Qualen erleidet. Ich dagegen hatte von Anfang an den Ehrgeiz, das Glück in meine Arbeit zu bringen, ein möglichst komplexes Bild von Glück zu schaffen.
MA: Eine wirklich scharfsinnige Bemerkung über das Glück in der Kunst kommt von Maupassant. Er hat gesagt: Das Problem mit dem Glück ist, dass es wie mit weißer Tinte geschrieben scheint, man kann es auf Papier nicht erkennen. Wie wenig Schriftsteller haben es überhaupt geschafft, das Glück auf ihren Seiten zum Schwingen zu bringen. Tolstoi vielleicht - die kurzen Moment von Glück in "Anna Karenina", nicht in Annas Geschichte, sondern in der Geschichte von Lewin; und dann ist da diese schöne Novelle, "Happy Ever After", in der gibt es eine hinreißende Beschreibung von Glück. Aber natürlich ist das echt schwer. In der Kunst geht es um Anspannung.
GP: Ich frage mich manchmal, ob das mit der Ernsthaftigkeit ein Problem des Brandings ist - dass irgendwie die verkrüppelte Gefühlswelt eines suizidalen Mannes in der Kultur dominant wurde. Das ist dann ernst."
Weiteres: In einem zweiten Text verfolgt Perry den Aufstieg des weißen, heterosexuellen Mittelklasse-Manns. AA Gil huldigt dem Anzug als der erfolgreichsten Produkt der britischen Inseln.
Hitfix (USA), 06.10.2014
 In zwei kommenden Filmen - Danny Gilroys "Nightcrawler" mit Jake Gyllenhall in der Hauptrolle und Paul Thomas Andersons "Inherent Vice" (mehr), basierend auf Thomas Pynchons gleichnamigem Roman - bildet Los Angeles mehr als bloß die Kulisse. Beide Filme - ersterer digital, der zweite ausdrücklich auf klassischem Filmmaterial gedreht - hat der Kameramann Robert Elswitt geschossen. Für Hitfix hat sich Kristopher Tapley ausführlich mit ihm unterhalten, unter anderem darüber, wie man die Stadt trotz engem Drehplan prägnant in Szene setzt. Insbesondere das nächtliche Glimmen der Stadt ist hier eine Frage der Technik: "Darin liegt der wunderbare Vorteil, wenn man mit der Alexa oder anderem digitalen Equipment dreht. Man hat einfach mehr Belichtung. Man sieht das Leuchten der Stadt im Himmel und hat einfach ein bisschen mehr Spielraum. ... Doch die Stadt ist so diffus und sonderbar. Vielleicht auch, weil ich dort aufgewachsen bin, habe ich kein griffiges Bild dieser Stadt. Deshalb ist es so schwierig, Los Angeles zum Bestandteil eines Films zu machen, ganz anders als New York - diese Stadt ist immer ein Charakter. ... Es gibt hier einfach so viele verschiedene Orte, so unterschiedliche Stadtbilder. Und vom Strand und Downtown mal abgesehen, nutzt diese niemand auf besondere Weise. Weshalb die Zusammenarbeit mit Paul sehr schön war, weil er mir das Valley zeigte - und dessen Banalität bildet gewissermaßen dessen Charme. Seine sozusagen stromlinienförmige, rasterförmige und, nun ja, quasi langweilige Charakterlosigkeit war etwas, was Paul sehr zu schätzen wusste. Er erkannte die Schönheit darin."
In zwei kommenden Filmen - Danny Gilroys "Nightcrawler" mit Jake Gyllenhall in der Hauptrolle und Paul Thomas Andersons "Inherent Vice" (mehr), basierend auf Thomas Pynchons gleichnamigem Roman - bildet Los Angeles mehr als bloß die Kulisse. Beide Filme - ersterer digital, der zweite ausdrücklich auf klassischem Filmmaterial gedreht - hat der Kameramann Robert Elswitt geschossen. Für Hitfix hat sich Kristopher Tapley ausführlich mit ihm unterhalten, unter anderem darüber, wie man die Stadt trotz engem Drehplan prägnant in Szene setzt. Insbesondere das nächtliche Glimmen der Stadt ist hier eine Frage der Technik: "Darin liegt der wunderbare Vorteil, wenn man mit der Alexa oder anderem digitalen Equipment dreht. Man hat einfach mehr Belichtung. Man sieht das Leuchten der Stadt im Himmel und hat einfach ein bisschen mehr Spielraum. ... Doch die Stadt ist so diffus und sonderbar. Vielleicht auch, weil ich dort aufgewachsen bin, habe ich kein griffiges Bild dieser Stadt. Deshalb ist es so schwierig, Los Angeles zum Bestandteil eines Films zu machen, ganz anders als New York - diese Stadt ist immer ein Charakter. ... Es gibt hier einfach so viele verschiedene Orte, so unterschiedliche Stadtbilder. Und vom Strand und Downtown mal abgesehen, nutzt diese niemand auf besondere Weise. Weshalb die Zusammenarbeit mit Paul sehr schön war, weil er mir das Valley zeigte - und dessen Banalität bildet gewissermaßen dessen Charme. Seine sozusagen stromlinienförmige, rasterförmige und, nun ja, quasi langweilige Charakterlosigkeit war etwas, was Paul sehr zu schätzen wusste. Er erkannte die Schönheit darin." La regle du jeu (Frankreich), 06.10.2014
 Bernard-Henri Levy nennt in seiner Kolumne die drei Argumente des heutigen Antisemitismus. Demnach lehne er sich an folgende drei Grundaussagen an: "1. Die Juden sind verabscheuungswürdig, weil sie solidarisch mit einem Staat sind, der seinerseits verabscheuungswürdig ist: Das ist die antizionistische Aussage. 2. Die Juden sind umso verabscheuungswürdiger, als der Kitt dieses Staates die Religion eines Leidens ist, von dem nicht ausgeschlossen ist, dass es eingebildet oder doch auf jeden Fall übertrieben ist: Das ist die den Holocaust leugnende Aussage. 3. Indem die Juden so vorgehen und handeln, vergreifen sich quasi am Weltkapital des verfügbaren Mitgefühls, und fügen dieser zweifachen Infamie noch die hinzu, die Menschheit taub gegenüber anderen Leiden anderer Völker zu machen, angefangen natürlich mit dem palästinensischen Volk: Und dies ist das Thema der Opferkonkurrenz."
Bernard-Henri Levy nennt in seiner Kolumne die drei Argumente des heutigen Antisemitismus. Demnach lehne er sich an folgende drei Grundaussagen an: "1. Die Juden sind verabscheuungswürdig, weil sie solidarisch mit einem Staat sind, der seinerseits verabscheuungswürdig ist: Das ist die antizionistische Aussage. 2. Die Juden sind umso verabscheuungswürdiger, als der Kitt dieses Staates die Religion eines Leidens ist, von dem nicht ausgeschlossen ist, dass es eingebildet oder doch auf jeden Fall übertrieben ist: Das ist die den Holocaust leugnende Aussage. 3. Indem die Juden so vorgehen und handeln, vergreifen sich quasi am Weltkapital des verfügbaren Mitgefühls, und fügen dieser zweifachen Infamie noch die hinzu, die Menschheit taub gegenüber anderen Leiden anderer Völker zu machen, angefangen natürlich mit dem palästinensischen Volk: Und dies ist das Thema der Opferkonkurrenz."Playboy (USA), 16.09.2014
 Seine beiden Oscar-Nominierungen bekam David Fincher für "The Curious Case of Benjamin Button" und "The Social Network", aber noch stärker wird er mit seinen düsteren Filme um Serienkiller und zerrüttete Existenzen assoziiert, mit "Se7en", "Fight Club" und "Zodiac". Auf dieses Image fühlt er sich auch innerhalb der Filmindustrie reduziert, wie er Stephen Rebello in einem großen und sehr lesenswerten Interview erzählt: "Wenn es in Hollywood ein Drehbuch gibt, in dem ein Serienmörder - oder irgendein Mörder - vorkommt, dann muss mir das zugeschickt werden, da habe ich gar keine Wahl. [lacht] Aber die Verantwortung, die ich vor mir selbst habe, ist stets: soll ich die Massenware herstellen, die die Leute von mir wollen, oder soll ich das Zeug machen, das mich interessiert? Ich habe große Schwierigkeiten mit Material. Die meisten Komödien kann ich nicht leiden, weil ich es nicht mag, wenn Charaktere versuchen, mich für sie einzunehmen. Ich werde nicht gerne umschmeichelt. Ich mag keine Unterwürfigkeit. Ich habe auch Vorbehalte gegen Filme, in denen sich zwei Leute ineinander verlieben, nur weil sie die Stars sind und ihre Namen über dem Titel stehen."
Seine beiden Oscar-Nominierungen bekam David Fincher für "The Curious Case of Benjamin Button" und "The Social Network", aber noch stärker wird er mit seinen düsteren Filme um Serienkiller und zerrüttete Existenzen assoziiert, mit "Se7en", "Fight Club" und "Zodiac". Auf dieses Image fühlt er sich auch innerhalb der Filmindustrie reduziert, wie er Stephen Rebello in einem großen und sehr lesenswerten Interview erzählt: "Wenn es in Hollywood ein Drehbuch gibt, in dem ein Serienmörder - oder irgendein Mörder - vorkommt, dann muss mir das zugeschickt werden, da habe ich gar keine Wahl. [lacht] Aber die Verantwortung, die ich vor mir selbst habe, ist stets: soll ich die Massenware herstellen, die die Leute von mir wollen, oder soll ich das Zeug machen, das mich interessiert? Ich habe große Schwierigkeiten mit Material. Die meisten Komödien kann ich nicht leiden, weil ich es nicht mag, wenn Charaktere versuchen, mich für sie einzunehmen. Ich werde nicht gerne umschmeichelt. Ich mag keine Unterwürfigkeit. Ich habe auch Vorbehalte gegen Filme, in denen sich zwei Leute ineinander verlieben, nur weil sie die Stars sind und ihre Namen über dem Titel stehen."Himal (Nepal), 17.09.2014
 Die indische Journalistin Taran N Khan lernt in Afghanistan erstaunt, dass ausgerechnet Kabul seit Jahrzehnten ganz und gar verliebt ist in die Filme aus dem fernen, indischen Mumbai, vulgo Bollywood. Dabei handelt es sich um eine Liebe, erfahren wir, die Geschichten aus den großen Klassikern ganz selbstverständlich in die eigene Folklore eingemeindet. Selbst die Jahre unter den Taliban konnte dem nichts anhaben, wie Khan von einigen Frauen erfährt: Da sie weder zur Schule noch zur Arbeit gehen durften, verschanzten sie sich in einem kleinen Raum mit ausgeschwärzten Fenstern, wo sie die streng verbotenen Filme aus Bollywood sahen: "Bestrafung oder eine Haftstrafe für so etwas triviales und trashiges wie Bollywood-Entertainer zu riskieren, schien mir haarsträubend und auch ein bisschen wie ein Verrat am hohen Standard, den man von Geschichten aus Krieg und Repression erwarten würde. Doch wer bin ich, über den Wert von Objekten und Möglichkeiten zum Zeitvertreib zu richten, insbesondere in einem Leben, in dem einem jegliches Vergnügen, das sich bot, geraubt wurde? Für die in den Zimmern eingesperrten Mädchen in Kabul und ihre Schicksalsgenossinnen luden sich die flackernden Bilder auf dem kleinen Fernseher mit enormer Bedeutung auf. Sie wurden etwas, für das es wert war zu leben und sich zu verstecken. So etwas wie ein Zufluchtsort, ein Ort an dem sie dem am nächsten sein konnten, was sie einst waren."
Die indische Journalistin Taran N Khan lernt in Afghanistan erstaunt, dass ausgerechnet Kabul seit Jahrzehnten ganz und gar verliebt ist in die Filme aus dem fernen, indischen Mumbai, vulgo Bollywood. Dabei handelt es sich um eine Liebe, erfahren wir, die Geschichten aus den großen Klassikern ganz selbstverständlich in die eigene Folklore eingemeindet. Selbst die Jahre unter den Taliban konnte dem nichts anhaben, wie Khan von einigen Frauen erfährt: Da sie weder zur Schule noch zur Arbeit gehen durften, verschanzten sie sich in einem kleinen Raum mit ausgeschwärzten Fenstern, wo sie die streng verbotenen Filme aus Bollywood sahen: "Bestrafung oder eine Haftstrafe für so etwas triviales und trashiges wie Bollywood-Entertainer zu riskieren, schien mir haarsträubend und auch ein bisschen wie ein Verrat am hohen Standard, den man von Geschichten aus Krieg und Repression erwarten würde. Doch wer bin ich, über den Wert von Objekten und Möglichkeiten zum Zeitvertreib zu richten, insbesondere in einem Leben, in dem einem jegliches Vergnügen, das sich bot, geraubt wurde? Für die in den Zimmern eingesperrten Mädchen in Kabul und ihre Schicksalsgenossinnen luden sich die flackernden Bilder auf dem kleinen Fernseher mit enormer Bedeutung auf. Sie wurden etwas, für das es wert war zu leben und sich zu verstecken. So etwas wie ein Zufluchtsort, ein Ort an dem sie dem am nächsten sein konnten, was sie einst waren."New York Times (USA), 12.10.2014
 Food Issue im New York Times Magazine. Vor allem geht es darum, was die lieben Kleinen essen. Das stößt auf großes Interesse, wie die vielen Kommentare zeigen. Etwa zu Mark Bittmans Artikel, in dem der Kochbuchautor fordert, Kinder wirklich alles essen zu lassen, gar nicht so leicht heutzutage: "In den achtziger und neunzigern war es einfacher, Kinder mit richtigem Essen zu ernähren. Heute ist zu vieles außer Kontrolle. Unternehmen geben Milliarden aus, um Junk Food zu bewerben; Snacks und Kalorienreiche süße Getränke sind allgegenwärtig. Mein Rat: Eltern solllten ihre Einkaufszettel und Speisekammern von diesem Junk frei halten und Regeln aufstellen, was ihre Kinder essen sollen. Bringen sie den Kindern bei, Möhren, Sellerie, Früchte, Hummus und Guacamole als Snack zu essen, Bohnen und Getreide. Bieten sie diese Dinge ständig an. ... Eltern benötigen Entschlossenheit, Disziplin, Stärke und einen Plan." Klar, denn Kinder, die Süßes wollen können zu erbarmungslosen Terroristen werden.
Food Issue im New York Times Magazine. Vor allem geht es darum, was die lieben Kleinen essen. Das stößt auf großes Interesse, wie die vielen Kommentare zeigen. Etwa zu Mark Bittmans Artikel, in dem der Kochbuchautor fordert, Kinder wirklich alles essen zu lassen, gar nicht so leicht heutzutage: "In den achtziger und neunzigern war es einfacher, Kinder mit richtigem Essen zu ernähren. Heute ist zu vieles außer Kontrolle. Unternehmen geben Milliarden aus, um Junk Food zu bewerben; Snacks und Kalorienreiche süße Getränke sind allgegenwärtig. Mein Rat: Eltern solllten ihre Einkaufszettel und Speisekammern von diesem Junk frei halten und Regeln aufstellen, was ihre Kinder essen sollen. Bringen sie den Kindern bei, Möhren, Sellerie, Früchte, Hummus und Guacamole als Snack zu essen, Bohnen und Getreide. Bieten sie diese Dinge ständig an. ... Eltern benötigen Entschlossenheit, Disziplin, Stärke und einen Plan." Klar, denn Kinder, die Süßes wollen können zu erbarmungslosen Terroristen werden.Elet es Irodalom (Ungarn), 06.10.2014
 Der Philosoph Gáspár Miklós Tamás denkt über die Prägung des Denkens durch das immer beängstigendere Orban-Regime nach: "Das weltanschauliche Waffenarsenal des Regimes ist zwar spärlich, dennoch deformiert es durch seine Stärke immer mehr Diskurse und drückt ihnen seinen Stempel auf. (...) Die oppositionelle Öffentlichkeit analysiert mit manischer Akribie die Erklärungen der Anführer des Systems (....), weil in diesen die arcana imperii, die Geheimnisse der Macht, vermutet werden. (...) Das Verstehen wird aber dadurch instrumentell: (...) dem System wird die Bestimmung von Terminologie und Theorien überlassen, und der kritische Diskurs geschwächt."
Der Philosoph Gáspár Miklós Tamás denkt über die Prägung des Denkens durch das immer beängstigendere Orban-Regime nach: "Das weltanschauliche Waffenarsenal des Regimes ist zwar spärlich, dennoch deformiert es durch seine Stärke immer mehr Diskurse und drückt ihnen seinen Stempel auf. (...) Die oppositionelle Öffentlichkeit analysiert mit manischer Akribie die Erklärungen der Anführer des Systems (....), weil in diesen die arcana imperii, die Geheimnisse der Macht, vermutet werden. (...) Das Verstehen wird aber dadurch instrumentell: (...) dem System wird die Bestimmung von Terminologie und Theorien überlassen, und der kritische Diskurs geschwächt."
Newsweek | Hitfix | La regle du jeu | Playboy | Himal | New York Times | Elet es Irodalom | New Yorker | New Republic | HVG | Guardian | n+1 | Telerama | New Statesman
Kommentieren