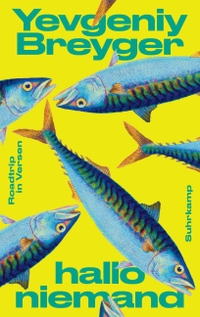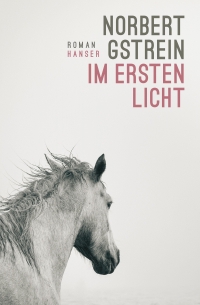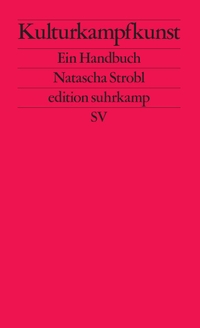Magazinrundschau
Wow, das ist ein Verb
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
The Nation (USA), 27.01.2020
 Für einem Beitrag des Magazins reist Amy Wilentz ins korruptionsgeplagte Haiti: "Wem gehört das Land? Dem Volk, der Regierung oder den Geschäftsleuten? 'Wo ist das Geld von PetroCaribe?' lautet der Slogan der Demonstranten mit Bezug auf das Hilfsprogramm von Hugo Chavez, dessen Gelder Regierungsbeamte und Haitis Präsident Jovenel Moïse veruntreut haben. Die Gelder waren für dringend benötigte Wohnungen, sanitäre Anlagen, Straßen und das Gesundheitswesen gedacht, aber das meiste davon ist in dunklen Kanälen verschwunden. Letzten Herbst legte die Opposition immer wieder das Land lahm. Die Leute konnten nichts zu Essen kaufen und hungerten, sie konnten keine Ärzte aufsuchen, nicht arbeiten, zur Schule gehen oder auch nur begraben werden. In dieser Zeit rief die Opposition verschiedene Berufsgruppen zu Protesten auf, aber unterdessen machten bewaffnete Gangs die Straßen unsicher. Dennoch will Moïse bis 2022 weiterregieren. Letzten Monat ging er von virtuellem Schweigen in einen Neo-Duvalier-Modus über, indem er sagte, Köpfe würden rollen, wenn jemand sich ihm in den Weg stellte. Die massiven Proteste ignorierend, konzentriert Moïse seine Wut auf einen Energieversorger, den er schon lange gern kontrollieren würde, weil die Korruptionsmöglichkeiten riesig wären … Haiti bewegt sich gerade von der oppositionellen Blockade, die mit echtem Druck auf einen Regierungswechsel zielte, in einen Zustand politischer Paralyse, die keinen Ausweg erkennen lässt. Moïses Position bleibt prekär. Ein wütendes, militantes Volk versucht ihn aus dem Amt zu drängen, während seine Freunde alles daran setzen, ihn im Amt zu halten, so dass die Plünderung des Landes weitergehen kann. Moïse sorgt sich um das Volk und um seine Freunde gleichermaßen. Auf Französisch würde man seine Lage als coincé bezeichnen, in die Ecke getrieben."
Für einem Beitrag des Magazins reist Amy Wilentz ins korruptionsgeplagte Haiti: "Wem gehört das Land? Dem Volk, der Regierung oder den Geschäftsleuten? 'Wo ist das Geld von PetroCaribe?' lautet der Slogan der Demonstranten mit Bezug auf das Hilfsprogramm von Hugo Chavez, dessen Gelder Regierungsbeamte und Haitis Präsident Jovenel Moïse veruntreut haben. Die Gelder waren für dringend benötigte Wohnungen, sanitäre Anlagen, Straßen und das Gesundheitswesen gedacht, aber das meiste davon ist in dunklen Kanälen verschwunden. Letzten Herbst legte die Opposition immer wieder das Land lahm. Die Leute konnten nichts zu Essen kaufen und hungerten, sie konnten keine Ärzte aufsuchen, nicht arbeiten, zur Schule gehen oder auch nur begraben werden. In dieser Zeit rief die Opposition verschiedene Berufsgruppen zu Protesten auf, aber unterdessen machten bewaffnete Gangs die Straßen unsicher. Dennoch will Moïse bis 2022 weiterregieren. Letzten Monat ging er von virtuellem Schweigen in einen Neo-Duvalier-Modus über, indem er sagte, Köpfe würden rollen, wenn jemand sich ihm in den Weg stellte. Die massiven Proteste ignorierend, konzentriert Moïse seine Wut auf einen Energieversorger, den er schon lange gern kontrollieren würde, weil die Korruptionsmöglichkeiten riesig wären … Haiti bewegt sich gerade von der oppositionellen Blockade, die mit echtem Druck auf einen Regierungswechsel zielte, in einen Zustand politischer Paralyse, die keinen Ausweg erkennen lässt. Moïses Position bleibt prekär. Ein wütendes, militantes Volk versucht ihn aus dem Amt zu drängen, während seine Freunde alles daran setzen, ihn im Amt zu halten, so dass die Plünderung des Landes weitergehen kann. Moïse sorgt sich um das Volk und um seine Freunde gleichermaßen. Auf Französisch würde man seine Lage als coincé bezeichnen, in die Ecke getrieben."El Pais Semanal (Spanien), 21.01.2020
 Die Journalistin Amelia Castilla berichtet in einer ausführlichen Reportage über den Alltag der rund 10.000, zwischen achtzehn und achtzig Jahre alten "Schlepperinnen" im buchstäblichen Sinn an der spanisch-marokkanischen Grenze in den Enklaven Ceuta und Melilla: "Für Tageslöhne zwischen 10 und 30 Euro - je nach Gewicht - schleppen sie bis zu 80 Kilo schwere Bündel über die Grenze nach Marokko, beziehungsweise 'so viel, wie ein Mensch allein tragen kann', was aus marokkanischer Sicht, zumindest vorläufig noch, eine legale Wareneinfuhr darstellt - aus spanischer bzw. europäischer Sicht gibt es ohnehin kein Problem: Die von asiatischen, algerischen, französischen oder spanischen Unternehmen per Schiff angelieferten Waren sind, mit der vor Ort stark reduzierten Mehrwertsteuer, legal in Ceuta oder Melilla, und damit in Spanien, erworben worden und füllen später beispielsweise marokkanische Supermarktregale." Auf marokkanischer Seite begehrt ist auch französischer Pastis, dessen Einfuhr ist jedoch, da Alkohol, verboten. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich manche Schlepperinnen Flasche um Flasche davon mit Klebeband am Leib befestigen. Darüber können noch mehrere Schichten ebenfalls zu verkaufender Textilien kommen. Für die oft stundenlangen Wartezeiten bis zum Überqueren der Grenze behelfen manche Frauen sich mit Windeln, um bloß nicht aus der Warteschlange aussteigen zu müssen.
Die Journalistin Amelia Castilla berichtet in einer ausführlichen Reportage über den Alltag der rund 10.000, zwischen achtzehn und achtzig Jahre alten "Schlepperinnen" im buchstäblichen Sinn an der spanisch-marokkanischen Grenze in den Enklaven Ceuta und Melilla: "Für Tageslöhne zwischen 10 und 30 Euro - je nach Gewicht - schleppen sie bis zu 80 Kilo schwere Bündel über die Grenze nach Marokko, beziehungsweise 'so viel, wie ein Mensch allein tragen kann', was aus marokkanischer Sicht, zumindest vorläufig noch, eine legale Wareneinfuhr darstellt - aus spanischer bzw. europäischer Sicht gibt es ohnehin kein Problem: Die von asiatischen, algerischen, französischen oder spanischen Unternehmen per Schiff angelieferten Waren sind, mit der vor Ort stark reduzierten Mehrwertsteuer, legal in Ceuta oder Melilla, und damit in Spanien, erworben worden und füllen später beispielsweise marokkanische Supermarktregale." Auf marokkanischer Seite begehrt ist auch französischer Pastis, dessen Einfuhr ist jedoch, da Alkohol, verboten. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich manche Schlepperinnen Flasche um Flasche davon mit Klebeband am Leib befestigen. Darüber können noch mehrere Schichten ebenfalls zu verkaufender Textilien kommen. Für die oft stundenlangen Wartezeiten bis zum Überqueren der Grenze behelfen manche Frauen sich mit Windeln, um bloß nicht aus der Warteschlange aussteigen zu müssen.Cosmopolitan (USA), 21.01.2020
 Religiöse Gemeinschaften, die sich von der übrigen Umwelt abschotten, können leicht zur Brutstätte für Verbrechen werden, eben weil sie nichts nach außen dringen lassen. Wie das funktioniert, erzählt Sarah McClure in einer Reportage über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bei den Amish. "Während meiner Recherchen fand ich 52 offizielle Fälle von sexuellen Übergriffen auf Amish-Kinder in sieben Staaten in den letzten zwei Jahrzehnten. Erschreckenderweise gibt diese Zahl nicht annähernd das ganze Bild wieder. Praktisch alle Opfer, mit denen ich sprach - meist Frauen, aber auch mehrere Männer - erzählten mir, dass sie von ihrer Familie oder den Kirchenführern davon abgehalten wurden, ihren Missbrauch der Polizei zu melden, oder dass sie konditioniert worden waren, keine Hilfe von außen zu suchen. ... Es ist üblich, dass die Amish-Gemeinschaft die Opfer für genauso schuldig hält wie die Vergewaltiger - als einwilligende Partner, die Ehebruch begehen, selbst wenn sie Kinder sind. Von den Opfern wird erwartet, dass sie die Verantwortung mittragen und, nachdem die Kirche den Täter bestraft hat, schnell vergeben. Wenn sie dies nicht tun, sind sie das Problem. Wenn - selten genug - tatsächlich mal ein Fall vor Gericht kommt, unterstützen die Amishen mit überwältigender Mehrheit die Täter, die in der Regel mit fast ihrer gesamten Gemeinde hinter ihnen erscheinen, sagen Überlebende und Strafverfolgungsbehörden. Das kann das Trauma des Sprechens noch verstärken. 'Wir hatten Fälle, in denen 50 Amish für den Täter eintraten und niemand für das Opfer sprach', erinnert sich der Richter Craig Stedman."
Religiöse Gemeinschaften, die sich von der übrigen Umwelt abschotten, können leicht zur Brutstätte für Verbrechen werden, eben weil sie nichts nach außen dringen lassen. Wie das funktioniert, erzählt Sarah McClure in einer Reportage über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen bei den Amish. "Während meiner Recherchen fand ich 52 offizielle Fälle von sexuellen Übergriffen auf Amish-Kinder in sieben Staaten in den letzten zwei Jahrzehnten. Erschreckenderweise gibt diese Zahl nicht annähernd das ganze Bild wieder. Praktisch alle Opfer, mit denen ich sprach - meist Frauen, aber auch mehrere Männer - erzählten mir, dass sie von ihrer Familie oder den Kirchenführern davon abgehalten wurden, ihren Missbrauch der Polizei zu melden, oder dass sie konditioniert worden waren, keine Hilfe von außen zu suchen. ... Es ist üblich, dass die Amish-Gemeinschaft die Opfer für genauso schuldig hält wie die Vergewaltiger - als einwilligende Partner, die Ehebruch begehen, selbst wenn sie Kinder sind. Von den Opfern wird erwartet, dass sie die Verantwortung mittragen und, nachdem die Kirche den Täter bestraft hat, schnell vergeben. Wenn sie dies nicht tun, sind sie das Problem. Wenn - selten genug - tatsächlich mal ein Fall vor Gericht kommt, unterstützen die Amishen mit überwältigender Mehrheit die Täter, die in der Regel mit fast ihrer gesamten Gemeinde hinter ihnen erscheinen, sagen Überlebende und Strafverfolgungsbehörden. Das kann das Trauma des Sprechens noch verstärken. 'Wir hatten Fälle, in denen 50 Amish für den Täter eintraten und niemand für das Opfer sprach', erinnert sich der Richter Craig Stedman."HVG (Ungarn), 16.01.2020
 Kürzlich wurde von Prominenten der ungarischen Regierungspartei Fidesz erneut eine Büste des völkischen Schriftstellers Albert Wass enthüllt. Diesmal geschah dies in einem Park, der nach dem ungarischen Dichter und Holocaustopfer Miklós Radnóti benannt wurde - "ein unglücklicher Zufall", so einige Apologeten der Büste, die bedauern, dass "vorab die Sensibilität der Betroffenen" nicht genügend berücksichtigt wurde. Anlass für den Publizisten Sándor Révész über die Begriffe Sensibilität und Betroffenheit nachzudenken: "Nun, wer sich auf die Sensibilität der Betroffenen beruft, sei als Außenstehender oder als selbst Betroffene, der nimmt an, dass ein Genozid keine Sache der Menschheit sei, sondern nur jener Gruppe, von deren Vernichtung gerade die Rede ist. Es sei keine universale, sondern eine partikulare Angelegenheit. Wenn es richtig ist, dass ein Genozid allgemein gesehen eine außerordentlich falsche Sache ist, wie kann dann akzeptiert werden, dass die Sensibilität dafür nicht allgemein ist? Dass die Welt in zwei Hälften geteilt werden kann: die Sensiblen und jene, die diese Sensibilität respektieren sollen? Diejenigen, die sich auf die Sensibilität berufen, degradieren selbst, wofüber sie sensibel sind! Freilich ist jeder sensibler bei Angelegenheiten, die einem näher sind, doch die Anerkennung der Stufen der Sensibilität ist eine grundsätzlich andere Sache, als die Trennung zwischen Sensiblen und Anderen."
Kürzlich wurde von Prominenten der ungarischen Regierungspartei Fidesz erneut eine Büste des völkischen Schriftstellers Albert Wass enthüllt. Diesmal geschah dies in einem Park, der nach dem ungarischen Dichter und Holocaustopfer Miklós Radnóti benannt wurde - "ein unglücklicher Zufall", so einige Apologeten der Büste, die bedauern, dass "vorab die Sensibilität der Betroffenen" nicht genügend berücksichtigt wurde. Anlass für den Publizisten Sándor Révész über die Begriffe Sensibilität und Betroffenheit nachzudenken: "Nun, wer sich auf die Sensibilität der Betroffenen beruft, sei als Außenstehender oder als selbst Betroffene, der nimmt an, dass ein Genozid keine Sache der Menschheit sei, sondern nur jener Gruppe, von deren Vernichtung gerade die Rede ist. Es sei keine universale, sondern eine partikulare Angelegenheit. Wenn es richtig ist, dass ein Genozid allgemein gesehen eine außerordentlich falsche Sache ist, wie kann dann akzeptiert werden, dass die Sensibilität dafür nicht allgemein ist? Dass die Welt in zwei Hälften geteilt werden kann: die Sensiblen und jene, die diese Sensibilität respektieren sollen? Diejenigen, die sich auf die Sensibilität berufen, degradieren selbst, wofüber sie sensibel sind! Freilich ist jeder sensibler bei Angelegenheiten, die einem näher sind, doch die Anerkennung der Stufen der Sensibilität ist eine grundsätzlich andere Sache, als die Trennung zwischen Sensiblen und Anderen."New Statesman (UK), 20.01.2020
 John Gray haut es Labour um die Ohren, dass ihnen Boris Johnson ausgerechnet nach einer Dekade konservativer Austeritätspolitik ihre Stammklientel abspenstig machen konnte. Die Arbeiterschaft im englischen Nordens auch nach dem Brexit zu halten, wenn Fabriken schließen und Bauern bankrott gehen werden, könnte schwer werden für die Tories - aber leicht, wenn Labour weiter bei dem von Corbyn gesetzten Kurs bleibe: "Als Labours Wähler zu Johnson wechselten, waren sie ebenso von ihren materiellen Interessen motiviert wie von ihrer moralischen Abscheu. Wie Umfragen bestätigen, lehnten sie Labour ab, weil es eine Partei geworden ist, die alles verhöhnt, was ihnen teuer ist. Viele verweisen auf Corbyn Unterstützung für Bewegungen und Regimes, die dem Westen gegenüber offen feindlich gestimmt sind. Viele nannten den Antisemitismus als ein Übel, gegen das ihre Eltern oder Großeltern in den Krieg gezogen sind. Für Wähler aus der Arbeiterschaft hat sich Labour gegen Patriotismus und moralischen Anstand gestellt. Für Corbyn-Anhänger sind diese Werte, so wie sie von der Mehrheit der britischen Bevölkerung betrachtet werden, nur Ausdruck eines falschen Bewusstseins."
John Gray haut es Labour um die Ohren, dass ihnen Boris Johnson ausgerechnet nach einer Dekade konservativer Austeritätspolitik ihre Stammklientel abspenstig machen konnte. Die Arbeiterschaft im englischen Nordens auch nach dem Brexit zu halten, wenn Fabriken schließen und Bauern bankrott gehen werden, könnte schwer werden für die Tories - aber leicht, wenn Labour weiter bei dem von Corbyn gesetzten Kurs bleibe: "Als Labours Wähler zu Johnson wechselten, waren sie ebenso von ihren materiellen Interessen motiviert wie von ihrer moralischen Abscheu. Wie Umfragen bestätigen, lehnten sie Labour ab, weil es eine Partei geworden ist, die alles verhöhnt, was ihnen teuer ist. Viele verweisen auf Corbyn Unterstützung für Bewegungen und Regimes, die dem Westen gegenüber offen feindlich gestimmt sind. Viele nannten den Antisemitismus als ein Übel, gegen das ihre Eltern oder Großeltern in den Krieg gezogen sind. Für Wähler aus der Arbeiterschaft hat sich Labour gegen Patriotismus und moralischen Anstand gestellt. Für Corbyn-Anhänger sind diese Werte, so wie sie von der Mehrheit der britischen Bevölkerung betrachtet werden, nur Ausdruck eines falschen Bewusstseins."Harper's Magazine (USA), 01.02.2020
 In Brasilien erleben evangelikale Christen einen erheblichen Zulauf und das insbesondere aus dem Gang- und Drogendealer-Milieu, berichtet Alex Cuadros. Einerseits schwächt dies die kriminellen Strukturen und bietet vielen Kriminellen neuen Halt. Andererseits erlebt das Land durch den oft missionarischen Eifer derjenigen, die den Glauben neu für sich entdeckt haben, neue Gewaltexzesse: Einem Pastor etwa "geht es auch darum, junge Männer von afro-brasilianischen Glaubensrichtungen wie Candomblé und Umbanda zu 'befreien'. Deren Geister, sagte er, seien Manifestationen des Feindes. Mit seinen Denunziationen steht dieser Pastor keineswegs alleine da. Der Niedergang der afro-brasilianischen Glaubensrichtungen ist nicht nur das Ergebnis gewandelter Vorlieben. Einige Gangmitglieder sehnen sich danach, ihre Hingabe zu Gott zum Ausdruck zu bringen, sind aber so sehr an die Sprache der Gewalt gewohnt, dass sie dieses Gerede von einem Feind als Erklärung eines Heiligen Kriegs verstehen. In den letzten Jahren häuften sich die eskalierenden Angriffe sogenannter 'Narcopentecostais' auf afro-brasilianische Tempel. Auch Warnvideos wurden gepostet. Eines davon zeigt einen mit Jesus-T-Shirt bekleideten Mann, der heilige Halsketten zerreißt, während ein anderer einen Tempelpriester fragt: 'Weißt du etwa nicht, dass der Herr deinen Aberglaube hier nicht wünscht? ... Wenn ich dich hier noch einmal erwische oder du versuchst, diesen Scheiß hier wieder aufzubauen, dann bringe ich dich um.' Die Opfer solcher Angriffe fürchteten sich davor, mit mir zu sprechen, obwohl ich ihnen zusagte, ihre Namen nicht zu veröffentlichen."
In Brasilien erleben evangelikale Christen einen erheblichen Zulauf und das insbesondere aus dem Gang- und Drogendealer-Milieu, berichtet Alex Cuadros. Einerseits schwächt dies die kriminellen Strukturen und bietet vielen Kriminellen neuen Halt. Andererseits erlebt das Land durch den oft missionarischen Eifer derjenigen, die den Glauben neu für sich entdeckt haben, neue Gewaltexzesse: Einem Pastor etwa "geht es auch darum, junge Männer von afro-brasilianischen Glaubensrichtungen wie Candomblé und Umbanda zu 'befreien'. Deren Geister, sagte er, seien Manifestationen des Feindes. Mit seinen Denunziationen steht dieser Pastor keineswegs alleine da. Der Niedergang der afro-brasilianischen Glaubensrichtungen ist nicht nur das Ergebnis gewandelter Vorlieben. Einige Gangmitglieder sehnen sich danach, ihre Hingabe zu Gott zum Ausdruck zu bringen, sind aber so sehr an die Sprache der Gewalt gewohnt, dass sie dieses Gerede von einem Feind als Erklärung eines Heiligen Kriegs verstehen. In den letzten Jahren häuften sich die eskalierenden Angriffe sogenannter 'Narcopentecostais' auf afro-brasilianische Tempel. Auch Warnvideos wurden gepostet. Eines davon zeigt einen mit Jesus-T-Shirt bekleideten Mann, der heilige Halsketten zerreißt, während ein anderer einen Tempelpriester fragt: 'Weißt du etwa nicht, dass der Herr deinen Aberglaube hier nicht wünscht? ... Wenn ich dich hier noch einmal erwische oder du versuchst, diesen Scheiß hier wieder aufzubauen, dann bringe ich dich um.' Die Opfer solcher Angriffe fürchteten sich davor, mit mir zu sprechen, obwohl ich ihnen zusagte, ihre Namen nicht zu veröffentlichen."
New Yorker (USA), 27.01.2020
 In einem Beitrag des aktuellen Hefts hinterfragt Nathan Heller die Zeitgemäßheit von Risikokapital: Ursprünglich hat es Paradiesvogel-Unternehmen finanziert, aber jetzt steht es hauptsächlich in Geschäftszweigen, die sich direkt an Konsumenten richten. "Schön, dass wir mitunter gratis davon profitieren (denken wir an MoviePass) Aber wie gesund ist das wirklich? Vor 30 Jahren musste man für Qualitätsjournalismus ein Abo buchen, für gutes Kino ein Ticket kaufen und für ein Taxi dem Fahrer den Standardbetrag plus Trinkgeld hinblättern. Die Welt des Risikokapitals hat die Gewohnheit des direkten Austauschs verändert. Heute erwarten wir von bestimmten Dingen, dass sie kostenlos sind, weil ein wohlhabender Finanzier irgendwo die Rechnung bezahlt. Wir bekommen gute Ware und Dienstleistungen, weil Risikokapitalisten ihr Geld in noch nicht gewinnträchtige Unternehmen stecken. Aber wir wertschätzen sie auch weniger. Die amerikanische Walfangindustrie (ein frühes mit Risikokapital angetriebenes Business, d. Red.) brach zusammen, weil die Wale fast ausgerottet worden waren. Heute ist dieses Szenario im Bereich des Risikokapitals nicht weniger real."
In einem Beitrag des aktuellen Hefts hinterfragt Nathan Heller die Zeitgemäßheit von Risikokapital: Ursprünglich hat es Paradiesvogel-Unternehmen finanziert, aber jetzt steht es hauptsächlich in Geschäftszweigen, die sich direkt an Konsumenten richten. "Schön, dass wir mitunter gratis davon profitieren (denken wir an MoviePass) Aber wie gesund ist das wirklich? Vor 30 Jahren musste man für Qualitätsjournalismus ein Abo buchen, für gutes Kino ein Ticket kaufen und für ein Taxi dem Fahrer den Standardbetrag plus Trinkgeld hinblättern. Die Welt des Risikokapitals hat die Gewohnheit des direkten Austauschs verändert. Heute erwarten wir von bestimmten Dingen, dass sie kostenlos sind, weil ein wohlhabender Finanzier irgendwo die Rechnung bezahlt. Wir bekommen gute Ware und Dienstleistungen, weil Risikokapitalisten ihr Geld in noch nicht gewinnträchtige Unternehmen stecken. Aber wir wertschätzen sie auch weniger. Die amerikanische Walfangindustrie (ein frühes mit Risikokapital angetriebenes Business, d. Red.) brach zusammen, weil die Wale fast ausgerottet worden waren. Heute ist dieses Szenario im Bereich des Risikokapitals nicht weniger real."Außerdem: Raffi Khatchadourian stellt die erfolgreiche Sci-Fi-Autorin N.K. Jemisin vor. Ben Taub verfolgt die Versuche, einen irakischen Flüchtling zu retten, der in den USA angeklagt ist, für den IS getötet zu haben. Und Anthony Lane erinnert an das weltvorstellende Kino des Federico Fellini.
Times Literary Supplement (UK), 17.01.2020
 Ein seltsam magischer Zufall, dass sich die Wege der größten englischsprachigen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts - Virginia Woolf, Hilda Doolitle, Dorothy L. Sayers, Jane Ellen Harrison und Eileen Power - am Mecklenburgh Square in London kreuzten. Ann Kennedy Smith blickt unter anderem mit Francesca Wades Buch "Square Hunting" auf die Biografien weiblicher Intellektueller, deren Leben und Schreiben vom Ersten Weltkrieg und der Suche nach künstlerischer Freiheit geprägt war: "Im Jahr 1911 tauschte Hilda Doolittle ihr Leben in Philadelphia für die Londoner Bohème ein und wurde 1913 - nachdem Ezra Pound sie als 'H.D. Imagiste' unter Vertrag nahm und im Poetry Magazine veröffentlichte - zur Dichterin der Moderne mit dem Kürzel H.D. Der Kriegsausbruch änderte alles: Noch bei der Geburt starb ihr Kind und das Verhältnis zu ihrem Ehemann, dem englischen Dichter Richard Aldington, verschlechterte sich. Sie bezog im Februar 1916 ein modriges Apartment am Mecklenburgh Square 44, wo ihre Kreativität 'vom Beigeschmack des Todes im Keim erstickt' wurde. Die Situation verschlimmerte sich, als ihr Ehemann von der Front zurückkehrte und eine Affäre mit der sinnlichen Dorothy 'Arabella' Yorke begann, die eine Wohnung über H.D. mietete. 'Ihr würde ich Verstand geben, dir einen Körper', sagt in Doolittles autobiografischem Roman 'Bid Me To Live' die Figur Rafe (ein kaum getarnter Aldington) zu seiner Frau Julia. D.H. Lawrence, ein gemeinsamer Freund von Aldington und dessen Liebhaberin Yorke, beschrieb die Schriftstellerin als 'eine, die auf dem Drahtseil tanzt. Man fragt sich, ob sie's rüber schafft', und bezog sich auf ihre prekäre Gefühlslage. Doolittle konnte ihre Selbstzweifel besiegen, indem sie Lawrence' Ratschläge ('sein Mann-ist-Mann und Frau-ist-Frau…sein eitles Gerede') entschieden zurückwies. Geschickt enträtselt Wade das Mysterium der Schreibblockade, die H.D. ganze vier Jahrzehnte lang lähmte."
Ein seltsam magischer Zufall, dass sich die Wege der größten englischsprachigen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts - Virginia Woolf, Hilda Doolitle, Dorothy L. Sayers, Jane Ellen Harrison und Eileen Power - am Mecklenburgh Square in London kreuzten. Ann Kennedy Smith blickt unter anderem mit Francesca Wades Buch "Square Hunting" auf die Biografien weiblicher Intellektueller, deren Leben und Schreiben vom Ersten Weltkrieg und der Suche nach künstlerischer Freiheit geprägt war: "Im Jahr 1911 tauschte Hilda Doolittle ihr Leben in Philadelphia für die Londoner Bohème ein und wurde 1913 - nachdem Ezra Pound sie als 'H.D. Imagiste' unter Vertrag nahm und im Poetry Magazine veröffentlichte - zur Dichterin der Moderne mit dem Kürzel H.D. Der Kriegsausbruch änderte alles: Noch bei der Geburt starb ihr Kind und das Verhältnis zu ihrem Ehemann, dem englischen Dichter Richard Aldington, verschlechterte sich. Sie bezog im Februar 1916 ein modriges Apartment am Mecklenburgh Square 44, wo ihre Kreativität 'vom Beigeschmack des Todes im Keim erstickt' wurde. Die Situation verschlimmerte sich, als ihr Ehemann von der Front zurückkehrte und eine Affäre mit der sinnlichen Dorothy 'Arabella' Yorke begann, die eine Wohnung über H.D. mietete. 'Ihr würde ich Verstand geben, dir einen Körper', sagt in Doolittles autobiografischem Roman 'Bid Me To Live' die Figur Rafe (ein kaum getarnter Aldington) zu seiner Frau Julia. D.H. Lawrence, ein gemeinsamer Freund von Aldington und dessen Liebhaberin Yorke, beschrieb die Schriftstellerin als 'eine, die auf dem Drahtseil tanzt. Man fragt sich, ob sie's rüber schafft', und bezog sich auf ihre prekäre Gefühlslage. Doolittle konnte ihre Selbstzweifel besiegen, indem sie Lawrence' Ratschläge ('sein Mann-ist-Mann und Frau-ist-Frau…sein eitles Gerede') entschieden zurückwies. Geschickt enträtselt Wade das Mysterium der Schreibblockade, die H.D. ganze vier Jahrzehnte lang lähmte."The Atlantic (USA), 21.01.2020
 Eromo Egbejule beschreibt am Beispiel von Nigeria, wie genau sich das viel gepriesene Einwanderungsland Kanada seine Zuwanderer aussucht: "2015 führte Kanada ein neues System zur Aufnahme qualifizierter Einwanderer ein, das auf einer punktebasierten Berechnung beruht, bei der die Bewerber auf der Grundlage ihres Alters, ihrer Berufserfahrung, ihres Bildungsniveaus und ihrer Sprachkenntnisse bewertet werden. Es zielt darauf ab, die am besten qualifizierten Personen zu bevorzugen und ihnen die Einreise ins Land zu erleichtern, während die Bewerber gleichzeitig ermutigt werden, sich in weniger bevölkerten Teilen Kanadas niederzulassen. Australien und Neuseeland wenden ähnliche Systeme an, und der britische Premierminister Boris Johnson, der gerade erst im Dezember einen Wahlsieg errungen hat, will ebenso ein System einführen. Das kanadische System ist jedoch am weitesten fortgeschritten. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verfügt das Land über 'das am weitesten entwickelte und am längsten bestehende System für die Migration qualifizierter Arbeitskräfte' unter seinen Mitgliedstaaten. Sechzig Prozent der im Ausland geborenen Bevölkerung ist 'hoch qualifiziert' - der höchste Anteil in der Organisation. Nun weitet Kanada seine Bemühungen aus: Der Einwanderungsminister Ahmed Hussen - der selbst 1993 als Flüchtling aus Somalia nach Kanada kam - kündigte 2018 an, dass das Land von 2019 bis 2021 mehr als eine Million Menschen anziehen wolle, was fast 3 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht." Wie sich dieser Braindrain auf die Herkunftsländer auswirkt und welchen Druck das auf andere Einwanderungsländer ausübt, kann man sich leicht vorstellen.
Eromo Egbejule beschreibt am Beispiel von Nigeria, wie genau sich das viel gepriesene Einwanderungsland Kanada seine Zuwanderer aussucht: "2015 führte Kanada ein neues System zur Aufnahme qualifizierter Einwanderer ein, das auf einer punktebasierten Berechnung beruht, bei der die Bewerber auf der Grundlage ihres Alters, ihrer Berufserfahrung, ihres Bildungsniveaus und ihrer Sprachkenntnisse bewertet werden. Es zielt darauf ab, die am besten qualifizierten Personen zu bevorzugen und ihnen die Einreise ins Land zu erleichtern, während die Bewerber gleichzeitig ermutigt werden, sich in weniger bevölkerten Teilen Kanadas niederzulassen. Australien und Neuseeland wenden ähnliche Systeme an, und der britische Premierminister Boris Johnson, der gerade erst im Dezember einen Wahlsieg errungen hat, will ebenso ein System einführen. Das kanadische System ist jedoch am weitesten fortgeschritten. Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verfügt das Land über 'das am weitesten entwickelte und am längsten bestehende System für die Migration qualifizierter Arbeitskräfte' unter seinen Mitgliedstaaten. Sechzig Prozent der im Ausland geborenen Bevölkerung ist 'hoch qualifiziert' - der höchste Anteil in der Organisation. Nun weitet Kanada seine Bemühungen aus: Der Einwanderungsminister Ahmed Hussen - der selbst 1993 als Flüchtling aus Somalia nach Kanada kam - kündigte 2018 an, dass das Land von 2019 bis 2021 mehr als eine Million Menschen anziehen wolle, was fast 3 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht." Wie sich dieser Braindrain auf die Herkunftsländer auswirkt und welchen Druck das auf andere Einwanderungsländer ausübt, kann man sich leicht vorstellen.Guardian (UK), 11.01.2020
![]() William Gibson zählt zu den zentralen Autoren der literarischen Science-Fiction der 80er, dessen Romane zumindest den 90ern das entscheidende Vokabular bereitstellten, um die aufkommende Digitalisierung zu begreifen. Seinen neuen Roman "Agency" musste er unter dem Eindruck der globalpolitischen Verschiebungen der jüngsten Jahre allerdings über weite Strecken neu schreiben, um glaubwürdig zu bleiben, gesteht er im großen Guardian-Gespräch. Früher war er da gelassener: ''Neuromancer' konnte ich tatsächlich nur deshalb schreiben, weil ich von Computern keinen blassen Schimmer hatte. Ich wusste buchstäblich nichts. Was ich allerdings tat: Ich dekonstruierte die Poetik der Sprache jener Leute, die bereits in dem Feld tätig waren. Ich stand da in Seattle in einer Hotelbar auf einer Science-Fiction-Tagung und hörte diesen Leuten zu, den allerersten Programmierern, die über ihre Arbeit sprachen. Ich hatte keine Ahnung, über was die da sprachen, aber es war das erste Mal, dass ich hörte, wie das Wort 'interface' als Verb verwendet wurde. Ich war entzückt. Wow, das ist ein Verb. Poetisch betrachtet war das wunderbar. ... Aus diesen Steinen baute ich eine Welt. Entsprechend gibt es in 'Neuromancer' einige Dinge, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Was macht Case, als sich die Lage im Cyberspace zuspitzt? Er verlangt nach einem Modem. ... Ich wusste nicht, was ein Modem ist, aber ich hatte das Wort gerade aufgeschnappt. Und ich dachte, wow, das ist sexy. Das klingt einfach nach richtig schlechten Nachrichten. Ich hatte niemanden, der es gegenlesen konnte. Und googeln konnte ich das auch nicht.' Tatsächlich räumt Gibson später ein: 'Ich denke, Google hat mein Schreiben durchaus verändert. Mir ist heutzutage klar, dass jeder, der sich wirklich in den Text stürzt, alles bei Google nachschlagen wird - oder zumindest alles, was ins Auge sticht. Das fügt dem Ganzen eine neue Ebene der Verantwortung hinzu. Ich kann heutzutage nicht mehr so beliebig schreiben.' Er muss sich davon überzeugen, dass das erfundene Zeug auch definitiv und wasserdicht erfunden ist, und das echte, ergoogelbare Zeug akkurat."
William Gibson zählt zu den zentralen Autoren der literarischen Science-Fiction der 80er, dessen Romane zumindest den 90ern das entscheidende Vokabular bereitstellten, um die aufkommende Digitalisierung zu begreifen. Seinen neuen Roman "Agency" musste er unter dem Eindruck der globalpolitischen Verschiebungen der jüngsten Jahre allerdings über weite Strecken neu schreiben, um glaubwürdig zu bleiben, gesteht er im großen Guardian-Gespräch. Früher war er da gelassener: ''Neuromancer' konnte ich tatsächlich nur deshalb schreiben, weil ich von Computern keinen blassen Schimmer hatte. Ich wusste buchstäblich nichts. Was ich allerdings tat: Ich dekonstruierte die Poetik der Sprache jener Leute, die bereits in dem Feld tätig waren. Ich stand da in Seattle in einer Hotelbar auf einer Science-Fiction-Tagung und hörte diesen Leuten zu, den allerersten Programmierern, die über ihre Arbeit sprachen. Ich hatte keine Ahnung, über was die da sprachen, aber es war das erste Mal, dass ich hörte, wie das Wort 'interface' als Verb verwendet wurde. Ich war entzückt. Wow, das ist ein Verb. Poetisch betrachtet war das wunderbar. ... Aus diesen Steinen baute ich eine Welt. Entsprechend gibt es in 'Neuromancer' einige Dinge, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Was macht Case, als sich die Lage im Cyberspace zuspitzt? Er verlangt nach einem Modem. ... Ich wusste nicht, was ein Modem ist, aber ich hatte das Wort gerade aufgeschnappt. Und ich dachte, wow, das ist sexy. Das klingt einfach nach richtig schlechten Nachrichten. Ich hatte niemanden, der es gegenlesen konnte. Und googeln konnte ich das auch nicht.' Tatsächlich räumt Gibson später ein: 'Ich denke, Google hat mein Schreiben durchaus verändert. Mir ist heutzutage klar, dass jeder, der sich wirklich in den Text stürzt, alles bei Google nachschlagen wird - oder zumindest alles, was ins Auge sticht. Das fügt dem Ganzen eine neue Ebene der Verantwortung hinzu. Ich kann heutzutage nicht mehr so beliebig schreiben.' Er muss sich davon überzeugen, dass das erfundene Zeug auch definitiv und wasserdicht erfunden ist, und das echte, ergoogelbare Zeug akkurat."
Elet es Irodalom (Ungarn), 17.01.2020
 Der aus der Slowakei stammende ungarische Schriftsteller und Dichter Gábor Kálmán veröffentlichte vor kurzem seinen dritten Roman ("Das schöne Leben des Kornél Janega"). Im Interview mit Péter Hományi beschreibt er den Schreibprozess bei Prosa als eher negative Erfahrung. "Jeder Schreibprozess ist eine Art Loslassen, Auf- und Erlösung. Obschon das nicht auf das Schreiben von Prosa passt. Es kann - für mich jedenfalls - keine Erlösung bringen, und ich mag es nicht, Prosa zu schreiben. Da sitzt du allein. Die Zeit vergeht. Du schaust auf den Monitor. Nichts passiert. Du löscht es. Ein durchschnittlicher Tag. Ich habe in meinem Leben mehr Text gelöscht als ich am Ende behielt. Schreiben ist für mich daher Leiden. Ich kann mich darin nicht wohlfühlen, und damit ich Prosa schreiben kann, muss ich sehr tief fallen und mich auch während dessen und danach schlecht fühlen. Während des Prosaschreibens musst du mit dir selbst arbeiten, und dich selbst nach Möglichkeit besiegen. Es geht darum, dass du erzählst, was du eigentlich nicht sagen möchtest."
Der aus der Slowakei stammende ungarische Schriftsteller und Dichter Gábor Kálmán veröffentlichte vor kurzem seinen dritten Roman ("Das schöne Leben des Kornél Janega"). Im Interview mit Péter Hományi beschreibt er den Schreibprozess bei Prosa als eher negative Erfahrung. "Jeder Schreibprozess ist eine Art Loslassen, Auf- und Erlösung. Obschon das nicht auf das Schreiben von Prosa passt. Es kann - für mich jedenfalls - keine Erlösung bringen, und ich mag es nicht, Prosa zu schreiben. Da sitzt du allein. Die Zeit vergeht. Du schaust auf den Monitor. Nichts passiert. Du löscht es. Ein durchschnittlicher Tag. Ich habe in meinem Leben mehr Text gelöscht als ich am Ende behielt. Schreiben ist für mich daher Leiden. Ich kann mich darin nicht wohlfühlen, und damit ich Prosa schreiben kann, muss ich sehr tief fallen und mich auch während dessen und danach schlecht fühlen. Während des Prosaschreibens musst du mit dir selbst arbeiten, und dich selbst nach Möglichkeit besiegen. Es geht darum, dass du erzählst, was du eigentlich nicht sagen möchtest."New York Times (USA), 15.01.2020
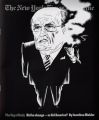 Im Wochenendmagazin der New York Times porträtiert Jonathan Mahler Rudy Giuliani - den ehemaligen legendären Bürgermeister New Yorks und jetzigen Anwalt Donald Trumps, der tief mit in die Ukraine-Affäre verstrickt ist - als einen Politiker der Schamlosigkeit. Wie konnte aus dem verehrten Bürgermeister zur Zeit von Nine-Eleven der heutige windige Rudy werden? Was hat sich an ihm verändert? Nichts, sagt Mahler. "Die wirkliche Frage ist nicht, 'Was ist mit Rudy passiert?' Sondern: 'Was ist mit uns passiert?' Mit einer kleinen Geschichte versteht man ganz gut, was Mahler meint: "Als David Kendall von Williams & Connolly 1993 zum persönlichen Anwalt von Präsident Clinton wurde, holte er eine Stellungnahme des Büros für Regierungsethik zum weiteren Vorgehen ein. Unter anderem wurde ihm gesagt, dass es nicht angemessen sei, pro bono zu arbeiten, denn wenn er und seine Kanzlei nicht zu ihrem üblichen Stundensatz für ihre Zeit bezahlt würden, müsste der Präsident dies als Geschenk melden. Sonst, so das Ethikbüro, müsse von einer Gegenleistung ausgegangen werden: Eine Kanzlei und ihre Anwälte könnten eine Gegenleistung für ihre vielen Stunden kostenlosen Rechtsbeistands erwarten. Während seiner Amtszeit habe Clinton große private Rechtskosten angehäuft; Trump hat Giuliani nicht bezahlt, und er scheint seine Arbeit nicht als Geschenk gemeldet zu haben, wozu er gesetzlich verpflichtet ist. (Das Weiße Haus reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme)." Mahler hat Giuliani übrigens eine erste Version seiner Geschichte gezeigt und Gelegenheit zur Antwort gegeben: Giuliani beschuldigt ihn der Gehässigkeit und verweist auf seine Verdienste bei der Bekämpfung von Mafia und Korruption.
Im Wochenendmagazin der New York Times porträtiert Jonathan Mahler Rudy Giuliani - den ehemaligen legendären Bürgermeister New Yorks und jetzigen Anwalt Donald Trumps, der tief mit in die Ukraine-Affäre verstrickt ist - als einen Politiker der Schamlosigkeit. Wie konnte aus dem verehrten Bürgermeister zur Zeit von Nine-Eleven der heutige windige Rudy werden? Was hat sich an ihm verändert? Nichts, sagt Mahler. "Die wirkliche Frage ist nicht, 'Was ist mit Rudy passiert?' Sondern: 'Was ist mit uns passiert?' Mit einer kleinen Geschichte versteht man ganz gut, was Mahler meint: "Als David Kendall von Williams & Connolly 1993 zum persönlichen Anwalt von Präsident Clinton wurde, holte er eine Stellungnahme des Büros für Regierungsethik zum weiteren Vorgehen ein. Unter anderem wurde ihm gesagt, dass es nicht angemessen sei, pro bono zu arbeiten, denn wenn er und seine Kanzlei nicht zu ihrem üblichen Stundensatz für ihre Zeit bezahlt würden, müsste der Präsident dies als Geschenk melden. Sonst, so das Ethikbüro, müsse von einer Gegenleistung ausgegangen werden: Eine Kanzlei und ihre Anwälte könnten eine Gegenleistung für ihre vielen Stunden kostenlosen Rechtsbeistands erwarten. Während seiner Amtszeit habe Clinton große private Rechtskosten angehäuft; Trump hat Giuliani nicht bezahlt, und er scheint seine Arbeit nicht als Geschenk gemeldet zu haben, wozu er gesetzlich verpflichtet ist. (Das Weiße Haus reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme)." Mahler hat Giuliani übrigens eine erste Version seiner Geschichte gezeigt und Gelegenheit zur Antwort gegeben: Giuliani beschuldigt ihn der Gehässigkeit und verweist auf seine Verdienste bei der Bekämpfung von Mafia und Korruption.Seit dem 1. Januar 2020 muss, wer in Deutschland einen Personalausweis beantragt, seine Fingerabdrücke abgeben und speichern lassen. Das mussten früher nur Kriminelle. Protest hat sich dagegen nicht geregt. Ob die Praxis der massenhaften Gesichtserkennung, wie Clearview sie praktiziert (die NYT hat das gerade aufgedeckt, unsere Resümees) irgendjemanden aufregt, kann man wohl auch bezweifeln. Die Bürger machen ja sogar mit bei der gegenseitigen Überwachung, lernen wir aus John Herrmans Artikel über die Überwachungskameras von Ring, die Privatleute in Türklingeln oder -spione eingebauen. "Sie zeichnen alles, was vor ihrer Linse passiert, auf Videos auf, die man umstandslos mit der Polizei oder der Öffentlichkeit teilen kann. ... In einem Video, das bei Ring TV unter dem Titel 'Nachbar rettet Frau vor eisigen Temperaturen' veröffentlicht wurde, klingelt eine frierende Frau im T-Shirt an der Tür. Sie hat sich aus ihrem Haus ausgesperrt, sagt sie, und hofft, dass jemand ihren Mann anrufen könnte. Eine Stimme aus der Klingel fragt, wer sie sei; die frierende Frau sagt: 'Ich wohne auf der anderen Straßenseite.' In dem Video wird die Tür nicht geöffnet und der Ehemann nicht angerufen. Stattdessen informiert der Ring-Eigentümer die örtlichen Behörden. Die Frau bleibt draußen auf der Treppe und stampft mit den Füßen, um sich warm zu halten, bis die Polizei eintrifft. Das ist eine seltsame Interaktion für Menschen, die als Nachbarn beschrieben werden. Es ist eine Vision amerikanischer Entfremdung, bei der menschliche Interaktionen zuerst durch Überwachungskameras und dann durch die Strafverfolgung vermittelt werden. Oder vielleicht gibt es eine einfachere Antwort: Niemand war zu Hause." Die Kameras kann man übers Handy bedienen.
Außerdem: Michael Forsythe, Kyra Gurney, Scilla Alecci und Ben Hallman erzählen, wie amerikanische Firmen Afrikas reichster Frau, Isabel dos Santos, Tochter von Angolas ehemaligen Präsidenten José Eduardo dos Santos, dabei halfen, den Reichtum ihres Landes für sich auszubeuten.