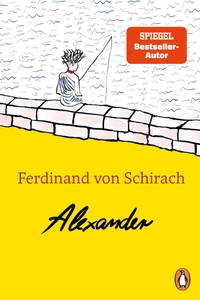9punkt - Die Debattenrundschau
Heute bin ich stark
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
26.02.2026. In einem Offenen Brief fordern Deutsch-Iraner die Bundesregierung auf, strafrechtlich gegen die iranische Regierung zu ermitteln. Die Welt rätselt, was die Folgen für Nigel Farages Partei "Reform UK" sind, nachdem sich ein Rechtsaußen-Zweig als "Restore UK" abgespalten hat. In der NZZ erklärt Anna Schor-Tschudnowskaja, wie Putin mit dem Uni-Fach "soziale Architektur" eine vollkommen zufriedene Bevölkerung heranziehen will. China will das auch, mit der "Xi-Jinping-Lehre", informiert Zeit online. Keine Ausweispflicht im Netz, fordert der Kommunikationswissenschafter Christian Pieter Hoffmann in der NZZ.
Efeu - Die Kulturrundschau
vom
26.02.2026
finden Sie hier
Politik
In einem Offenen Brief, den die Zeit veröffentlicht, fordern Autoren mit iranischem Hintergrund wie Navid Kermani, Jasmin Tabatabai, Naika Foroutan und Mohammad Rasoulof die Bundesregierung auf, wegen des Todes vermutlich zehntausender Demonstranten im Iran strafrechtlich gegen das Regime zu ermitteln: "Durch unzählige Videoaufnahmen, Augenzeugenberichte und 'Leaks' aus dem Staatsapparat sind die Verbrechen umfassend dokumentiert. Die Bilder und Berichte nähren den Verdacht, dass es sich bei dem Massaker um keine spontanen Übergriffe von Soldaten und Milizionären gehandelt hat, sondern um eine geplante, systematische und landesweite Aktion der Staatsführung, um den Freiheitswillen der iranischen Bevölkerung ein für alle Mal zu brechen. Die Verantwortlichen für die unfassbaren Verbrechen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. ... Deutschland hat sich mit dem Völkerstrafgesetzbuch 2002 ein besonders völkerrechtsfreundliches Statut gegeben. Dieses hat sich bereits bei der Aufarbeitung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Assad-Regimes in Syrien bewährt, wofür Deutschland zu Recht international viel Anerkennung geerntet hat. Wir unterstützen daher öffentlich die Einreichung des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) vom 10. Februar 2026 mit der Forderung, dass die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe Strukturermittlungen und gegebenenfalls personenbezogene Ermittlungen im Falle von Iran aufnehmen sollte."
"Xi-Jinping-Lehre" steht in China ab der dritten Klasse auf dem Lehrplan, konstatiert Rebecca Ricker auf Zeit Online. "In China muss jedes Schulkind, jeder Uni-Student, jedes Parteimitglied, jede chinesische Journalistin und jeder Beamte Xi-Jinping-Lehre lernen. Es gibt eine Xi-Jinping-KI, sowie eine gamifizierte Xi-Jinping-Lehre-Lernapp mit dem Namen Xuexi Qiangguo, was übersetzt heißt: Lerne und baue ein starkes Land. Das 'Xi' in 'Xuexi' ist das gleiche Schriftzeichen wie der Name des Generalsekretärs. So heißt die App auch 'Lerne von Xi'." Natürlich könnte man das einfach abtun und sich daran erinnern, dass man auch selber in der Schule so manchem gelauscht und es wieder vergessen habe, so Ricker. So einfach ist das hier jedoch nicht. "Doch es ist ja nicht ein einzelner Kurs, betont Sinologe Chris Mittelstädt: Egal, ob man als Unternehmerin eine neue Fabrik eröffnet oder als Professor einen Vortrag hält, man muss die Vokabeln der Xi-Jinping-Lehre verwenden und 'das Spiel mitspielen'. Andernfalls bekomme man keine Genehmigungen oder Beförderungen."
"Xi-Jinping-Lehre" steht in China ab der dritten Klasse auf dem Lehrplan, konstatiert Rebecca Ricker auf Zeit Online. "In China muss jedes Schulkind, jeder Uni-Student, jedes Parteimitglied, jede chinesische Journalistin und jeder Beamte Xi-Jinping-Lehre lernen. Es gibt eine Xi-Jinping-KI, sowie eine gamifizierte Xi-Jinping-Lehre-Lernapp mit dem Namen Xuexi Qiangguo, was übersetzt heißt: Lerne und baue ein starkes Land. Das 'Xi' in 'Xuexi' ist das gleiche Schriftzeichen wie der Name des Generalsekretärs. So heißt die App auch 'Lerne von Xi'." Natürlich könnte man das einfach abtun und sich daran erinnern, dass man auch selber in der Schule so manchem gelauscht und es wieder vergessen habe, so Ricker. So einfach ist das hier jedoch nicht. "Doch es ist ja nicht ein einzelner Kurs, betont Sinologe Chris Mittelstädt: Egal, ob man als Unternehmerin eine neue Fabrik eröffnet oder als Professor einen Vortrag hält, man muss die Vokabeln der Xi-Jinping-Lehre verwenden und 'das Spiel mitspielen'. Andernfalls bekomme man keine Genehmigungen oder Beförderungen."
Europa
Bald soll ein Fach namens "soziale Architektur" an den russischen Universitäten gelehrt werden, schreibt die in Wien tätige Soziologin und Psychologin Anna Schor-Tschudnowskaja in der NZZ. Schade, wenn man seine Lehrinhalte nicht mehr "Staatspropaganda für die staatsungläubige Bevölkerung" nennen kann. "Genau das soll wohl das wichtigste Tätigkeitsfeld der künftigen 'sozialen Architekten' werden: die Heranbildung einer mit der Staatsführung und der Staatsbürokratie voll und ganz zufriedenen Bevölkerung, die keine unnötigen Fragen stellt beziehungsweise mit allen Antworten und Lösungen zufrieden ist, die den vom Staat vordefinierten 'nationalen Interessen' nicht widersprechen und somit eine harmonische Koexistenz des Staates mit seiner patriotisch (und paternalistisch) gesinnten Bevölkerung ermöglichen."
Die britische "Reform UK"-Partei von Nigel Farage, die momentan die Umfragen anführt, hat sich aufgespalten: "Restore UK" von Rupert Lowe macht jetzt mit dem Wahlspruch "Millions must go" auf sich aufmerksam, schreibt der deutsch-britische Kommunikationsberater Henry Donovan in der Welt. Das könnte zu Stimmenspaltungen zum Nachteil von Farage führen. "Es gibt allerdings eine andere Lesart, die man nicht vorschnell verwerfen sollte: Lowe bietet Farage die Gelegenheit, sein eigenes Haus zu bereinigen. (...) Farages Partei verliert ihre radikalste Flanke und gewinnt dafür an Regierungsfähigkeit. In diesem Szenario wäre Lowe nicht Farages Nemesis, sondern unfreiwillig sein Steigbügelhalter. Aber dieses Szenario setzt voraus, dass Farage die Nerven behält. Dass er nicht dem Druck nachgibt, sich nach Rechtsaußen zu bewegen, um die Lowe-Wähler zurückzugewinnen. Dass er die Mitte hält. Das ist eine große Anforderung an einen Mann, dessen politische Instinkte ihn immer wieder zur Provokation treiben. Und es ist eine noch größere Anforderung an eine Partei, die Farage - wie er freimütig einräumt - vollständig kontrollieren will."
Die britische "Reform UK"-Partei von Nigel Farage, die momentan die Umfragen anführt, hat sich aufgespalten: "Restore UK" von Rupert Lowe macht jetzt mit dem Wahlspruch "Millions must go" auf sich aufmerksam, schreibt der deutsch-britische Kommunikationsberater Henry Donovan in der Welt. Das könnte zu Stimmenspaltungen zum Nachteil von Farage führen. "Es gibt allerdings eine andere Lesart, die man nicht vorschnell verwerfen sollte: Lowe bietet Farage die Gelegenheit, sein eigenes Haus zu bereinigen. (...) Farages Partei verliert ihre radikalste Flanke und gewinnt dafür an Regierungsfähigkeit. In diesem Szenario wäre Lowe nicht Farages Nemesis, sondern unfreiwillig sein Steigbügelhalter. Aber dieses Szenario setzt voraus, dass Farage die Nerven behält. Dass er nicht dem Druck nachgibt, sich nach Rechtsaußen zu bewegen, um die Lowe-Wähler zurückzugewinnen. Dass er die Mitte hält. Das ist eine große Anforderung an einen Mann, dessen politische Instinkte ihn immer wieder zur Provokation treiben. Und es ist eine noch größere Anforderung an eine Partei, die Farage - wie er freimütig einräumt - vollständig kontrollieren will."
Ideen
Am Ende kann jede Verfassung untergraben und die Freiheit abgeschafft werden - wenn die Wähler das so wollen. Es kann nicht schaden, das juristisch so schwierig wie möglich zu machen. Aber man muss schon genau hingucken, was wirklich Verfassungsrang hat, meint Reinhard Müller in der FAZ, und was nur der Sicherung bestimmter politische Positionen dient: "Man sollte nicht den Eindruck erwecken, die Landeszentrale für politische Bildung oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seiner jetzigen Form hätten ewigen Verfassungsrang. Vorsicht ist jedenfalls geboten, wenn eine Volksfront-Mentalität jene geistige Auseinandersetzung behindert, die gerade den Einzug von Verfassungsfeinden in die Parlamente verhindern könnte. ... Natürlich sollte ein Regierungswechsel auch Folgen haben. Sonst wären Wahlen überflüssig. Eine längere politische Herrschaft, die auch mit der Besetzung von Richterposten im Land und von Spitzenpositionen in Behörden bis zum Verfassungsschutz verbunden ist, wirkt sich aus: von der Durchsetzung von Recht und Ordnung bis hin womöglich zur allgemeinen Stimmung. Staatsdiener aber sind keiner Partei verpflichtet, sondern dem Land. Gut, wenn man sich das nicht nur mit Blick auf die AfD immer wieder in Erinnerung ruft."
Gesellschaft
Die Forderung nach einem Social-Media-Verbot ist eine "moral panic", also die Angst vor den Auswirkungen einer neuen Technologie, erklärt der Kommunikationswissenschafter Christian Pieter Hoffmann im NZZ-Interview mit Morten Friedel. "Außerdem glaube ich, dass viele Menschen unterschätzen, was es bedeuten würde, eine Altersgrenze ab 16 einzuführen. Dann müssen sich nämlich alle im Netz ausweisen, um ihr Alter nachzuweisen, nicht nur Kinder oder Jugendliche. Die Plattformbetreiber müssen ja irgendwie erfahren, ob ein Nutzer volljährig ist. Und es bedarf schon eines großen Optimismus im Hinblick auf die Stabilität unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn wir dem Staat so viel Macht geben. Kommt eine Art Ausweispflicht, kann er jede Diskussion namentlich zuordnen. Wenn autoritäre Parteien an die Macht kommen sollten, hätten sie damit ein ideales Werkzeug, um die Presse- und Meinungsfreiheit auszuhebeln."
Lena Bopp schreibt in der FAZ voller Bewunderung über einen Abend in Hamburg mit Gisèle Pelicot: "Vier Jahre lang habe sie den Opferstatus getragen, sagt Pelicot, aber sie habe ihn ablegen wollen. Sie habe sich selbst geheilt und erlaubt, wieder glücklich zu sein. 'Heute bin ich stark.' Das war nicht immer so, natürlich. 'Ich wusste: Wenn ich meinen Schmerz nicht teile, würde ich in ihm untergehen.' Pelicot ist so etwas wie eine Überlebende. Sie selbst bezeichnet sich als éveilleuse, eine Aufklärerin - dieses Wort zieht sie dem vielfach an sie herangetragenen Begriff der Ikone vor. So oder so verkörpert sie eine unwahrscheinliche Wiederauferstehung". Viele werden in Pelicots Geschichte zumindest "Fragmente des Geschehens" wiedererkennen, meint Bopp: "sexuelle Gewalt, Manipulation, Verrat, Ohnmacht und die Erfahrung von Kipppunkten im Leben, an denen alles bis dahin Gewesene zusammenbricht. Es ist deswegen auch bedauerlich zu sehen, dass wieder deutlich mehr Frauen als Männer an diesem Abend den Weg in die Hamburger Laeiszhalle gefunden haben."
Lena Bopp schreibt in der FAZ voller Bewunderung über einen Abend in Hamburg mit Gisèle Pelicot: "Vier Jahre lang habe sie den Opferstatus getragen, sagt Pelicot, aber sie habe ihn ablegen wollen. Sie habe sich selbst geheilt und erlaubt, wieder glücklich zu sein. 'Heute bin ich stark.' Das war nicht immer so, natürlich. 'Ich wusste: Wenn ich meinen Schmerz nicht teile, würde ich in ihm untergehen.' Pelicot ist so etwas wie eine Überlebende. Sie selbst bezeichnet sich als éveilleuse, eine Aufklärerin - dieses Wort zieht sie dem vielfach an sie herangetragenen Begriff der Ikone vor. So oder so verkörpert sie eine unwahrscheinliche Wiederauferstehung". Viele werden in Pelicots Geschichte zumindest "Fragmente des Geschehens" wiedererkennen, meint Bopp: "sexuelle Gewalt, Manipulation, Verrat, Ohnmacht und die Erfahrung von Kipppunkten im Leben, an denen alles bis dahin Gewesene zusammenbricht. Es ist deswegen auch bedauerlich zu sehen, dass wieder deutlich mehr Frauen als Männer an diesem Abend den Weg in die Hamburger Laeiszhalle gefunden haben."
Kulturpolitik
Die Kürzungen im Berliner Kulturetat - 105 Millionen Euro laut Doppelhaushaltes 2026/27 - sind hart, dennoch sieht Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson im Interview mit der Zeit auch in der Zukunft die Berliner Kulturlandschaft blühen. Beispiel "Schaubühne, die ist ein extrem effizienter Betrieb, natürlich auch, weil sie als private GmbH geführt wird. Thomas Ostermeier und sein Geschäftsführer Tobias Veit haften persönlich. Und was passiert? Trotz Krise, trotz Spardruck wachsen sie weiter! 'Der Geizige' mit Lars Eidinger in der Hauptrolle wird ganz bestimmt wieder ausverkauft sein, Premiere ist Anfang April. Die Schaubühne hat in ihrer Nachbarschaft gerade eine neue Liegenschaft gemietet, als Probe- und Experimentalbühne." Andererseits mache die Schaubühne "acht neue Produktionen pro Saison, das Deutsche Theater bislang 30. Ist das nötig, frage ich mich." Ihre Devise, jedenfalls solange der Gin am Abend gesichert ist: "Wir müssen optimistisch in den Tag starten."
Kommentieren