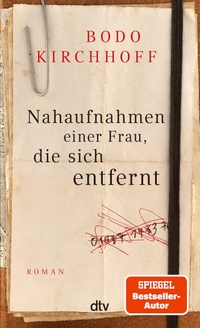9punkt - Die Debattenrundschau
Tonnen von dem Zeug
Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
Europa
Kulturpolitik
Auch die Osterinseln wollen die Statue zurück, die eine britische Fregatte 1868 für Königin Victoria als Souvenir mitnahm: Im Guardian findet Simon Jenkins: "Die erste Antwort auf Rückgabeforderungen ist einfach: Man muss ihr nachgeben. In unseren Kellern stehen Tonnen von dem Zeug. Fairerweise muss man sagen, dass damit damit angefangen wird. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bringt Gesetze für die Rückgabe des afrikanischen Erbes auf den Weg. Das British Museum seinerseits gibt Objekte als permanente Leihgaben zurück. Die Benin-Bronzen gehen nach Nigeria, und das Museum ist bereit, mit den Osterinseln zu reden. Mehr Sorge bereitet die Frage, was die Restitution für die Welt-Museen bedeutet. Sie sin die wahren Erben der Kolonialreiche. Ihre Verteidiger stimmen immer wieder den Kuratoren-Gesang an, dass sie globale Wächter seien, eine Quelle der Forschung, der Ort, an dem Kunst ihren Kontext bekommt. Aber wenn der Kontext wirklich zählt, warum nicht Objekte wie die Lewis- Schachfiguren, das Lindisfarne-Evangeliar und den Parthenon-Fries dahin geben, wo sie urprünglich genossen werden sollten? Das einzige echte Argument der Museen ist, dass Besitz neunzig Prozent des Rechts ausmachen."
Die Berliner Ethnologin Larissa Förster widerspricht in der FAZ vehement der Auffassung, dass die Rückgabe afrikanischer Kunst erst in jüngerer Zeit gefordert wird. Es gibt etliche, noch nicht zu Ende erforschte Beispiele, in denen sich afrikanische Gesellschaften gegen die Enteignung wehrten und eine Rückgabe forderten. Und formal legalistische Argumente will Förster auch nicht gelten lassen: "Es ist bemerkenswert, dass immer, wenn auf die Frage der Legalität zum Zeitpunkt des Erwerbs von Objekten verwiesen wird, nur auf die eigenen historisch gewachsenen Rechtssysteme geblickt und selten nach den historischen Rechtssystemen der 'Anderen' gefragt wird. Es scheint, als würden deren Rechtsvorstellungen noch immer dem Feld der Mythologie oder Religion zugeordnet."
Im Tagesspiegel resümiert Birgit Rieger die bisherige Diskussion um den Bericht von Bénédicte Savoy und Felwine Sarr zur Restitution afrikanischer Kunst.
Medien
Und David Brooks gibt in der New York Times den Kollegen im Politik-Ressort gleich noch eins mit. Wie wäre es mal wieder, sich mit dem zustand des Landes zu beschäftigen als nur mit den Clowns im Weißen Haus? "Auf jede Schandtat von Donald Trump aufspringen. Seine narzisstische Provokationen in den Mittelpunkt stellen. Jeden Tag Verachtung ausdrücken von der sicheren Warte unseres politischen Silos aus. Das ist ja offenbare das Geschäftsmodell der Nachrichtensender und Online-Medien. Und tatsächlich gibt es ein großes verlässliches Publikum, das sich immer wieder einschaltet, um abgestoßen zu sein und sich Trump überlegen zu fühlen, süchtig nach den täglichen Ritualen moralischer Onanie."
In der NZZ beoabchtet Rainer Stadler, wie der rechte Verleger Christoph Blocher in der Schweiz jetzt auch den Markt der Gratiszeitungen aufmischt.
Geschichte
Politik
Der Wirtschaftswissenschaftler Wladislaw Inosemzew rechnet in der NZZ vor, dass so viele Menschen in Russland von Waldimir Putins Politik profitieren, dass die Chancen auf Reformen schon rein ökonomisch schwinden: Neben der Masse von Beamten sind das vor allem die Mitarbeiter der Geheimdienste, die Silowiki: "Nicht nur, dass diese Gruppe der russischen Bevölkerung zum größten Teil nichts zur wirtschaftlichen oder sozialen Entwicklung des Landes beiträgt, sie stört diese sogar. Um ihre Existenz aufrechtzuerhalten, führen sie immer neue Beschränkungen ein. Deren Überwachung sichert ihren Lohn, die Sanktionierungen bei Nichteinhaltung garantieren korrupten Gewinn. Die Zahl derer, die in diesen Strukturen beschäftigt sind, übersteigt diejenige in Industrieländern bei weitem: Das FBI und die CIA verfügen nur über ein Drittel der Beschäftigten wie der FSB."
In der taz berichtet Barbara Wurm von Karls Schlögels Mosse-Lecture: "Russland-Versteher - Wenn es doch welche gäbe".