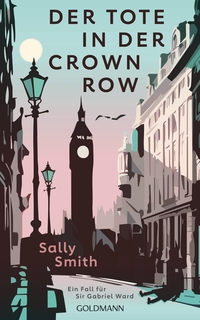9punkt - Die Debattenrundschau
Patriotisches Porzellan
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
23.08.2024. Hat es mit der Garnisonkirche denn nie ein Ende? Nun ist der Turm zumindest eingeweiht. Frank-Walter Steinmeier hielt eine Rede. Die Gegner protestierten. Und die Feuilletons sind gespalten. Das andere große Thema: Eins ist vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen klar: Die "Angleichungstheorie", nach der sich die Differenzen zwischen Ost und West abschleifen sollen, kann in den Schredder, meint die taz. Verschiedene Zeitungen versuchen zu klären, warum die Ossis sind, wie sie sind. Könnte es mit Geschichte zu tun haben? Mit der Tatsache, dass der Hitler-Stalin-Pakt in Deutschland so schmählich vergessen ist, fragt der Historiker Felix Ackermann in der FAZ.
Efeu - Die Kulturrundschau
vom
23.08.2024
finden Sie hier
Kulturpolitik
Gestern nun also wurde der wieder aufgebaute Turm der Potsdamer Garnisonkirche eingeweiht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt die Eröffnungsrede und verteidigte den Wiederaufbau: "Ein Ort, der nicht mehr da ist, würde das kritische Erinnern nicht leichter machen. Wir aber stellen uns heute diesen Fragen; wir blenden die Schattenseiten der Vergangenheit nicht aus, sondern wir machen sie sichtbar, um daraus zu lernen."
Draußen protestierten etwa hundert Menschen, der bekannteste Kritiker ist der Architekturhistoriker Philipp Oswalt, der noch vor wenigen Tagen einen unter anderem von der Denkmalpflegerin Gabi Dolff-Bonekämper, der amerikanischen Judaistin Susannah Heschel und dem britischen Historiker Geoff Eley offenen Brief an den Bundespräsidenten gerichtet hatte, in dem er konkrete Forderung an die Stiftung stellte, erinnert Marcus Woeller in der Welt, der genau hinhörte, ob Steinmeier in seiner Rede auf den Brief einging: "Auf den Wunsch, sie möge eine umstrittene Stelle ihrer Satzung ändern, kann freilich auch der bürokratischste Bundespräsident in einer Festrede nicht konkret eingehen. So sagte Steinmeier, die Garnisonkirche dürfe 'nicht für den Geschichtsrevisionismus missbraucht werden', und forderte: 'Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, dass dieser Ort etwas wird, was er über lange Strecken seiner Geschichte nicht war: ein Ort der Demokratie.' Auch auf den zweiten Wunsch Oswalts, man möge doch auf die weitere Verzierung des Turms mit militärischem Bauschmuck verzichten, ging Steinmeier nicht ein. Zwischen den Zeilen aber konnte man hören, dass eine Rekonstruktion ohne entscheidende Details für ihn der zukünftigen Rolle des Turms wohl nicht gerecht werde. Die Garnisonkirche sei ein 'zentrales Symbol für die
Macht Preußens' gewesen, das 'Symbol einer Allianz von konservativer Tradition und Nationalsozialismus' und ein Ort, an dem 'die Religion in den Dienst militärischer Propaganda genommen wurde', so Steinmeier."
"Es ist schon phänomenal, dass es immer Sozialdemokraten sind, die die Rekonstruktion des preußischen Erbes wesentlich repräsentieren", beruhigt Peter Richter in der SZ: "Das war schon beim Berliner Stadtschloss so, und hier im Turm der Garnisonkirche predigt Steinmeier geradezu eine Theologie des hyperdialektischen Sowohl-als-auch, er verteidigt den Neubau gleichzeitig wegen seiner stadtbildheilenden und durchaus auch touristischen Wirkung und wegen seiner unheilvollen Geschichte, sozusagen als Wiedererrichtung eines Mahnmals zur Warnung. Denn: 'Ein Ort, der nicht mehr da ist, würde das kritische Erinnern nicht leichter machen.'
Jubel brandete gar "im Rechenzentrum auf, als Steinmeier in seiner Rede die Erhaltung des Kreativhauses forderte", ergänzt Tobias Timm auf Zeit Online: "Dessen Existenz ist nur bis 2026 gesichert. Ein Teil des Grundes gehört der Stiftung Garnisonkirche, die an dieser Stelle vor Jahren auch noch plante, das komplette Kirchenschiff wiederzuerrichten. Das scheint heute kaum mehr möglich, angesichts der Lebendigkeit des Rechenzentrums. Nicht nur Steinmeier, auch eine Mehrheit der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung ist für dessen Erhalt. Und so bewirbt sich die Garnisonkirche nicht mehr mit der zukünftigen Expansion in die Breite, sondern vor allem mit der Aussicht, die man in der Höhe von der Spitze des Turm-Stummels hat."
Frederik Eikmanns und Julia Hubernagel waren für die taz da und sind mit der museumspädagogischen Aufbereitung der Ausstellung über den Turm soweit zufrieden. Dass der Wiederaufbau umstritten war, "lässt sich an den Infotafeln an der Wand nachlesen. Ein Zitat des Historikers Martin Sabrow, wonach Befürworter:innen und Gegner:innen des Wiederaufbaus mehr vereint als trennt - beide würden sich 'aus Furcht vor der Zukunft an das, was gewesen ist', klammern - unterstreicht den Anspruch von Kurator Jürgen Reiche, sich nicht von einer Seite vereinnahmen zu lassen. Dem Zitat Sabrows ist eins von Oberstleutnant a. D. Max Klaar zur Seite gestellt, der den Wiederaufbau einst angestoßen hatte. Dass es sich bei Klaar um einen Rechtsradikalen handelt, ist auf den ersten Blick allerdings nicht ersichtlich."
Viel kritischer ist FAZ-Redakteur Andreas Kilb mit der Ausstellung im Turm. Er findet zwar viel "patriotisches Porzellan", aber die Ausstellung versäume, "den Ort selbst auszuleuchten. In der Weimarer Republik war die Garnisonkirche ein Hotspot der Antidemokraten, ein zentraler Treffpunkt von Monarchisten-, Reichswehr- und reaktionären Reichstagsklüngeln. Dieses Netzwerk hätte ein eigenes Kapitel verdient gehabt. Es fehlt."
Draußen protestierten etwa hundert Menschen, der bekannteste Kritiker ist der Architekturhistoriker Philipp Oswalt, der noch vor wenigen Tagen einen unter anderem von der Denkmalpflegerin Gabi Dolff-Bonekämper, der amerikanischen Judaistin Susannah Heschel und dem britischen Historiker Geoff Eley offenen Brief an den Bundespräsidenten gerichtet hatte, in dem er konkrete Forderung an die Stiftung stellte, erinnert Marcus Woeller in der Welt, der genau hinhörte, ob Steinmeier in seiner Rede auf den Brief einging: "Auf den Wunsch, sie möge eine umstrittene Stelle ihrer Satzung ändern, kann freilich auch der bürokratischste Bundespräsident in einer Festrede nicht konkret eingehen. So sagte Steinmeier, die Garnisonkirche dürfe 'nicht für den Geschichtsrevisionismus missbraucht werden', und forderte: 'Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, dass dieser Ort etwas wird, was er über lange Strecken seiner Geschichte nicht war: ein Ort der Demokratie.' Auch auf den zweiten Wunsch Oswalts, man möge doch auf die weitere Verzierung des Turms mit militärischem Bauschmuck verzichten, ging Steinmeier nicht ein. Zwischen den Zeilen aber konnte man hören, dass eine Rekonstruktion ohne entscheidende Details für ihn der zukünftigen Rolle des Turms wohl nicht gerecht werde. Die Garnisonkirche sei ein 'zentrales Symbol für die
Macht Preußens' gewesen, das 'Symbol einer Allianz von konservativer Tradition und Nationalsozialismus' und ein Ort, an dem 'die Religion in den Dienst militärischer Propaganda genommen wurde', so Steinmeier."
"Es ist schon phänomenal, dass es immer Sozialdemokraten sind, die die Rekonstruktion des preußischen Erbes wesentlich repräsentieren", beruhigt Peter Richter in der SZ: "Das war schon beim Berliner Stadtschloss so, und hier im Turm der Garnisonkirche predigt Steinmeier geradezu eine Theologie des hyperdialektischen Sowohl-als-auch, er verteidigt den Neubau gleichzeitig wegen seiner stadtbildheilenden und durchaus auch touristischen Wirkung und wegen seiner unheilvollen Geschichte, sozusagen als Wiedererrichtung eines Mahnmals zur Warnung. Denn: 'Ein Ort, der nicht mehr da ist, würde das kritische Erinnern nicht leichter machen.'
Jubel brandete gar "im Rechenzentrum auf, als Steinmeier in seiner Rede die Erhaltung des Kreativhauses forderte", ergänzt Tobias Timm auf Zeit Online: "Dessen Existenz ist nur bis 2026 gesichert. Ein Teil des Grundes gehört der Stiftung Garnisonkirche, die an dieser Stelle vor Jahren auch noch plante, das komplette Kirchenschiff wiederzuerrichten. Das scheint heute kaum mehr möglich, angesichts der Lebendigkeit des Rechenzentrums. Nicht nur Steinmeier, auch eine Mehrheit der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung ist für dessen Erhalt. Und so bewirbt sich die Garnisonkirche nicht mehr mit der zukünftigen Expansion in die Breite, sondern vor allem mit der Aussicht, die man in der Höhe von der Spitze des Turm-Stummels hat."
Frederik Eikmanns und Julia Hubernagel waren für die taz da und sind mit der museumspädagogischen Aufbereitung der Ausstellung über den Turm soweit zufrieden. Dass der Wiederaufbau umstritten war, "lässt sich an den Infotafeln an der Wand nachlesen. Ein Zitat des Historikers Martin Sabrow, wonach Befürworter:innen und Gegner:innen des Wiederaufbaus mehr vereint als trennt - beide würden sich 'aus Furcht vor der Zukunft an das, was gewesen ist', klammern - unterstreicht den Anspruch von Kurator Jürgen Reiche, sich nicht von einer Seite vereinnahmen zu lassen. Dem Zitat Sabrows ist eins von Oberstleutnant a. D. Max Klaar zur Seite gestellt, der den Wiederaufbau einst angestoßen hatte. Dass es sich bei Klaar um einen Rechtsradikalen handelt, ist auf den ersten Blick allerdings nicht ersichtlich."
Viel kritischer ist FAZ-Redakteur Andreas Kilb mit der Ausstellung im Turm. Er findet zwar viel "patriotisches Porzellan", aber die Ausstellung versäume, "den Ort selbst auszuleuchten. In der Weimarer Republik war die Garnisonkirche ein Hotspot der Antidemokraten, ein zentraler Treffpunkt von Monarchisten-, Reichswehr- und reaktionären Reichstagsklüngeln. Dieses Netzwerk hätte ein eigenes Kapitel verdient gehabt. Es fehlt."
Europa
AfD-Wähler finden sich in allen Einkommensschichten, aber in ihren Ansichten unterscheiden sie sich deutlich von den restlichen Wahlberechtigten, entnimmt Felix Hackenbruch im Tagesspiegel einer repräsentativen Studie des Demoskopie-Institut Pollytix, über die er mit dem Pollytix-Geschäftsführer Rainer Faus gesprochen hat: "Zu den größten Sorgenthemen zählen für AfD-Wähler offenbar, dass zu viele Menschen einwandern (97 Prozent), dass die Energiekosten und Inflation steigen (95 bzw. 90 Prozent) und, dass Deutschland in Kriege oder militärische Konflikte hineingezogen werden könnte (83 Prozent). Nur zwei abgefragte Sorgen scheinen AfD-Sympathisanten weniger zu besorgen als den Rest der Menschen in Deutschland. Vor den Folgen des Klimawandels sorgt sich nur die Hälfte der Befragten. Dass es zu einem Rechtsruck in Deutschland kommen könnte, gab nur 15 Prozent als Sorge an. Besonders erschreckend hält Faus die Gewaltbereitschaft in der AfD-Anhängerschaft. Tatsächlich rechtfertigt jeder Dritte Gewalt gegen Politiker."
Martin Böttger war einst DDR-Bürgerrechtler, nun hat er eine ostdeutsche Petition gegen Sahra Wagenknechts BSW initiiert, in der er vor Koalitionen mit der Partei warnt und eine Abgrenzung von deren "nationalen Sozialismus" fordert. Im Tagesspiegel-Gespräch kritisiert er, dass die Ost-CDU über Koalitionen mit der BSW nachdenkt, aber mit der Linken ausschließt: "Die alte Brandmauer nach links ist nicht mehr zeitgemäß. Nach der Abspaltung von Wagenknecht sind die Vernünftigen bei den Linken übriggeblieben." Der größte Fehler bei der Wiedervereinigung sei die Währungsumstellung zum Kurs 1:1 gewesen, sagt er außerdem: "So viel war die Ost-Mark nicht wert. Fortan sollten die DDR-Betriebe ihre Mitarbeiter mit Westgeld bezahlen, das sie nicht erwirtschaften konnten. ... Wir haben im Osten nichts über Ökonomie gewusst. Dass sich in der Marktwirtschaft die Preise nach Angebot und Nachfrage richten, hat uns keiner beigebracht."
Eins ist auch Gunnar Hinck, Meinungsredakteur der taz und Autor eines Buchs über den Austausch der Eliten in den Neuen Ländern, klar: Die Angleichungstheorie aus den Neunzigern, die ein allmähliches Verschwinden der Differenzen voraussagte, "kann man getrost in den Schredder geben". Für den Erfolg des BSW macht Hinck soziale Gründe geltend: "Die Fanbasis des BSW machen überdurchschnittlich häufig Kleinunternehmer und Angestellte in der Privatwirtschaft aus. Es ist ein Milieu, das die Regeln der westdeutschen Marktwirtschaft durchaus verinnerlicht, aber ökonomisch mehr zu kämpfen hat, weil es bei Krisen weniger auf geerbtes oder erwirtschaftetes Old Money zurückgreifen kann. Wenn bei einem westdeutschen Kleinunternehmen oder einer Mittelschichtsfamilie eine Steuernachzahlung des Finanzamts oder höhere Energierechnungen eintrudeln, können diese in der Regel aus Rücklagen bezahlt werden - in Ostdeutschland kann so etwas wegen der geringeren Kapitalbasis schnell bedrohlich sein."
Die taz bringt auch eine Beilage zu den Wahlen in Thüringen. Dort erklärt Mika Schlegel, Jahrgang 2005, warum sie ein Ossi ist: Ihre Eltern hätten mit der Wende "die Stabilität ihres gewohnten Lebens verloren. Die Folge ist ein kollektives Trauma, in dessen Schatten ich und viele andere in meinem Alter aufgewachsen sind - und das auch noch isoliert im infrastrukturarmen Großraumfunkloch Thüringen. Menschen, die in ihrer Jugend Angst vorm Wehreinzug und der Stasi hatten, vermitteln ihren Kindern andere Werte. Meine Eltern sind misstrauisch und suchen Stabilität. Es verunsichert sie, dass ich in eine weit entfernte Stadt ziehen und auf Reisen andere, fremde Kulturen kennenlernen will. Sie wünschen sich, dass ich bald heirate und ein Haus baue - stattdessen studiere ich Kommunikations- und Medienwissenschaft, von denen sie nicht einmal begreifen, was es ist."
Martin Böttger war einst DDR-Bürgerrechtler, nun hat er eine ostdeutsche Petition gegen Sahra Wagenknechts BSW initiiert, in der er vor Koalitionen mit der Partei warnt und eine Abgrenzung von deren "nationalen Sozialismus" fordert. Im Tagesspiegel-Gespräch kritisiert er, dass die Ost-CDU über Koalitionen mit der BSW nachdenkt, aber mit der Linken ausschließt: "Die alte Brandmauer nach links ist nicht mehr zeitgemäß. Nach der Abspaltung von Wagenknecht sind die Vernünftigen bei den Linken übriggeblieben." Der größte Fehler bei der Wiedervereinigung sei die Währungsumstellung zum Kurs 1:1 gewesen, sagt er außerdem: "So viel war die Ost-Mark nicht wert. Fortan sollten die DDR-Betriebe ihre Mitarbeiter mit Westgeld bezahlen, das sie nicht erwirtschaften konnten. ... Wir haben im Osten nichts über Ökonomie gewusst. Dass sich in der Marktwirtschaft die Preise nach Angebot und Nachfrage richten, hat uns keiner beigebracht."
Eins ist auch Gunnar Hinck, Meinungsredakteur der taz und Autor eines Buchs über den Austausch der Eliten in den Neuen Ländern, klar: Die Angleichungstheorie aus den Neunzigern, die ein allmähliches Verschwinden der Differenzen voraussagte, "kann man getrost in den Schredder geben". Für den Erfolg des BSW macht Hinck soziale Gründe geltend: "Die Fanbasis des BSW machen überdurchschnittlich häufig Kleinunternehmer und Angestellte in der Privatwirtschaft aus. Es ist ein Milieu, das die Regeln der westdeutschen Marktwirtschaft durchaus verinnerlicht, aber ökonomisch mehr zu kämpfen hat, weil es bei Krisen weniger auf geerbtes oder erwirtschaftetes Old Money zurückgreifen kann. Wenn bei einem westdeutschen Kleinunternehmen oder einer Mittelschichtsfamilie eine Steuernachzahlung des Finanzamts oder höhere Energierechnungen eintrudeln, können diese in der Regel aus Rücklagen bezahlt werden - in Ostdeutschland kann so etwas wegen der geringeren Kapitalbasis schnell bedrohlich sein."
Die taz bringt auch eine Beilage zu den Wahlen in Thüringen. Dort erklärt Mika Schlegel, Jahrgang 2005, warum sie ein Ossi ist: Ihre Eltern hätten mit der Wende "die Stabilität ihres gewohnten Lebens verloren. Die Folge ist ein kollektives Trauma, in dessen Schatten ich und viele andere in meinem Alter aufgewachsen sind - und das auch noch isoliert im infrastrukturarmen Großraumfunkloch Thüringen. Menschen, die in ihrer Jugend Angst vorm Wehreinzug und der Stasi hatten, vermitteln ihren Kindern andere Werte. Meine Eltern sind misstrauisch und suchen Stabilität. Es verunsichert sie, dass ich in eine weit entfernte Stadt ziehen und auf Reisen andere, fremde Kulturen kennenlernen will. Sie wünschen sich, dass ich bald heirate und ein Haus baue - stattdessen studiere ich Kommunikations- und Medienwissenschaft, von denen sie nicht einmal begreifen, was es ist."
Politik
Laut Tagesspiegel-Informationen werden in bestimmten Moscheen und unter namhaften Clans in Nordrhein-Westfalen, Bremen, Niedersachsen und Berlin hohe Summen trotz des Verbots für die Hisbollah akquiriert, berichtet Pascal Bartosz ebenda: "Transaktionen an die Islamisten erfolgen oft über das Hawala-System. Hawala bedeutet auf Arabisch etwa 'Scheck'. Wer undokumentiert Geld transferieren will, gibt die Summe und einen Code einem Hawaladar. Dieser Hawaladar nennt Code und Summe einem Partner-Hawaladar im Zielland. Nun ruft der Sender aus Deutschland den Empfänger im Nahen Osten an und nennt auch ihm Summe und Code. Der Empfänger geht zum Vor-Ort-Hawaladar und bekommt dank des Codes die Summe. Die beiden Hawaladare rechnen regelmäßig untereinander ab, bis sich ihre Bilanzen ausgleichen."
Medien
Nachdem die Redaktion der flämischen Zeitung Humo die Kolumne des Autors Hermann Brusselmans, der schrieb, jedem Juden, dem er begegne die "Kehle durchschneiden" zu wollen (unsere Resümees), als Satire verteidigte, hat der niederländische Schriftsteller Arnon Grünberg die Redaktion nach 25 Jahren als Kolumnist verlassen. "Wenn der Wunsch, wahllos Juden die Kehle durchzuschneiden, als Satire bezeichnet wird, könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass der Nationalsozialismus eine satirische Bewegung war, mit Joseph Goebbels als Minister für Satire", schreibt er heute in der NZZ und zitiert aus seinem Brief an die Herausgeber: "Es steht Ihnen frei, den Revisionismus in Ihrer Zeitschrift herunterzuspielen und zuzulassen, aber das bedeutet nicht, dass ich an der Seite des Revisionisten veröffentlichen möchte." Er warnt davor, die Fantasie Juden zu ermorden, sei "salonfähig" geworden: "Vor Jahren habe ich geschrieben, dass man in vielen Äußerungen nur das Wort 'Muslim' durch 'Jude' zu ersetzen braucht, um zu erkennen, was hier gerade passiert. Die Erniedrigung, die Demütigung und der Hass auf verletzliche Gruppen sind keine Religionskritik, geschweige denn eine Verteidigung der freien, liberalen Gesellschaft. Die Art und Weise, wie Politiker, Kolumnisten und Journalisten in Ländern wie den Niederlanden und Belgien in den letzten zwei Jahrzehnten über Muslime und Asylbewerber gesprochen haben, hat die Gesellschaft vergiftet. Das ist nicht die einzige Ursache, aber sicherlich eine der Ursachen für den neuen Antisemitismus."
Zunächst am Montag, seit 2015 am Samstag wird derzeit geprüft, ob der Spiegel künftig am Freitag erscheint, weiß Christian Meier in der Welt. Ziel ist offenbar eine Steigerung des Einzelverkaufs. Aber: "Der Einzelverkauf von Zeitungen und Zeitschriften ist allerdings in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Der Spiegel kam im zweiten Quartal des Jahres auf eine verkaufte Auflage von knapp 675.000 Exemplaren, doch nur 92.700 Exemplare davon wurden auf diese Weise abgesetzt. Und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Einzelverkauf um 18,5 Prozent. Aufgefangen wird der Rückgang über die leichte Zunahme bei Abonnements, die zu einem stark steigenden Anteil aber digitale E-Paper-Abos sind. Vor zehn Jahren setzte der Spiegel im Einzelverkauf noch rund 251.000 Hefte ab."
Zunächst am Montag, seit 2015 am Samstag wird derzeit geprüft, ob der Spiegel künftig am Freitag erscheint, weiß Christian Meier in der Welt. Ziel ist offenbar eine Steigerung des Einzelverkaufs. Aber: "Der Einzelverkauf von Zeitungen und Zeitschriften ist allerdings in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Der Spiegel kam im zweiten Quartal des Jahres auf eine verkaufte Auflage von knapp 675.000 Exemplaren, doch nur 92.700 Exemplare davon wurden auf diese Weise abgesetzt. Und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Einzelverkauf um 18,5 Prozent. Aufgefangen wird der Rückgang über die leichte Zunahme bei Abonnements, die zu einem stark steigenden Anteil aber digitale E-Paper-Abos sind. Vor zehn Jahren setzte der Spiegel im Einzelverkauf noch rund 251.000 Hefte ab."
Religion
Zu den Projekten der Ampel gehört die Abschaffung der Staatsleistungen an die Kirchen. Und tatsächlich arbeiten die Fraktionen des Bundestags intensiv daran, berichten Reinhard Bingener und Daniel Deckers in der FAZ. Die Staatsleistungen bringt der Staat neben der Kirchensteuer auf, sie sind eine Art Subventionierung der Kirchen. Die historische Begründung ist, dass die Kirchen für Enteignungen aus dem Jahr 1803 bis heute mit Hunderten von Millionen von Mark pro Jahr "entschädigt" werden. Seit hundert Jahren soll das abgeschafft werden. Nun erzählen die FAZ-Autoren, dass sich die Bundesländer gegen die Abschaffung der Staatsleitungen wehrten, weil sie, äh, zu teuer sei: "Die Höhe der Zahlungen variiert regional, besonders hoch sind sie in Bayern und Baden-Württemberg sowie in Ostdeutschland. Für diese Länder käme eine Ablösung der jährlichen Zahlungen besonders teuer. Die jährlichen Überweisungen müssten mit einem Faktor zwischen 10 und 18 multipliziert werden, hieß es zeitweilig. Es geht also um Milliarden." Die Krux am Vorhaben: Die Kirchen sollen nochmals mit einer riesigen Summe ruhiggestellt werden, bevor die Staatsleistungen tatsächlich abgeschafft werden, auch wenn noch nicht genau geklärt ist, wie das geregelt wird. Aber es gibt noch ganz andere Ideen zu den von allen Bürgern zu erbringenden Staatsleistungen, berichten die FAZ-Autoren: "Günter Krings, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, möchte nicht die Staatsleistungen streichen, sondern den Passus über deren Ablösung im Grundgesetz."
Geschichte
Der Hitler-Stalin-Pakt spaltet Europa bis heute, schreibt der Historiker Felix Ackermann in der FAZ: "Anders als die vom Hitler-Stalin-Pakt betroffenen Gesellschaften verstand die Bundesrepublik 2014 als Staat und als Gesellschaft nicht, dass die russische Annexion der Krim den Beginn der Zerstörung der europäischen Nachkriegsordnung markierte." Die Erinnerung an sowjetische Repression sei in der DDR systematisch ausgelöscht worden - und damit ein realistischer Blick auf die Geschichte, so Ackermann. "Diese programmatische Abkehr ermöglichte einer ganzen Gesellschaft, sich ideologisch und psychologisch von der eigenen Vergangenheit abzutrennen."
Der 23. August ist der "Internationale Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel". Michaela Dudley erzählt in der taz die Geschichte ihrer Vorfahren, die Opfer des transatlantischen Sklavenhandels waren. Allerdings reicht ihr die Erinnerung daran nicht aus: "Die Verdrängung der Sklaverei ist ... eine Tendenz, die nicht nur der weißen, christlich-konservativ geprägten Dominanzgesellschaft bescheinigt werden muss." Dudley konstatiert eine "auffällige Zurückhaltung" bei "woken Wortführer:innen und muslimischen Meinungsbildner:innen ", die sich mit der anderthalbtausendjährigen Geschichte der muslimischen Versklavung von Afrikanern nicht auseinandersetzen wollen: "Das Schweigen über die eigene dunkle Geschichte erzeugt eine kognitive Dissonanz, die es der propalästinensischen Bewegung ermöglicht, den Rassismus in einem moralisch selbstgerechten Rahmen zu verurteilen, während sie gleichzeitig dazu aufruft, den jüdischen Staat auszulöschen."
Der Schriftsteller Hans Christoph Buch wirft indes in der NZZ der postkolonialen Kulturanthropologie Einseitigkeit vor, indem er etwa daran erinnert, "dass Ex-Sklaven aus Jamaica und dem Süden der USA im 19. Jahrhundert von Philanthropen freigekauft und nach Afrika verschifft wurden, wo sie die Anwohner unterjochten und als Sklaven verkauften. Kein Lehrstück von Brecht, sondern ein historischer Fakt - in Liberia und Sierra Leone bilden sie bis heute die Oberschicht. Dass die Dekolonisation Afrikas nicht die ersehnten Resultate brachte und Afrikaner als Boat-People ihr Leben riskieren, um korrupten Regimen zu entfliehen, ist bekannt: Auch Südafrika, der einzige Industriestaat des Kontinents, der dank Mandelas Regenbogenpolitik beste Startbedingungen hatte, ist heute von Gewalt und Korruption bedroht. Kulturanthropologen tun sich schwer, Fehlentwicklungen beim Namen zu nennen, denn die Selbstbestimmung ethnischer Gruppen und Völker ist für sie oberstes Gebot: nicht aus naivem Gutmenschentum heraus, sondern aus Empathie für die Opfer des Kolonialismus, mit deren Revolte jüdische Intellektuelle sich einst identifizierten."
Ebenfalls in der taz erzählt Uta Schleiermacher die ruhmreiche Geschichte der "Roten Hilfe", die hundert Jahre alt wird.
Der 23. August ist der "Internationale Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel". Michaela Dudley erzählt in der taz die Geschichte ihrer Vorfahren, die Opfer des transatlantischen Sklavenhandels waren. Allerdings reicht ihr die Erinnerung daran nicht aus: "Die Verdrängung der Sklaverei ist ... eine Tendenz, die nicht nur der weißen, christlich-konservativ geprägten Dominanzgesellschaft bescheinigt werden muss." Dudley konstatiert eine "auffällige Zurückhaltung" bei "woken Wortführer:innen und muslimischen Meinungsbildner:innen ", die sich mit der anderthalbtausendjährigen Geschichte der muslimischen Versklavung von Afrikanern nicht auseinandersetzen wollen: "Das Schweigen über die eigene dunkle Geschichte erzeugt eine kognitive Dissonanz, die es der propalästinensischen Bewegung ermöglicht, den Rassismus in einem moralisch selbstgerechten Rahmen zu verurteilen, während sie gleichzeitig dazu aufruft, den jüdischen Staat auszulöschen."
Der Schriftsteller Hans Christoph Buch wirft indes in der NZZ der postkolonialen Kulturanthropologie Einseitigkeit vor, indem er etwa daran erinnert, "dass Ex-Sklaven aus Jamaica und dem Süden der USA im 19. Jahrhundert von Philanthropen freigekauft und nach Afrika verschifft wurden, wo sie die Anwohner unterjochten und als Sklaven verkauften. Kein Lehrstück von Brecht, sondern ein historischer Fakt - in Liberia und Sierra Leone bilden sie bis heute die Oberschicht. Dass die Dekolonisation Afrikas nicht die ersehnten Resultate brachte und Afrikaner als Boat-People ihr Leben riskieren, um korrupten Regimen zu entfliehen, ist bekannt: Auch Südafrika, der einzige Industriestaat des Kontinents, der dank Mandelas Regenbogenpolitik beste Startbedingungen hatte, ist heute von Gewalt und Korruption bedroht. Kulturanthropologen tun sich schwer, Fehlentwicklungen beim Namen zu nennen, denn die Selbstbestimmung ethnischer Gruppen und Völker ist für sie oberstes Gebot: nicht aus naivem Gutmenschentum heraus, sondern aus Empathie für die Opfer des Kolonialismus, mit deren Revolte jüdische Intellektuelle sich einst identifizierten."
Ebenfalls in der taz erzählt Uta Schleiermacher die ruhmreiche Geschichte der "Roten Hilfe", die hundert Jahre alt wird.
3 Kommentare