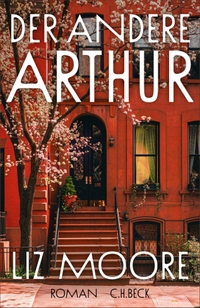9punkt - Die Debattenrundschau
Genießen und strafen
Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
16.12.2017. In der NZZ beklagt Pascal Bruckner den repressiven Charakter des neuen Feminismus. In der New York Times erklärt die Strafrechtlerin Shanita Hubbard, wie schwarze Frauen in den USA lernen, dass sexuelle Gewalt sekundär ist. In der FR seziert der Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi das postfaktische Denken muslimischer Communities. Die taz fürchtet, dass Deutschland in Sachen Antisemitismus keinen Import nötig hat. Außerdem erinnert Eugen Ruge in der taz daran, welch Befreiung es für DDR-Bürger war, Deutsche sein zu dürfen.
Efeu - Die Kulturrundschau
vom
16.12.2017
finden Sie hier
Gesellschaft
Was in den USA #MeToo, ist in Frankreich #BalanceTonPorc (Verpfeif Dein Schwein). Das Ende nahezu feudaler Praktiken begrüßt Pascal Bruckner in der NZZ, aber der zunehmend repressive Charakter stört ihn. "Eros muss ein Kind der Phantasie bleiben, sonst verkümmert er", schreibt er: "Der Feminismus von Simone de Beauvoir, Kate Millett oder Simone Veil zielte darauf ab, die Frauen zu stärken. Der heutige Feminismus installiert um sie herum ein Geflecht von Misstrauen und lehrt sie, hinter Komplimenten von Männern nichts als verkappte Aggression zu sehen. Diese Anklagen klingen wie ein sonderbarer Epilog zur Emanzipationsbewegung der sechziger Jahre. Unsere Gesellschaft spricht eine doppelte Sprache: die der Übertretung und die der Strafe. Sie will zwei Bestrebungen verbinden, die nicht vereinbar sind: immer mehr Freiheit und zugleich immer mehr und härtere Strafen für den Missbrauch der Freiheit. Die 'befreite' französische Gesellschaft füllt ihre Gefängnisse mit Sexualstraftätern, von denen fast ein Drittel Franzosen sind. Wo früher der Priester und der Pfarrer regierten, haben heute Richter und Anwälte das Sagen. Als ob die Freiheiten, die man sich zugesteht, nicht ungerächt bleiben dürften. Genießen und strafen; genießen, um noch mehr zu strafen: Zumindest was Sexualität betrifft, ist das die gegenwärtige Situation der westlichen Welt."
In der New York Times wirft die Strafrechtlerin Shanita Hubbard ein, dass es für schwarze Frauen besonders schwer sei, sexuelle Gewalt anzuprangern, wenn der Täter schwarz ist. Sie erzählt, dass sie als junges Mädchen ständig von den großen Jungs in ihrer Nachbarschaft belästigt wurde, jedoch nie etwas sagte. Nie etwas sagen wollte, weil die bösen Jungs spätestens am nächsten Tag von weißen Polizisten übel malträtiert wurden: "Mir wurde beigebracht, dass es wichtigere Dinge in der Community gab. Deshalb kommen Studien immer wieder zu dem Schluss, dass nur eine von fünfzehn Frauen eine Vergewaltigung anzeigt. Wir sehen die unkontrollierte Macht weißer Männer, die unsere Community drangsalieren, und wir tragen in uns die Botschaft 'Jetzt nicht', wenn es eigentlich gilt, die Verletzungen anzusprechen, die uns schwarze Männer zugefügt haben."
Ja, es gibt einen importierten Antisemitismus und die deutsche Linke sollte sich endlich mit dem frauenfeindlichen, homophoben Illiberalismus muslimischer Communities auseinandersetzen, meint Ulrich Gutmair in der taz, doch es gibt auch einen hausgemachten, auf den sich Neonazis, Verschwörungstheoretiker, linke Antiimperialisten, Islamisten, bibelfeste Protestanten, Friedensbewegte, BDS-Aktivisten, Querfrontler und rappende Hassprediger einigen: "Richtig dumm an der Sache ist, dass es diese Umfrage aus dem Jahr 2016 gibt. Damals akzeptierten 40 Prozent der Befragten diese Aussage: 'Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.' 24 Prozent machten sich die schäbigste aller Relativierungen der 'Israelkritik' zu eigen: "Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben."
In der FR wirft der Freiburger Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi dennoch einen Blick auf den muslimischen Antisemitismus, den er vom Nahostkonflikt verstärkt sieht, aber im Koran angelegt und von Verbänden wie Ditib genährt: "Die Mehrheit der Muslime beherrscht kunstvoll ihr rhetorisches Spiel: Sie stellen die Muslime als die ewigen Opfer dar. Andererseits benutzen sie den Vorwurf der Islamophobie gegen ihre Kritiker, um den Islam im westlichen Kontext unangreifbar zu machen. Der ewige Status der Schwachen wird oft durch Verschwörungstheorien intensiviert. Sogar der IS in Syrien und im Irak sei ein Produkt Amerikas und Israels, um den Islam und die Muslime zu diskreditieren und zu schwächen. So wäscht man sich praktischerweise von den todbringenden Gewalttaten des islamischen Terrorismus rein, dessen Erfolge gegen den überheblichen Westen man insgeheim feiert. Im Kombinieren von Halbwahrheiten und Erfindungen zu postfaktischen Verschwörungstheorien brauchen diese Muslime weder von Putin noch von Trump zu lernen."
In der New York Times wirft die Strafrechtlerin Shanita Hubbard ein, dass es für schwarze Frauen besonders schwer sei, sexuelle Gewalt anzuprangern, wenn der Täter schwarz ist. Sie erzählt, dass sie als junges Mädchen ständig von den großen Jungs in ihrer Nachbarschaft belästigt wurde, jedoch nie etwas sagte. Nie etwas sagen wollte, weil die bösen Jungs spätestens am nächsten Tag von weißen Polizisten übel malträtiert wurden: "Mir wurde beigebracht, dass es wichtigere Dinge in der Community gab. Deshalb kommen Studien immer wieder zu dem Schluss, dass nur eine von fünfzehn Frauen eine Vergewaltigung anzeigt. Wir sehen die unkontrollierte Macht weißer Männer, die unsere Community drangsalieren, und wir tragen in uns die Botschaft 'Jetzt nicht', wenn es eigentlich gilt, die Verletzungen anzusprechen, die uns schwarze Männer zugefügt haben."
Ja, es gibt einen importierten Antisemitismus und die deutsche Linke sollte sich endlich mit dem frauenfeindlichen, homophoben Illiberalismus muslimischer Communities auseinandersetzen, meint Ulrich Gutmair in der taz, doch es gibt auch einen hausgemachten, auf den sich Neonazis, Verschwörungstheoretiker, linke Antiimperialisten, Islamisten, bibelfeste Protestanten, Friedensbewegte, BDS-Aktivisten, Querfrontler und rappende Hassprediger einigen: "Richtig dumm an der Sache ist, dass es diese Umfrage aus dem Jahr 2016 gibt. Damals akzeptierten 40 Prozent der Befragten diese Aussage: 'Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat.' 24 Prozent machten sich die schäbigste aller Relativierungen der 'Israelkritik' zu eigen: "Was der Staat Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis im Dritten Reich mit den Juden gemacht haben."
In der FR wirft der Freiburger Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi dennoch einen Blick auf den muslimischen Antisemitismus, den er vom Nahostkonflikt verstärkt sieht, aber im Koran angelegt und von Verbänden wie Ditib genährt: "Die Mehrheit der Muslime beherrscht kunstvoll ihr rhetorisches Spiel: Sie stellen die Muslime als die ewigen Opfer dar. Andererseits benutzen sie den Vorwurf der Islamophobie gegen ihre Kritiker, um den Islam im westlichen Kontext unangreifbar zu machen. Der ewige Status der Schwachen wird oft durch Verschwörungstheorien intensiviert. Sogar der IS in Syrien und im Irak sei ein Produkt Amerikas und Israels, um den Islam und die Muslime zu diskreditieren und zu schwächen. So wäscht man sich praktischerweise von den todbringenden Gewalttaten des islamischen Terrorismus rein, dessen Erfolge gegen den überheblichen Westen man insgeheim feiert. Im Kombinieren von Halbwahrheiten und Erfindungen zu postfaktischen Verschwörungstheorien brauchen diese Muslime weder von Putin noch von Trump zu lernen."
Ideen
Überhaupt nicht begeistert ist Marko Martin bei den Salonkolumnisten von der Ausstellung "Parapolitik - Kulturelle Freiheit und Kalter Krieg" im Berliner Haus der Kulturen, die aus der Tatsache, dass sich die CIA nach dem Krieg kulturpolitisch engagierte, ein Argument gegen den Antitotalitarismus mache. Es sei, stehe tatsächlich auf der Webseite zur Ausstellung in aller Unschuld und bester DKP-Prosa, nur darum gegangen, die "hegemonialen Interessen der USA in einem Kalten Krieg der Kultur zu befördern". Die CIA hatte bekanntlich Zeitschriften wie den Monat finanziert, in denen Intellektuelle wie Raymond Aron oder Hannah Arendt publizierten. Martin dazu: "Das insinuierte Zerrbild der CIA-gekauften Verräter gewinnt zusätzlich Kontur, wenn Kurator Anselm Franke in forschem Neonationalismus behauptet: 'Es ging darum, Kulturförderung in großem Maßstab zu betreiben, um einen bestimmten Freiheitsbegriff amerikanischer Herkunft durchzusetzen.' Nun ja, die 1933 aus Nazi-Deutschland vertriebenen Hans Sahl und Walter Mehring schrieben ihre 'Kulturbriefe' tatsächlich aus New York."
Europa
Ulrike Ackermann nutzte einen Vortrag der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs der Republik Polen, Julia Przylebska, in Frankfurt zu einer "Gegenrede", die der Perlentaucher gestern veröffentlichte - sie wurde noch gehalten, bevor die Meldung kam, dass die EU-Kommission in der nächsten Woche wohl ein Rechtstaatsverfahren gegen Polen einleiten wird: "Ausgerechnet Ungarn und Polen, ehemals Vorreiter im Aufbau des Rechtstaats nach dem Sieg über den Kommunismus, sind jetzt Vorreiter im Abbau des Rechtsstaats. Polens Regierung hält offensichtlich wenig von der Gewaltenteilung und hebt sie sukzessive auf..."
Geschichte
In einem sehr lesenswerten taz-Interview mit Andreas Fanizadeh erzählt der Schriftsteller Eugen Ruge vom Leben in der DDR, seinem Vater Wolfgang Ruge, der fünfzehn Jahre im sowjetischen Gulag verbracht hatte und trotzdem überzeugter Kommunist blieb. Den heutigen Erfolg der AfD im Osten erklärt er sich auch mit den brutalen Brüchen, die Ostler nach der Wende erlebten: "Die Grenzen öffnen sich, der Umgang mit dem Begriff Deutsch ändert sich. Wir alle, auch diejenigen, die sich nicht mit der DDR identifiziert haben, trugen den Begriff DDR-Bürger wie ein Brandzeichen mit uns herum. Wir waren keine Deutschen, wir waren DDR-Bürger. Viele waren froh, dieses seltsame Dreibuchstabenkürzel als Identitätsbezeichnung los zu sein. Kaum sind sie es los, erfahren sie, dass deutsch zu sein etwas Schwieriges ist. Etwas was man schnell wieder vergessen soll. Das man jetzt in einer offeneren, anderen Identität aufgehen soll. Sie reagieren anders als Westdeutsche. Und es ist eine Art koloniale Überheblichkeit, wenn die Westdeutschen die Erfahrungen und Perspektiven der Ostdeutschen nicht ernst nehmen oder als primitiv betrachten."
Im Tagesspiegel sprechen Björn Rosen und Joshua Kocher mit der russischen Historikerin und Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa von Memorial über den hundertsten Jahrestag der Oktoberrevolution. Sie hatte bereits Ende der siebziger Jahre Frauen interviewt, die im Gulag interniert waren. Scherbakowa kann nur bestätigen, was Ruge von seinem Vater erzählt: "Ich habe sehr wenige Menschen erlebt, die aus dem Gulag kamen und nicht in die Partei zurückgingen. Gut, es gab praktische Gründe, man wollte wieder ins Leben. Aber manche haben sich so sehr mit der Ideologie identifiziert, andernfalls wäre ihnen das Leben sinnlos erschienen; sie hassten Stalin, doch glaubten nach wie vor an Lenin."
Im Tagesspiegel sprechen Björn Rosen und Joshua Kocher mit der russischen Historikerin und Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa von Memorial über den hundertsten Jahrestag der Oktoberrevolution. Sie hatte bereits Ende der siebziger Jahre Frauen interviewt, die im Gulag interniert waren. Scherbakowa kann nur bestätigen, was Ruge von seinem Vater erzählt: "Ich habe sehr wenige Menschen erlebt, die aus dem Gulag kamen und nicht in die Partei zurückgingen. Gut, es gab praktische Gründe, man wollte wieder ins Leben. Aber manche haben sich so sehr mit der Ideologie identifiziert, andernfalls wäre ihnen das Leben sinnlos erschienen; sie hassten Stalin, doch glaubten nach wie vor an Lenin."
Kommentieren