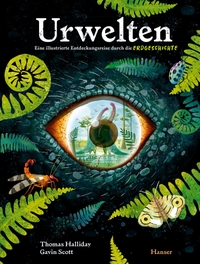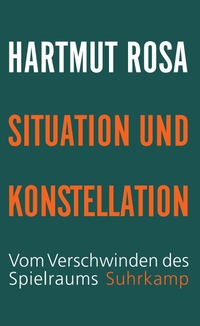9punkt - Die Debattenrundschau
Wir sind doch die Guten
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
06.09.2022. Russland hat den "Genozid" an den Ukrainern schon lange vorbereitet, sagt der ukrainische Philosoph Wolodymyr Jermolenko in der Berliner Zeitung. Die Russen haben sich dem Revanchismus verschrieben, die Ukrainer der Demokratie, schreibt die ukrainische Journalistin Nataliya Gumenyuk auf ZeitOnline. In der NZZ erklärt Josef Joffe, weshalb "Demokratie-Export" nie funktioniert, wenn es nicht um die eigene Haut geht. Die Chilenen wollen kein "linkes Utopia", lernt Spon. Die FAZ staunt, wie sehr sich die Debatten um Antizionismus und Antisemitismus in den Siebzigern und heute ähneln.
Efeu - Die Kulturrundschau
vom
06.09.2022
finden Sie hier
Europa
Die Zeit hat jetzt aus ihrem Ukraine-Dossier Nataliya Gumenyuks Artikel online nachgereicht. Die ukrainische Journalistin beschreibt darin den Gegensatz zwischen der russischen Gesellschaft, die sich mehrheitlich dem Revanchismus verschrieben hat, und der ukrainischen, die sich in den letzten Jahren Richtung Demokratie bewegt hat, was Russland nur als Provokation verstehen kann: "Selbstverständlich wurden die Ukrainer auch in der russischen Propaganda der letzten zwanzig Jahre entkommunisiert, man band ihnen das Nazilabel auf. Es ist die übliche Taktik totalitärer Regimes, Feindbilder zu kreieren, um den eigenen Soldaten freie Hand geben zu können in ihrem kriegerischen Handeln. Doch die Repressionen im von Russland besetzten Norden und Osten der Ukraine basieren auf keinem ethnischen Prinzip. Zum Opfer eines russischen Soldaten kann schlicht jede und jeder werden, die oder der die Besatzung nicht unterstützt. Ein Ukrainer in Nationaltracht dagegen, der in seiner Muttersprache Putin verherrlicht, kann sehr einfach die Rolle des Hofnarren in einer Propaganda-Talkshow zugewiesen bekommen. So läuft das in Imperien. Hauptsache, es ist nicht der Ukrainer selbst, der entscheidet, wer er im 'Russkij mir', der 'Russischen Welt', sein will".
Im Interview mit Peter Althaus (Berliner Zeitung) spricht der ukrainische Philosoph Wolodymyr Jermolenko von einem "Genozid" an den Ukrainern: "Ukrainer werden in der russischen Propaganda schon länger als Nicht- oder Untermenschen dargestellt. Ukrainer sind dort Nazis und Faschisten. Nach der russischen Lesart hat man deshalb das Recht, sie auszurotten. Die russische Propaganda hat diesen Genozid an uns Ukrainern auch schon länger vorbereitet. Mit dem falschen Narrativ, dass Ukrainer im Donbass einen Genozid an Russen begangen hätten, was auch Putin selbst im vergangenen Jahr in einer Rede verbreitet hat, haben die Russen in Wahrheit ihren Genozid an den Ukrainern moralisch vorbereiten und rechtfertigen wollen. Und es gibt übrigens noch ein sehr neues und praktisches Narrativ, das die russische Propaganda gezielt verbreitet: Ukrainer können mit westlichen Waffen nicht umgehen, westliche Waffen werden weiterverkauft und geschmuggelt. Das alles geht auf das Narrativ des brutalen, gierigen, rohen und niederen Ukrainers zurück."
Im Welt-Gespräch mit Marie-Luise Goldmann kritisiert der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk, der mit "Crudelitas" gerade eine Studie zur Grausamkeit veröffentlicht hat, unsere Gesellschaft, "in der jeder zu schnell ein Opfer sein will, um damit ein moralisches Surplus zu gewinnen". Außerdem warnt er davor, Russland für alle Zeit "ganz unten" halten zu wollen: "Wenn wir uns oder die Ukraine nicht verteidigen, werden wir selbst Opfer und uns in Gesellschaften wiederfinden, die denen der Putinisten sehr ähnlich sind. Und das können wir nicht wollen. Wir müssen eine Armee haben, damit wir sie nicht einsetzen müssen. Das ist der Widerspruch. Das Ziel der Politiker der linken und rechten Mitte in Europa ist allerdings nicht die Zerstörung von Russland. Wir wissen genau, dass es ein Danach geben muss. Es hat auch ein Danach im Post-Hitlerschen Deutschland gegeben. Wir dürfen nicht dem archaischen Rachegedanken verfallen und noch eins draufsetzen."
In der SZ lässt die schottische Autorin A. L. Kennedy erwartungsgemäß kein gutes Haar an der neuen britischen Premierministerin Liz Truss: "Truss war von Beginn an die Favoritin. In einer normal tickenden Welt wäre das vollkommen unverständlich - es sei denn, um mit Shakespeare zu sprechen, die Hölle wäre leer, und alle Teufel wären hier. Truss hat sich bereits als Außenministerin dadurch profiliert, dass sie sich als noch stärker kognitiv eingeschränkt, noch undiplomatischer erwies, als es selbst Johnson in dieser Rolle gelungen war. ... Truss stolpert von einem dummen, aggressiv-kämpferischen Fauxpas zum nächsten. Sie wirkt dabei wie eine Fünfjährige, die gerade gegen eine Tür gelaufen ist - und die Gefallen daran gefunden hat."
In Paris hat gestern der Prozess gegen die mutmaßlichen Helfer des Attentäters begonnen, der vor sechs Jahren mit einem Lastwagen auf der Promenade des Anglais in Nizza 86 Menschen tötete, bevor die Polizei ihn erschoss, berichtet Rudolf Balmer in der taz. "Auch wenn der Attentäter jetzt nicht vor Gericht gestellt werden kann, wird der Prozess Fragen zu seiner Person, seiner Herkunft und Ankunft in Südfrankreich aufwerfen. Auch seine Radikalisierung, die anscheinend erst kurz vor seiner Tat erfolgte, wird thematisiert werden. Die dazu bei den Ermittlungen befragten Angehörigen, vor allem sein Vater und seine Ex-Gattin, sagen, der 31-jährige Tunesier sei ein zorniger und gewalttätiger Mensch gewesen. Seine Frau beschreibt ihn als 'pervers'. Er war im März 2016 wegen vorsätzlicher Gewalt gegen seine Frau zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. An der Religion im Allgemeinen und am Islam im Speziellen sei er lange überhaupt nicht interessiert gewesen, er habe Alkohol getrunken und Schweinefleisch gegessen."
Im Interview mit Peter Althaus (Berliner Zeitung) spricht der ukrainische Philosoph Wolodymyr Jermolenko von einem "Genozid" an den Ukrainern: "Ukrainer werden in der russischen Propaganda schon länger als Nicht- oder Untermenschen dargestellt. Ukrainer sind dort Nazis und Faschisten. Nach der russischen Lesart hat man deshalb das Recht, sie auszurotten. Die russische Propaganda hat diesen Genozid an uns Ukrainern auch schon länger vorbereitet. Mit dem falschen Narrativ, dass Ukrainer im Donbass einen Genozid an Russen begangen hätten, was auch Putin selbst im vergangenen Jahr in einer Rede verbreitet hat, haben die Russen in Wahrheit ihren Genozid an den Ukrainern moralisch vorbereiten und rechtfertigen wollen. Und es gibt übrigens noch ein sehr neues und praktisches Narrativ, das die russische Propaganda gezielt verbreitet: Ukrainer können mit westlichen Waffen nicht umgehen, westliche Waffen werden weiterverkauft und geschmuggelt. Das alles geht auf das Narrativ des brutalen, gierigen, rohen und niederen Ukrainers zurück."
Im Welt-Gespräch mit Marie-Luise Goldmann kritisiert der Kulturwissenschaftler Wolfgang Müller-Funk, der mit "Crudelitas" gerade eine Studie zur Grausamkeit veröffentlicht hat, unsere Gesellschaft, "in der jeder zu schnell ein Opfer sein will, um damit ein moralisches Surplus zu gewinnen". Außerdem warnt er davor, Russland für alle Zeit "ganz unten" halten zu wollen: "Wenn wir uns oder die Ukraine nicht verteidigen, werden wir selbst Opfer und uns in Gesellschaften wiederfinden, die denen der Putinisten sehr ähnlich sind. Und das können wir nicht wollen. Wir müssen eine Armee haben, damit wir sie nicht einsetzen müssen. Das ist der Widerspruch. Das Ziel der Politiker der linken und rechten Mitte in Europa ist allerdings nicht die Zerstörung von Russland. Wir wissen genau, dass es ein Danach geben muss. Es hat auch ein Danach im Post-Hitlerschen Deutschland gegeben. Wir dürfen nicht dem archaischen Rachegedanken verfallen und noch eins draufsetzen."
In der SZ lässt die schottische Autorin A. L. Kennedy erwartungsgemäß kein gutes Haar an der neuen britischen Premierministerin Liz Truss: "Truss war von Beginn an die Favoritin. In einer normal tickenden Welt wäre das vollkommen unverständlich - es sei denn, um mit Shakespeare zu sprechen, die Hölle wäre leer, und alle Teufel wären hier. Truss hat sich bereits als Außenministerin dadurch profiliert, dass sie sich als noch stärker kognitiv eingeschränkt, noch undiplomatischer erwies, als es selbst Johnson in dieser Rolle gelungen war. ... Truss stolpert von einem dummen, aggressiv-kämpferischen Fauxpas zum nächsten. Sie wirkt dabei wie eine Fünfjährige, die gerade gegen eine Tür gelaufen ist - und die Gefallen daran gefunden hat."
In Paris hat gestern der Prozess gegen die mutmaßlichen Helfer des Attentäters begonnen, der vor sechs Jahren mit einem Lastwagen auf der Promenade des Anglais in Nizza 86 Menschen tötete, bevor die Polizei ihn erschoss, berichtet Rudolf Balmer in der taz. "Auch wenn der Attentäter jetzt nicht vor Gericht gestellt werden kann, wird der Prozess Fragen zu seiner Person, seiner Herkunft und Ankunft in Südfrankreich aufwerfen. Auch seine Radikalisierung, die anscheinend erst kurz vor seiner Tat erfolgte, wird thematisiert werden. Die dazu bei den Ermittlungen befragten Angehörigen, vor allem sein Vater und seine Ex-Gattin, sagen, der 31-jährige Tunesier sei ein zorniger und gewalttätiger Mensch gewesen. Seine Frau beschreibt ihn als 'pervers'. Er war im März 2016 wegen vorsätzlicher Gewalt gegen seine Frau zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. An der Religion im Allgemeinen und am Islam im Speziellen sei er lange überhaupt nicht interessiert gewesen, er habe Alkohol getrunken und Schweinefleisch gegessen."
Politik
Die Chilenen wollen eine neue Verfassung, die die alte, noch von Pinochet geprägte, ersetzt. Aber den ersten Vorschlag haben sie jetzt abgelehnt. Und zu Recht, findet Lateinamerika-Korrespondent Jens Glüsing auf Spon. "Gute Verfassungen sind kurz, so wie die der USA oder das deutsche Grundgesetz. ... Die Magna Carta, die den Chileninnen und Chilenen am Sonntag zur Abstimmung vorgelegt wurde, umfasst dagegen 380 Paragrafen und hat 178 Seiten. Sie war kein Entwurf für einen Gesellschaftsvertrag, sondern bildete in weiten Teilen ein linkes Utopia ab, das den Wunschvorstellungen einer gesellschaftlichen Minderheit entspricht. Deshalb ist es gut, dass sie mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde. Ein knappes Ergebnis hätte die Spaltung der chilenischen Gesellschaft weiter vertieft."
In der FR ist Klaus Ehringfeld hingegen enttäuscht: Der Verfassungsentwurf hätte "Maßstäbe gesetzt für andere Länder", meint er. Die Rechte der Natur wären "mit denen der Wirtschaft faktisch auf eine Stufe gestellt worden. Mit entsprechenden Eingriffsmöglichkeiten des Staates. Den Entwurf zeichnete eine radikale Abkehr vom neoliberalen Modell aus, nach dem Chile seit mehr als 40 Jahren mehr schlecht als recht für die große Mehrheit der Bevölkerung funktioniert hat. Dabei haben maximale Forderungen wie die nach einer Verstaatlichung der Bodenschätze nicht einmal Eingang in den Entwurf gefunden. Aber dennoch setzte sich bei der Bevölkerung der Eindruck fest, dass dieses Modell einer Magna Charta zu radikal geraten sei."
"Demokratie-Export" hat nur zweimal geklappt, in Deutschland und in Japan - woanders, zuletzt in Afghanistan, scheiterte die "Umerziehung", schreibt Zeit-Herausgeber Josef Joffe in der NZZ. Warum gibt der Westen immer wieder auf? "Weil die Demokratien auf Dauer keine Kriege durchhalten, wo es nicht um die eigene Haut geht." Und die Verteidiger haben zwei Vorteile: "Der taktische: Sie können die besten Waffen des Westens entwerten, indem sie die offene Feldschlacht vermeiden, keine Ziele bieten. Ihre Trümpfe sind der Hinterhalt und der Überraschungsangriff. Sie entfesseln Terror gegen die eigene Bevölkerung, um sie vom Retter und vom Regime abzuspalten. (…) Der zweite Vorteil ist ein psychologischer. Die Invasoren scheuen das Blutvergießen nicht nur auf der eigenen, sondern auch auf der anderen Seite. Für ihre Feinde sind die eigenen Opfer zynischer Teil des Programms. Sie wissen, dass ihre Toten auf den westlichen Bildschirmen die Abscheu hochlodern lassen und die Bereitschaft, zu bleiben, schwächen. Wir sind doch die Guten, keine Killer. Dieses Problem hat Putin in der Ukraine nicht. Die zivilen Opfer sind in seinem Raubkrieg Teil der Terrorstrategie."
In der FR ist Klaus Ehringfeld hingegen enttäuscht: Der Verfassungsentwurf hätte "Maßstäbe gesetzt für andere Länder", meint er. Die Rechte der Natur wären "mit denen der Wirtschaft faktisch auf eine Stufe gestellt worden. Mit entsprechenden Eingriffsmöglichkeiten des Staates. Den Entwurf zeichnete eine radikale Abkehr vom neoliberalen Modell aus, nach dem Chile seit mehr als 40 Jahren mehr schlecht als recht für die große Mehrheit der Bevölkerung funktioniert hat. Dabei haben maximale Forderungen wie die nach einer Verstaatlichung der Bodenschätze nicht einmal Eingang in den Entwurf gefunden. Aber dennoch setzte sich bei der Bevölkerung der Eindruck fest, dass dieses Modell einer Magna Charta zu radikal geraten sei."
"Demokratie-Export" hat nur zweimal geklappt, in Deutschland und in Japan - woanders, zuletzt in Afghanistan, scheiterte die "Umerziehung", schreibt Zeit-Herausgeber Josef Joffe in der NZZ. Warum gibt der Westen immer wieder auf? "Weil die Demokratien auf Dauer keine Kriege durchhalten, wo es nicht um die eigene Haut geht." Und die Verteidiger haben zwei Vorteile: "Der taktische: Sie können die besten Waffen des Westens entwerten, indem sie die offene Feldschlacht vermeiden, keine Ziele bieten. Ihre Trümpfe sind der Hinterhalt und der Überraschungsangriff. Sie entfesseln Terror gegen die eigene Bevölkerung, um sie vom Retter und vom Regime abzuspalten. (…) Der zweite Vorteil ist ein psychologischer. Die Invasoren scheuen das Blutvergießen nicht nur auf der eigenen, sondern auch auf der anderen Seite. Für ihre Feinde sind die eigenen Opfer zynischer Teil des Programms. Sie wissen, dass ihre Toten auf den westlichen Bildschirmen die Abscheu hochlodern lassen und die Bereitschaft, zu bleiben, schwächen. Wir sind doch die Guten, keine Killer. Dieses Problem hat Putin in der Ukraine nicht. Die zivilen Opfer sind in seinem Raubkrieg Teil der Terrorstrategie."
Gesellschaft
Gestern fand in Fürstenfeldbruck das Gedenken an die Opfer des Olympia-Attentats 1972 in München statt. Und diesmal hat die Bundesregierung es richtig gemacht, atmet Wolf Wiedmann-Schmidt bei Spon auf: "50 Jahre lang mussten die Angehörigen der elf ermordeten Israelis auf diese Worte warten. Nun steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) in einem weißen Zelt auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck und sagt: 'Ich bitte Sie als Staatsoberhaupt dieses Landes und im Namen der Bundesrepublik Deutschland um Vergebung.' Vergebung für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten und Trainer bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Und für die mangelnde Aufklärung danach. 'Dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist.' Es ist ein Bekenntnis zur deutschen Verantwortung - ohne Wenn und Aber. Ein Schuldeingeständnis, das mehr als überfällig war."
Es war eine würdige Entschuldigung, findet auch Thomas Kaspar in der FR. Aber sie reicht noch nicht: "Die Akten sind bis heute vertuscht und unter Verschluss. Das Debakel ist nicht beendet." Die Deutschen haben noch einiges aufzuarbeiten, meint auch Reinhard Müller in der FAZ. Aber er fragt sich auch: "Wo bleiben Entschuldigung und Entschädigung - auf Seiten der Palästinenser?" Ähnlich sieht das Klaus Hillenbrand in der taz: "Zu Recht werden hierzulande die NS-Gräuel verurteilt - aber viel zu selten gilt Gleiches für Judenhass ohne NS-Regime. So wie in München 1972."
Das Attentat war von der palästinensischen Organisation Schwarzer September begangen worden. Danach ging die Bundesregierung teils recht scharf gegen palästinensische Gruppen in Deutschland vor, die seit einigen Jahren daran gearbeitet hatten, "palästinensische Politik in Westdeutschland sozusagen heimisch zu machen, durch Anschluss an westdeutsche Diskurse", erinnert in der FAZ der Historiker Joseph Ben Prestel. Und die Debatten damals waren den heutigen schon sehr ähnlich: "In aktuellen Debatten um Antizionismus und Antisemitismus in Deutschland, etwa im Zusammenhang mit der Einladung des Philosophen Achille Mbembe zur Ruhrtriennale, entsteht manchmal der Eindruck, dass es sich um vollkommen neue Entwicklungen handele. Begriffe wie 'globaler Süden' oder antiisraelische Bewegungen wie BDS mögen neu sein. Viele der Konfliktlinien von heute waren jedoch bereits 1972 zu erkennen. Hierzu gehörten ein propalästinensischer Aktivismus, der sich auf den Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus berief, ebenso wie eine öffentliche Debatte um den Zusammenhang von Migration, Antizionismus und Antisemitismus. So hatte sich beispielsweise die rhetorische Verknüpfung der palästinensischen Sache mit dem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika, mit der heute Autoren wie Mbembe provozieren, bereits vor fünfzig Jahre etabliert."
Es war eine würdige Entschuldigung, findet auch Thomas Kaspar in der FR. Aber sie reicht noch nicht: "Die Akten sind bis heute vertuscht und unter Verschluss. Das Debakel ist nicht beendet." Die Deutschen haben noch einiges aufzuarbeiten, meint auch Reinhard Müller in der FAZ. Aber er fragt sich auch: "Wo bleiben Entschuldigung und Entschädigung - auf Seiten der Palästinenser?" Ähnlich sieht das Klaus Hillenbrand in der taz: "Zu Recht werden hierzulande die NS-Gräuel verurteilt - aber viel zu selten gilt Gleiches für Judenhass ohne NS-Regime. So wie in München 1972."
Das Attentat war von der palästinensischen Organisation Schwarzer September begangen worden. Danach ging die Bundesregierung teils recht scharf gegen palästinensische Gruppen in Deutschland vor, die seit einigen Jahren daran gearbeitet hatten, "palästinensische Politik in Westdeutschland sozusagen heimisch zu machen, durch Anschluss an westdeutsche Diskurse", erinnert in der FAZ der Historiker Joseph Ben Prestel. Und die Debatten damals waren den heutigen schon sehr ähnlich: "In aktuellen Debatten um Antizionismus und Antisemitismus in Deutschland, etwa im Zusammenhang mit der Einladung des Philosophen Achille Mbembe zur Ruhrtriennale, entsteht manchmal der Eindruck, dass es sich um vollkommen neue Entwicklungen handele. Begriffe wie 'globaler Süden' oder antiisraelische Bewegungen wie BDS mögen neu sein. Viele der Konfliktlinien von heute waren jedoch bereits 1972 zu erkennen. Hierzu gehörten ein propalästinensischer Aktivismus, der sich auf den Kampf gegen Kolonialismus und Rassismus berief, ebenso wie eine öffentliche Debatte um den Zusammenhang von Migration, Antizionismus und Antisemitismus. So hatte sich beispielsweise die rhetorische Verknüpfung der palästinensischen Sache mit dem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika, mit der heute Autoren wie Mbembe provozieren, bereits vor fünfzig Jahre etabliert."
Kulturpolitik
"Kolonialismus und Holocaust sind unvergleichlich. Das macht es aber nicht unmöglich, sie in Bezug zu setzen, um sie in ihrer Unvergleichlichkeit besser zu verstehen", sagt Generalintendant Hartmut Dorgerloh im Gespräch mit Nicola Kuhn (Tagesspiegel+), in dem er auch kritisiert, dass der Förderverein des Stadtschlosses bis heute über die Herkunft der Spenden schweigt. Und er erklärt noch einmal, weshalb er die Initiative GG5.3 Weltoffenheit unterzeichnet hat: "Wir müssen diese Räume verteidigen, in den Medien, Kultureinrichtungen und der Wissenschaft. Ansonsten öffnen wir populistischen, autoritären Strukturen Tor und Tür. Deshalb finde ich den kuratorischen Ansatz der Documenta auch prinzipiell richtig, nicht länger nur den Meistererzählungen zu folgen. Kollektive sind eine Alternative. Ähnlich verstehen wir uns als Humboldt Forum, wenn wir Gäste einladen."
Medien
Die Intendantinnenkrise ist in erster Linie eine Krise der moralischen Legitimation des RBB, schreibt Max Thomas Mehr im Perlentaucher: "Wie soll etwa ein RBB-Journalist ernst genommen werden mit einem 'Tagesthemen-Kommentar' zum Thema '300 Euro Energiegeld', wenn jeder gelesen hat: seine Intendantin soll sich weitaus höhere Kosten für mutmaßlich private Abendessen mit Gästen vom Sender habe erstatten lassen? Wie soll ein Reporter des RBB nach diesem Skandal gegenüber anderen Firmen auftreten, über deren Compliance-Verstöße er recherchieren und berichten will?"
Kommentieren