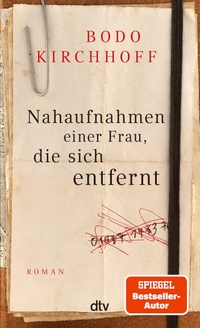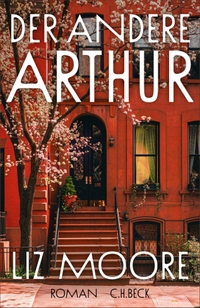Efeu - Die Kulturrundschau
Im Club der jammernden Milliardäre
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
03.11.2022. Die taz lässt sich beeindrucken von Pamela Meyer-Arndts Filmdoku über die "Rebellinnen" Tina Bara, Cornelia Schleime und Gabriele Stötzer, die in der DDR gegen alle Widerstände ihre Kunst machten. Der Tagesspiegel erinnert sich in einer Bonner Opern-Ausstellung wehmütig an die Zeiten, als Oper noch in erster Linie Uraufführung war. Die FAZ bewundert die präzise choreografierte Unfertigkeit von David O. Russells Filmkomödie "Amsterdam". Die Zeit blickt traurig auf Kanye West.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
03.11.2022
finden Sie hier
Kunst

Jana Demnitz hat sich für den Tagesspiegel mit Pamela Meyer-Arndt und Tina Bara über den Film unterhalten. "Gabriele Stötzer wollte von Anfang an dabei sein", erzählt Meyer-Arndt. "Die Dreharbeiten waren wegen der vielen sehr persönlichen und auch schmerzhaften Erinnerungen manchmal nicht ganz einfach für sie. Aber nach all den Jahrzehnten ist sie jetzt glücklich, mit ihrer Geschichte rausgehen zu können. Sie ist schon zu lange als Künstlerin zu wenig beachtet worden. Cornelia Schleime hatte wiederum im Westen ja schon Karriere gemacht. Ihr Impuls war zunächst einmal: Ach, lasst mich doch mit dem ganzen Ost-Quatsch in Ruhe. Das ist doch alles schon so lange her. Sie hatte erst Nein gesagt, dann aber ihre Meinung geändert." Und auch Bara war erst skeptisch erzählt sie, weil sie sich nie als "Rebellin" gesehen habe: "Dagegen habe ich mich am Anfang gewehrt. Es klingt ja etwas reißerisch. Dieser Begriff erzeugt bei vielen sicher erst einmal ein gewisses Bild: die kämpfende Frau. Ich war Pazifistin, bin es von der Idee her immer noch. Aber mittlerweile kann ich damit leben."
Weiteres: Katharina Rustler bestaunt im Standard den monumentalen virtuellen Schutzengel, den die chinesische Medienkünstlerin Cao Fei auf den eisernen Vorhang der Wiener Staatsoper projiziert. In der NZZ berichtet Philipp Meier von einem Zürcher Startup, das nach algorithmischer Analyse die Echtheit eines Tizians des Kunsthauses Zürich anzweifelt. Viel Lärm gibt es um einen "Kunstskandal", den der Falter aufgedeckt hat: André Heller hatte einen 2017 auf der Kunstmesse TEFAF in New York einen Rahmen zum Verkauf angeboten, der angeblich von Basquiat geschaffen worden war, den Heller aber selbst angefertigt hatte. Der Rahmen umfasste allerdings einen echten Basquiat, eine authentische Grafik aus Hellers Besitz. Angeblich wollte Heller die Kunstwelt nur foppen, aber verkauft hat er den Rahmen tatsächlich (mittlerweile aber zurückgekauft): Standard, FAZ, taz und SZ berichten. Besprochen wird die Ausstellung "BestOff 22" der Kunst-Uni Linz (Standard).
Musik
Trist und trostlos, was aus Kanye West geworden ist, findet Moritz von Uslar im Zeit-Kommentar: "Der Rapper, der Hitler-Müll erzählt - so lässt sich seine Social-Media-Aktivität der letzten Tage zusammenfassen. ... Im Club der jammernden Milliardäre (Musk, Trump) nimmt der Rapper mit dem doofen neuen Namen nun eine Avantgarde-Stellung ein: Die Steigerung des psychisch angeschlagenen Milliardärs mit ungesund hoher sozialer Reichweite ist der antisemitische Milliardär."
Außerdem: Im VAN-Magazin spricht Steve Reich über seine Komposition "Traveler's Prayer" und gerät dabei mit Jeffrey Arlo Brown ziemlich ins Detail von Übersetzerfragen, Partituren und Kadenzen. Für die taz spricht Robert Mießner mit dem Synthesizerpionier Morton Subotnick, über den heute in Berlin ein Porträtfilm gezeigt wird. In seiner VAN-Reihe über Komponistinnen widmet sich Arno Lücker in dieser Woche hier Hilary Tann und dort Phyllis Tate. Das Logbuch Suhrkamp bringt Thomas Meineckes neue Lieferung aus "Clip//Schule ohne Worte":
Besprochen werden Bob Dylans Essaysammlung "Die Philosophie des modernen Songs" (Zeit, Welt), Jarvis Cockers Autobiografie "Good Pop, Bad Pop" (FR) und das Album "Transporting Salt" des Spiritczualic Enhancement Centers (tazler Andreas Hartmann verspricht einen "bekifften Mix aus Jazz, Psychedelic und Krautrock").
Außerdem: Im VAN-Magazin spricht Steve Reich über seine Komposition "Traveler's Prayer" und gerät dabei mit Jeffrey Arlo Brown ziemlich ins Detail von Übersetzerfragen, Partituren und Kadenzen. Für die taz spricht Robert Mießner mit dem Synthesizerpionier Morton Subotnick, über den heute in Berlin ein Porträtfilm gezeigt wird. In seiner VAN-Reihe über Komponistinnen widmet sich Arno Lücker in dieser Woche hier Hilary Tann und dort Phyllis Tate. Das Logbuch Suhrkamp bringt Thomas Meineckes neue Lieferung aus "Clip//Schule ohne Worte":
Besprochen werden Bob Dylans Essaysammlung "Die Philosophie des modernen Songs" (Zeit, Welt), Jarvis Cockers Autobiografie "Good Pop, Bad Pop" (FR) und das Album "Transporting Salt" des Spiritczualic Enhancement Centers (tazler Andreas Hartmann verspricht einen "bekifften Mix aus Jazz, Psychedelic und Krautrock").
Film

Komödienspezialist David O. Russell "fährt in seinem Film 'Amsterdam' ein imposantes Starensemble auf, um eine faschistische Verschwörung gegen Amerika zu vereiteln", schreibt Thekla Dannenberg im Perlentaucher. Es geht um einen Plan im Jahr 1933, als Industrielle Roosevelt stürzen wollten. "Der Film ist Hommage an Lubitsch, aber auch Agententhriller und Film-Noir-Parodie, mit ein wenig Dada, aber auch Harlem-Spirit. Lange hat sich Hollywood nicht mehr zu einer Komödie aufgerafft, die sich mit so viel Verve, Sarkasmus und Slapstick dem Ernst der Lage stellt. ... Doch die Schlagfertigkeit und die Komik der Screwball-Comedy hat er nicht. Auch nehmen die vielen Großaufnahmen seines Starensembles dem Film das Tempo. Der Witz liegt diesmal in seiner grundsätzlichen Cleverness, der Doppelbödigkeit und dem Anspielungsreichtum."
Für Bert Rebhandl von der FAZ "liegt gerade in dieser im Detail ungeheuer präzise choreografierten Unfertigkeit das Genie" des Films, für ihn "ein Beweis dafür, dass zwischen all den Superheldenfilmen und viel dramatischer Dutzendware immer noch genuine Begabungen im amerikanischen Kino existieren." So ist dieser Film "eine moderne Komödie, ein großartiges Spiel mit der Form, auch ein lustvolles Versagen vor der unlösbaren Aufgabe, den heutigen politischen Verhältnissen in Amerika gerecht zu werden. Ein Akt von Zivilcourage vielleicht sogar, dabei im Detail in jeder Sekunde unterhaltsam, und immer wieder richtig große Kunst." SZ-Kritikerin Susan Vahabzadeh hat viel Freude an diesem "Gesamtkunstwerk aus Klang und Esprit, wundersamen Bildern und Schauspielern in Höchstform". Und Zeit-Kritiker Daniel Moersener sah "ein Plädoyer für filmemacherischen Eigensinn und solidarische Politik in schwer durchschaubaren Zeiten".

Shirin Neshats "Land of Dreams" wandelt auf Luis Bunuels Spuren, schreibt Daniel Kothenschulte in der FR - was auch damit zu tun haben könnte, dass hier das letzte Drehbuch von Jean-Claude Carrière verfilmt wurde, der oft mit dem spanischen Surrealisten zusammenarbeitete: In einer dystopischen Variante der USA geht hier die iranischstämmige Simin auf von den Behörden gesteuerte Traumjagd: "Was für eine finster-poetische Idee ist diese Diktatur der Traumsammler. So gewaltlos die Behörde auch vorgeht, wenn sie ihre Außendienstmitarbeiterin an Wohnungstüren klopfen lässt, so radikal ist die Grenzüberschreitung. Vermutlich sind die Träume bald das Einzige, was digital organisierte Tyranneien wie etwa die Volksrepublik China nicht von ihren Untertanen kennen. Man muss nicht an das US-Pendant der russischen Oligarchen denken, an die milliardenschweren Informations-Monopolisten Bezos und Musk, um diese surreale Komödie bei aller Leichtigkeit bitter ernst zu nehmen." Die Filmemacherin hat sich am Ende vielleicht ein wenig überhoben, findet Perlentaucher Fabian Tietke. Dennoch: "Über weite Strecken ist "Land of Dreams" ein eindringlicher, bei allem Minimalismus bildgewaltiger Film."
Außerdem: Taz und Dlf Kultur sprechen mit Hans-Christian Schmid über dessen (in FR und FAZ besprochenen) Film "Wir sind dann wohl die Angehörigen" über die Reemtsma-Entführung. In der Welt fasst Hanns-Georg Rodek die Nachforschungen zum ersten Berlinale-Leiter, Alfred Bauer, zusammen, die nötig geworden waren, weil Bauers Rolle im Film des Nationalsozialismus nach Zeit-Recherchen auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden war: Unter anderem geht aus den Recherchen wohl hervor, dass Bauers Nazivergangenheit bis hinauf zu Willy Brandt wohl mehr oder weniger ein offenes Geheimnis gewesen sein dürfte - und 1953 und 1960 auch angesprochen wurde. Stefan Weiss fragt sich im Standard, ob der Netflix-Film "Athena" in Linz Halloween-Randale inspiriert habe und dazu im Vorfeld auf TikTok aufgerufen wurde.
Besprochen werden Oleg Senzows "Rhino" (Tsp, mehr dazu hier und dort), Quentin Tarantinos essayistisches Filmbuch "Cinema Speculation" (NZZ), Yvan Attals Gerichtsdrama "Menschliche Dinge" (Tsp), und die DVD-Ausgabe von Charline Bourgeois-Tacquets "Der Sommer mit Anais" (taz) und . Außerdem weiß die SZ, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.
Literatur
Sergej Gerassimow schreibt in der NZZ weiter Kriegstagebuch aus Charkiw. Besprochen werden unter anderem Asli Erdoğans "Requiem für eine verlorene Stadt" (Dlf Kultur), Dorothy B. Hughes' Krimi "Ein einsamer Ort" (Zeit), Manfred Theisens Jugendroman "Crossing The Lines" (Tsp), Chris Harding Thorntons Noir-Krimi "Pickard County" (TA), Jens Harders Sachbuch "Beta... civilizations" (Tsp), Daniel Wissers Erzählband "Die erfundene Frau" (online nachgereicht von der FAZ), Ian McEwans "Lektionen" (SZ) und Gary Shteyngarts "Landpartie" (FAZ).
Bühne

Im Interview mit dem Van Magazin erklärt der Dirigent Iván Fischer, warum er mit dem Regietheater an der Oper nicht viel anfangen kann und lieber selbst inszeniert: "Mich interessiert die Einheit von Musik und Theater, die total organische Einheit - eigentlich das, was auch das Ziel von Wagner oder Monteverdi war: dass Wort und Musik das gleiche ausdrücken. Ich finde die Konvention an den Opernhäusern, was da in den letzten 50 Jahren gemacht wurde und wird, eher schwierig. ... Diesen Betrieb mit einem Regisseur und einem Dirigenten an der Spitze finde ich total veraltet. Man verteilt die Rollen so, dass der Dirigent verantwortlich ist für die Partitur wie ein Hohepriester, der für die Bibel sorgt - und der Regisseur ist verantwortlich für die Erneuerung des Stoffes, damit das Publikum einen modernen Zugang hat." Das Resultat sei dann "in der Regel zwar visuell erneuernd, aber akustisch konservativ. Weg damit! Für mich ist das eine uninteressante Lösung." (Auch die FAZ hat Fischer heute interviewt.)
Den Hornisten und Dirigenten Sebastian Weigele, der in Frankfurt gerade die "Meistersinger" dirigiert, stört es dagegen nicht, wenn auf der Bühne ein anderes Kopfkino abläuft als im Orchestergraben, erklärt er im Interview mit der FR: "Für mich ist das Wichtigste, dass sich meine musikalische Interpretation mit den akustischen Gegebenheiten deckt. Wenn Inszenierung und Bühnenbild für mich stimmen, bin ich noch glücklicher. Ein kluger Regieeinfall kann mich ja auch musikalisch auf eine andere Idee bringen."
Nach Antisemitismusvorwürfen, die die Ruhrbarone ausgegraben hatten, wird die britische Dramaturgin Caryl Churchill jetzt doch nicht mit dem "Europäischen Dramatiker:innen Preis" ausgezeichnet, meldet Christine Dössel in der SZ. "Die Jury, die sich im April für die 84-Jährige als Preisträgerin entschieden hatte, habe nach erneuter Beratung beschlossen, 'ihre Entscheidung zurückzuziehen' und den Preis 'zu ihrem großen Bedauern' in diesem Jahr nicht zu verleihen. Der Grund: Die Jury habe inzwischen Kenntnis von Unterschriften der Autorin im Zusammenhang mit der Israel-Boykottbewegung BDS. Außerdem gebe es von Churchill das Stück 'Seven Jewish Children', das antisemitisch wirken könne - wie die Jury nun offenbar erst im Nachhinein herausgefunden hat. Das Mini-Stück (mit dem Untertitel 'A Play for Gaza') ist von 2009." Im Gespräch mit Dlf Kultur wundert sich der Theaterkritiker Christian Gampert: "Wenn man jemanden hervorgehoben für seine politische Haltung auszeichnet, dann sollte man diese Haltung auch kennen."
Weitere Artikel: In der taz berichtet Katja Kollmann vom "Festival der Dinge" in Berlin. In der nachtkritik resümiert Valeria Heintges den Streit um das Zürcher Schauspielhaus, das Zuschauer verliert, die offenbar das woke Programm nervt. Laut Heintges ist die Kritik aggressiv, gelegentlich sogar rassistisch. Sie hält den jetzigen Kurs für "alternativlos", gibt aber zu, dass das Angebot für das traditionelle Publikum erweitert werden könnte.
Besprochen werden Steffen Schleiermachers Choreografie "Siegfried - eine Bewegung" am Theater Braunschweig (nachtkritik) und das Musical "The Last Five Years" am Staatstheater Darmstadt (FR).
Kommentieren