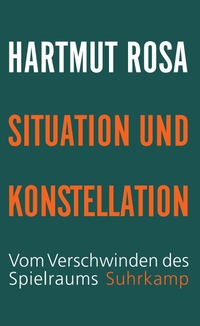Efeu - Die Kulturrundschau
Alle sind irgendwie cute und nice zueinander
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
17.02.2026. Groß war die Aufregung um Milo Raus "Prozess gegen Deutschland", bei dem auch Politiker aus dem rechtsextremen Spektrum zu gegen waren: Die FAZ findet die Veranstaltung wenig sinnvoll, auch die taz ist etwas ratlos. Die Filmkritiker trauern um zwei große alte Männer des Kinos: Robert Duvall und Frederick Wiseman. Die Kunstwelt muss sich von Henrike Naumann verabschieden, die als erste ostdeutsche Frau den Pavillon in Venedig bespielen sollte.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
17.02.2026
finden Sie hier
Bühne

Für Aufregung sorgte Milo Raus "Prozess gegen Deutschland" im Hamburger Thalia Theater schon im Vorhinein. Man ließ verschiedene Persönlichkeiten in den "Zeugenstand" treten und befragte "echte Juristen, Experten und politische Akteure", wie Anna Vollmer in der FAZ berichtet, um am Ende über ein AfD-Verbot abzustimmen. Weil Rau auch Politiker aus dem extrem rechten Spektrum eingeladen hatte, sagten einige Teilnehmer die Veranstaltung ab. Vollmer ist jedenfalls nicht ganz überzeugt von der Sinnhaftigkeit: "Weil das, was hier passiert, nicht geprobt oder abgesprochen ist und auch keine Faktenüberprüfung auf der Bühne stattfindet, werden nicht nur Argumente, sondern auch emotionale Reden und mitunter ziemlicher Unsinn ausgetauscht. Zu den Rednern, die sich vehement gegen ein Verbot der AfD aussprechen, gehört der Journalist Harald Martenstein. Mit seinem Auftritt will er bewusst provozieren, schießt aber selbst nach diesen Maßstäben über das Ziel hinaus: wenn er etwa suggeriert, auch ein Verbot der Union stünde im Raum." Martensteins Redebeitrag ist in der NZZ und in der Welt abgedruckt.
Zwiegespalten rekonstruiert auch Benno Schirrmeister in der taz die Veranstaltung: "Unproblematisch war sie zu keinem Zeitpunkt", meint der Kritiker, dem zum Beispiel die Einladung von Frauke Petry unverständlich ist. "Seltsam inquisitorisch" wurde es manchmal auch, zum Beispiel als der konservative Historiker Andreas Rödder befragt wurde: "Denn Rödder hatte ja zuvor einerseits erklärt, dass ein AfD-Verbot unvermeidlich wäre, sollte der Nachweis gelingen, dass die Partei offensiv verfassungsfeindlich ist. 'Dann gehört sie verboten', so der Professor. Anders, als beim seinerzeitigen KPD-Verbot hätte man Rödder zufolge in diesem Falle aber mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu rechnen (...) Hier weiterzubohren, hätte ergiebig sein können. Aber diese Hakeleien und vergebenen Chancen sind politisch aussagekräftig und markieren Höhepunkte. Die künstliche Situation der Zeugeneinvernahme ermöglicht andere, gleichsam unhöflichere, aber dafür mitunter ergiebigere direkte Kommunikation: Das ist der Vorzug eines solchen Projekts. Das war allerdings ausgerechnet durch Dramaturgiefehler sowohl am Eröffnungsabend als auch am Samstagnachmittag mehrfach an den Rand des Scheiterns gebracht worden." Rau hat hier vor allem sein Talent für "schrille Shows" gezeigt, meint Peter Laudenbach in der SZ: "So viele grelle Figuren hat nicht einmal Christoph Schlingensief auf der Bühne versammelt." Auch Axel Brüggemann ist in Backstage Classical wenig begeistert.
Weitere Artikel: Claus Leggewie resümiert in der FR die Brecht-Tage in Berlin. Tom Mustroph freut sich in der taz über die Festivalreihe "Puppen-Spezial" am Deutschen Theater Berlin. Besprochen werden Evgeny Titovs Inszenierung von Alban Bergs Oper "Wozzek" an der Oper Graz (FAZ), Andrea Schwalbachs Inszenierung von Francis Poulencs Oper "Dialogues des Carmélites" am Staatstheater Karlsruhe (FR) und Fabian Hinrichs Ein-Mann-Stück "Irgendetwas ist passiert" an der Volksbühne Berlin (FAZ).
Kunst
Die Künstlerin Henrike Naumann ist im Alter von 41 Jahren an ihrer Krebserkrankung gestorben. Als erste ostdeutsche Künstlerin sollte sie den Pavillon der Biennale in Venedig bespielen. In der taz erinnert Hilka Dirks an Naumann und ihr Werk: "Die Auseinandersetzung mit faschisierten und kapitalistischen Ästhetiken, mit neonazistischen und anderen Jugend- und Subkulturen, sie durchzieht das Werk Naumanns seit Beginn ihrer künstlerischen Karriere ebenso wie die Sezierung des Konsums, von Status, Klasse und Milieu. So kombinierte sie in ihrer Ausstellung 'Innenleben' 2019 am Münchner Haus der Kunst postmoderne West-Möbel der Nachwende-90er mit dem wuchtigen Historismus nationalsozialistischer Inneneinrichtung. Der Geist, der in den Räumen dieser Gegenüberstellung spukte, war ein sehr deutscher, ein allzu bekannter, zumindest für die Menschen, die inmitten solcher Objekte aufwuchsen, und ein ständiger Begleiter von Naumanns Werken: vom Wandtattoo in gebrochener Fraktur über Videoinstallationen aus gesammelten Archivmaterial sozialer Medien bis zum plüschig-wuchtigen Sofa in pastelligem Graffitimuster."
"Naumann hatte früh gesehen, dass die deutschen Obsessionen mit Raum und Ordnung am Ende nirgendwo anders als in der Schrankwand ihren häuslichen, sozusagen pantoffeltragenden Ausdruck finden", schreibt Peter Richter in der SZ. In der Ausstellung "Wohnkomplex - Kunst und Leben im Plattenbau" im Minsk in Potsdam war noch bis vor Kurzem Naumanns "epochale Diplomarbeit zu sehen: Die Installation 'Triangular Stories' zeigt zwei dreieckige Ausschnitte aus ostdeutschen Nachwendewohnungen, eine davon komplett mit den mutig gemusterten Discountermöbeln der frühen Neunziger, mit Videorekorder, CD-Regal - und Reichskriegsfahne an der Raufasertapete. Diese Installation hatte Naumann schlagartig berühmt gemacht, weil sie mit diesem lakonischen Hyperrealismus etwas zusammenfasste, wofür andere dicke Bücher über die heute sogenannten Baseballschlägerjahre brauchten."
"Naumann hatte früh gesehen, dass die deutschen Obsessionen mit Raum und Ordnung am Ende nirgendwo anders als in der Schrankwand ihren häuslichen, sozusagen pantoffeltragenden Ausdruck finden", schreibt Peter Richter in der SZ. In der Ausstellung "Wohnkomplex - Kunst und Leben im Plattenbau" im Minsk in Potsdam war noch bis vor Kurzem Naumanns "epochale Diplomarbeit zu sehen: Die Installation 'Triangular Stories' zeigt zwei dreieckige Ausschnitte aus ostdeutschen Nachwendewohnungen, eine davon komplett mit den mutig gemusterten Discountermöbeln der frühen Neunziger, mit Videorekorder, CD-Regal - und Reichskriegsfahne an der Raufasertapete. Diese Installation hatte Naumann schlagartig berühmt gemacht, weil sie mit diesem lakonischen Hyperrealismus etwas zusammenfasste, wofür andere dicke Bücher über die heute sogenannten Baseballschlägerjahre brauchten."
Film

In Sight & Sound kommt Philip Concannon auf eines der Geheimnisse zu sprechen, die Wisemans teils raumgreifend überlangen Filme so faszinierend machen: Er "verbrachte Monate damit, einsam am Schnitt zu arbeiten. ... Wiseman konstruierte jede Sequenz zunächst eigenständig für sich und machte sich erst danach darüber Gedanken, wo sie im größeren Zusammenhang passt. Daraus folgt, dass es bemerkenswert wenige Momente in seinen Filmen gibt, die sich belanglos anfühlen. Auch als seine Filme immer länger wurden, ... zogen sich seine Filme selten in die Länge, da jede Sequenz mit ihren eigenen Verdiensten sowohl für sich steht, als auch dem Ganzen dient und die Themen des Films herausarbeitet. Trotz der langen Laufzeiten verlieh Wisemans Montage den Filmen einen Rhythmus mit sogartiger Wirkung."
Und Duvall? Er "machte Schluss mit der übertriebenen Pantomimerei des frühen Hollywood, mit der Tradition des Deklamierens und Grimassierens", schreibt David Steinitz in der SZ. "Er brachte einen harten, rauen Naturalismus auf die Leinwand." Was sich sehr gut in dem oben eingefügten Video nachvollziehen lässt. Er "arbeitete mit Hingabe, er war pragmatisch und durch und durch Profi", schreibt Marion Löhndorf in der NZZ, "und er war cool, einer der coolsten von allen. ... Fürs Heldenfach war seine Ausstrahlung zu ambivalent, zu unergründlich. Liebhaberrollen standen die tiefliegenden Augen im Weg, der kantige Schädel und die Mundwinkel, die sich auch beim Lachen nach unten verzogen. Der ewige Nebendarsteller, das war eine schöne Volte des Lebens, erhielt seinen einzigen Oscar für eine Hauptrolle, in Bruce Beresfords Film 'Tender Mercies' (1983).""Hey, Boo."
- The Sting (@TheStingisBack) February 16, 2026
Robert Duvall came out swinging and never quit. His big-screen debut was in a stone-cold classic. This one hits a little harder tonight. pic.twitter.com/AnrSAfkgcs

Schnitt zur Berlinale: Vom Wettbewerb hört man heute wenig in den Feuilletons, Zeit für einen Blick in die Nebenreihen. Ulrike Ottingers "Die Blutgräfin" markiert die Rückkehr der Autorenfilmerin in den fiktionalen Film nach sehr vielen Jahren, und inszeniert Isabelle Huppert in der Rolle der Elisabeth Báthory, der nachgesagt wird, zur Verjüngung in Menschenblut gebadet zu haben. Als Vampirin schleicht sie nun durch Wien, aber warm geworden ist Andreas Kilb (FAZ) damit nicht: Huppert "tut darin etwas, was ihren Rollen im Kino ganz fremd ist: Sie chargiert. Sie bleckt die Zähne, sie zieht eine Schnute, sie wedelt mit den Armen, sie poltert, hechelt, schnurrt und brüllt. ... Ottinger will ihren zweistündigen Kino-Klamauk in kostbaren Posen und Kostümen als Satire auf den Spätkapitalismus verstanden wissen", doch bis diese Fahrt aufnimmt, "hat der Film sich schon über sich selbst kaputtgelacht." Den Dialogen von Elfriede Jelinek zum Trotz: "Der Biss in den Hals der Zeitgenossen, von dem Ulrike Ottinger spricht, kommt so nicht zustande. Man hört nur ein paar Kino-Gebisse klappern." Valerie Dirk vom Standard hingegen hatte einen "Heidenspaß".
Auf critic.de ärgert sich Thomas Groh derweil, dass das Festival in diesem Jahr im laufenden Festivalbetrieb keinerlei Pressevorführungen für die Filme aus dem Forum anbietet - was zur Folge hat, dass um die wenigen Presseplätze in den öffentlichen Vorführungen ein "einziges Hauen und Stechen" stattfindet. Resultat: "Das Forum und die Filmkritik finden in diesem Festival kaum zueinander." Doch gerade "die Filme im Forum brauchen all das: den Kinosaal, den leichten Zugang, den Austausch danach, die publizistische Öffentlichkeit."

Lukas Stern von critic.de hat es immerhin zu Ted Fendts "Auslandsreise" im Forum geschafft. Der Film erzählt eine Miniatur von Freunden in Berlin-Kreuzberg, die gerne lesen, übers Gelesene reden und sich durch Parks treiben lassen. Gedreht ist das alles auf analogem Filmmaterial. "Das Berlin-Bild, das Fendt in seinen 16mm-Bildern einfängt, ist eines der schönsten der letzten Jahre. 'Auslandsreise' spielt ausschließlich auf den wenigen Quadratmetern zwischen Chamissoplatz, Mehringdamm und Gneisenaustraße in Kreuzberg. ... Das Bild glimmt förmlich vom Sommerlicht, das sich ihm einschreibt. Eine nostalgische Fantasie. Kein Sommernachmittag, möchte man sagen, könnte sich je vergangener anfühlen als ein derart auf 16mm gravierter." Die Stadt hier "so etwas wie ein nichts einfordernder Zufluchtsort für Ortlose", schreibt Kamil Moll im Filmdienst.
In seinem Resümee des gestrigen Festivaltages ist Pavao Vlajcic auf critic.de völlig fassungslos darüber, was im Panorama mit Faraz Shariats Polit-Thriller "Staatsschutz" geboten wird. Der Film ist "ein Albtraum aus dem es kein Entkommen gibt", doch "statt das Staatsversagen der deutschen Justiz unter Beweis zu stellen, demonstriert der Film höchst überzeugend die künstlerische Bankrotterklärung der deutschen Filmförderpolitik. Wie sich das gehört, packt die Erzählung alles an heißen Eisen in seinen Einheitsbrei, was nicht bei drei auf den Bäumen ist: Eine angehende deutsche Staatsanwältin mit koreanischen Wurzeln wird Opfer eines rechtsextremen Anschlags und sieht sich danach mit den Mühlen der deutschen Justiz konfrontiert. Überforderte Darsteller und ein hochnotpeinliches Drehbuch ergeben hier einen Film, der sich als Lehrstück inszeniert, aber nur selbstgerecht durch die Gegend torkelt ohne je ein Gefühl für Situationen, Charaktere oder elementares Handwerk zu entwickeln. ... Als ernsthafter Diskussionsbeitrag entbehrt er jeglicher fundierten Grundlage, ist im Grunde ein filmgewordener FCKAFD-Sticker: bequem, selbstgefällig und nichtssagend."
Weiteres: "Der Wettbewerb macht bislang einen recht großzügigen Bogen um die heißen Eisen der Gegenwart", stellt Thomas Hummitzsch auf Intellectures zur Halbzeit der Berlinale fest: Das Festival zeigt vor allem Familiendramen. Jörg Gerle resümiert im Filmdienst die ersten Festivaltage. Tobias Sedlmaier blickt für die NZZ auf die öde Kontroverse um Wim Wenders' ungeschickte Formulierungen bei der Berlinale-Pressekonferenz, die von begierigen Social-Media-Protagonisten zum Skandal hochgejazzt werden soll.
Aus den übrigen Sektionen besprochen werden Juan Pablo Sallatos "Hangar rojo" über den Militärputsch in Chile (taz), Sofía Bordenaves Dokumentarfilm "Forest Up in the Mountain" (taz), der vom nigerianischen Kollektiv "The Critics" erstellte Dokumentarfilm "Crocodile" über die Science-Fiction-Szene Nigerias (critic.de), Aidan Zamiris Mockumentary "The Moment" mit Popstar Charli XCX (taz) und Anna Rollers Verfilmung von Leif Randts Roman "Allegro Pastell" ("Alle sind irgendwie cute und nice zueinander", schreibt Andreas Fanizadeh in der taz, SZ).
Schnelle Updates vom Festival gibt es bei Artechock, in den Berlinale-Audios vom Deutschlandradio, in den SMS-Nachrichten von Cargo und beim Kritikerspiegel von critic.de.
Literatur
Besprochen werden Gisèle Pelicots Memoir "Eine Hymne an das Leben" (FR, NZZ, Standard), Norbert Gstreins "Im ersten Licht" (FR), Manfred Pfisters "Englische Renaissance" (Intellectures) und Kristof Magnussons "Die Reise ans Ende der Geschichte" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau um 14 Uhr.
Architektur
Auch Rico Bandle schüttelt in der NZZ den Kopf über das Finale zum Preis des Deutschen Architekturmuseums (unser Resümee). Ästhetisch ist was anderes, meint er: "Die Vorliebe für eine unterkühlte Bauweise und die Verachtung für alles Dekorative und Bunte werden den heutigen Architekten schon im Studium eingetrichtert. Eine Untersuchung von 2011 legt dar, wie sich die Beurteilung von verschiedenen Gebäuden bei Studenten im Laufe des Studiums ändert. Zu Beginn entspricht deren Urteil noch mehr oder weniger dem Durchschnitt der Bevölkerung: Eintönige, schachtelartige Gebäude werden negativ bewertet, verspielte Entwürfe positiv. Am Ende ist es umgekehrt. Am deutlichsten zeigt sich die Diskrepanz beim Sichtbeton. Architekten beschreiben die unbehandelten grauen Wände als 'authentisch', sie loben das 'Skulpturale' und die 'schöne Patina' bei der Alterung. Laien sehen dies komplett anders: Sie empfinden Sichtbeton als 'kalt', 'monoton', die Alterung führt aus ihrer Sicht zu 'hässlichen Mustern'."
Musik
"Er war kein Antisemit" und auch "kein Gesinnungsnazi", sagt Michael Wolffsohn im SZ-Gespräch mit Helmut Mauró über Herbert von Karajan, über den der Historiker gerade eine Biografie veröffentlicht hat (hier unser Resümee eines früheren Gesprächs). Reinhard J. Brembeck reist für die SZ nach Venedig und nach Codroipo, um das Werden der neuen Orgel für die Markuskirche nachzuvollziehen. Clemens Haustein resümiert in der FAZ den Auftakt des Festivals "Vom Anfangen" im Konzerthaus Berlin. Gregor Dotzauer gratuliert im Tagesspiegel dem Komponisten György Kurtág zum hundertsten Geburtstag.
Kommentieren