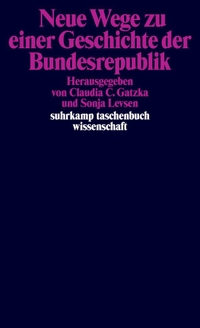Efeu - Die Kulturrundschau
Orgien verletzter Gefühle
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
24.08.2024. Die Filmkritiker streiten über die Überlegung, Mohammad Rasoulofs "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" als deutschen Beitrag zu den Oscars zu schicken: Mehr als eine politische Geste, jubelt die FR, diese "Schummel-Nominierung" zeigt die Schwäche des deutschen Films, wütet die Welt. Der Tagesspiegel schaut sich zeitgenössische mongolische Kunst im oberfränkischen Mürsbach an. Die FAS erinnert sich in einer Ausstellung in Bordeaux, wie Disney die Franzosen in Retortenstädten zu Frankreich-Darstellern machte. Die SZ ist peinlich berührt, wenn Bestsellerautorin Carolin Wahl darüber klagt, dass sie nicht auf der Longlist steht.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
24.08.2024
finden Sie hier
Film

"Die Saat des Heiligen Feigenbaums" des erst vor kurzem unter denkbar schweren Bedingungen aus dem Iran nach Deutschland geflohenen Filmemachers Mohammad Rasoulof zieht als deutscher Nominierungsvorschlag der Exportunion German Films ins Oscar-Rennen. In Cannes, wo der Film im Mai einige Preise gewann, galt er noch als iranischer Film - kein Wunder: Cast und Crew sind iranisch, der Drehort war Teheran. Aber produziert wurde der Film mehrheitlich mit Mitteln aus Deutschland. "Ausgesprochen positiv" findet FR-Kritiker Daniel Kothenschulte diese Entscheidung. Es "ist mehr als eine politische Geste. Bessere Filme sind auch weltweit schwer zu finden. So sollte diesem herausragenden Werk eine Nominierung sicher sein. ... Um das von Rasoulof und seinem todesmutigen Team gedrehte Meisterwerk kommt auch in Hollywood niemand herum. Es ist eine Studie über die fließenden Grenzen zwischen Mitläufer- und Verbrechertum in einer Diktatur." Aber "wie genau soll dieser Film deutsches Filmschaffen, deutsche Kreativität und Befindlichkeiten bei den Oscars repräsentieren", fragt sich ein schon deutlich skeptischerer Tobias Kniebe in der SZ. "Überhaupt nicht, lautet die einzig ehrliche Antwort. Er repräsentiert die Offenheit der deutschen Gesellschaft und ihrer Fördersysteme für Künstler, die in ihrer Heimat verfolgt werden, steht für die Attraktivität eines freien Landes als Wohnsitz und wirtschaftliche Operationsbasis für Filmemacher, die früher oder später ins Exil gezwungen werden."
Welt-Kritiker Hanns-Georg Rodek hingegen zürnt. Zwar hält er den "Feigenbaum" ebenfalls für einen "der besten Filme des Jahres", aber ein deutscher Film ist er seiner Ansicht nach nicht. Die Entscheidung des Auswahlgremiums sei reines Kalkül und schielt einfach auf den großen Preis. "Das Auswahlkomitee könnte auch einen mongolischen oder nicaraguanischen Film für Deutschland ins Rennen schicken - vorausgesetzt, in der Finanzierung steckte deutsches Geld (und deutsches Fördergeld steckt weltweit in sehr vielen Koproduktionen). Damit würde natürlich die Absicht der Oscar-Akademie, die eine Bühne für nationale Kinematografien schaffen möchte, in ihr Gegenteil verkehrt. Jedes Jahr schicken fast 100 Länder ihre besten Filme zu den Oscars; ihre eigenen besten, um präzise zu sein, nicht durch kulturelle Aneignung eingemeindete. Die regelkonforme Schummel-Nominierung von 'Die Saat des heiligen Feigenbaums' ist kein Zeichen für die Stärke des deutschen Kinos, sondern für seine Schwäche. German Films sollte seine Regeln überdenken."

Karsten Munt konturiert in einem Filmdienst-Essay die Leinwandpersona von Kevin Costner, dessen aktueller Film "Horizon" (unsere Kritik) gerade bei uns angelaufen ist. Sein Schauspiel "war schon immer ganz auf das Charisma gebaut. ... Nicht 'Method' ist sein Schauspiel, sondern die Präsenz. Costner trägt sie in jedes der großen amerikanischen Genres, die ihm allesamt gut stehen. Er trägt die Erkennungsmarke genauso gut, wie er den Baseball-Schläger schwingt oder die Zügel hält. Als amerikanischer Archetyp gehört Costner, der 1955 geboren wurde, eigentlich der falschen Generation an. Vielleicht ist er auch deswegen seit jeher ein Schauspieler, dem man schon immer gerne beim Altern zusehen wollte. Costner hat sich über die Jahre nicht nur den unbändigen Wunsch erhalten, der integre Mann zu sein, der sich mit zunehmender Zeit hinter stoischerer Miene und immer rauer geschliffener Stimme versteckt; er hat auch das in seiner frühen Karriere so omnipräsente jungenhafte Lachen nicht verloren - man muss nur genauer hinsehen. Retrospektiv scheint es, als sei Costner in exakt die Figur hineingealtert, die er schon früh mühelos zu spielen wusste."
Weiteres: Benjamin Moldenhauer arbeitet sich für Filmfilter durch die Geschichte des schwarzen Horrorkinos. Fabian Tietke verschafft in der taz einen Überblick über die deutschen Filmfestivals der nächsten Monate. Hanns-Georg Rodek erinnert in der Welt daran, wie Leni Riefenstahls "Olympia" 1938 bei den Filmfestspielen in Venedig nach erhitzten Debatten und dem Rücktritt zweier Jurymitglieder den Hauptpreis für einen ausländischen Preis gewann - obwohl dies für Dokumentarfilme eigentlich nicht vorgesehen war: "Der wohl eklatanteste Fall von politischer Einmischung in der langen Geschichte von Filmfestivals." Elmar Krekeler verbringt für die WamS einen Tag mit der Schauspielerin Rosalie Thomass. Besprochen wird die Netflix-Serie "The Union" (FAZ).
Kunst

Das Konzept "Blickpunkte" des früheren Essl-Museums in Klosterneuburg, das seit einem halben Jahr unter dem Albertina-Label wieder geöffnet hat, geht auf, freut sich Standard-Kritiker Stefan Weiss. Die Hälfte der Exponate der Sammlung wird in regelmäßigen Abständen ausgetauscht: "Herausragend in der aufgefrischten Ausstellung, die sich ausschließlich mit Kunst nach 1945 bis in die jüngere Gegenwart beschäftigt, ist ein großformatiges Werk von Sasha Okun. In Gates of Justice zeigt der israelische Maler drastisch Menschen im Verfall, die auf Körperstellen zeigen, an denen ihnen offensichtlich unwohl ist. Ein Arzt wendet resigniert den Blick ab, er kann nichts mehr tun, eine Schwangere steht madonnenhaft als Memento mori daneben. Okun, selbst schwer krank und dem Tode nahe, hat damit sein wahrscheinlich letztes Bild geschaffen."
So einen Überblick bekommt man selten: Für den Tagesspiegel besucht Christiane Meixner TheGallery im oberfränkischen Mürsbach, wo der Berliner Künstler und Kurator Thomas Eller aktuell zeitgenössische mongolische Kunst zeigt: "Die Themen der mongolischen Kunstschaffenden - Naturerfahrung wie -zerstörung, Spiritualität und Genderfragen - schreiben die hiesigen Belange fort. Bloß aus anderen Perspektiven. Manche Arbeiten wie Bolds 'Gasmasken', die Bezug auf die mongolische Metropole Ulaanbaatar und deren unerträgliche Luftqualität nimmt, leuchten einem sofort ein. Das überbordende Motiv des Totenschädels zur dekorativen malerischen Gestaltung, den Nomin Bold ebenfalls pflegt, verlangt hingegen nach Erklärung. Am ehesten fühlt man sich an den Totenkult Mexikos erinnert, doch der im Schamanismus wurzelnde Tengrismus ist so tief in der mongolischen Kultur verwurzelt, dass die Symbole eine andere Bedeutung haben."
Gerade ist im Düsseldorfer K20 die Ausstellung "Träume von der Zukunft" zu Ende gegangen, die Werke von Hilma af Klint und Wassily Kandinsky gegenüberstellte - Anlass für die Kunsthistorikerin Astrid Mania in einem Gastbeitrag in der SZ den Spiritismus zu feiern, der in der westlichen Kunstgeschichte lange geschmäht wurde. Zwei Aspekte betont Mania, die dem Spirituellen in der Kunst zu verdanken seien: Zum einen werde das "säkular-westliche" Kunstverständnis auch für Kunst aus dem Globalen Süden geöffnet, zum anderen weist Mania auf den feministischen Aspekt spiritueller Kunst hin: "Der Kontakt mit überweltlichen Instanzen bot sicherlich auch vielen Frauen ein Ventil, sich künstlerisch auszudrücken: Schließlich wurde ihre Hand - so glaubten oder wollten sie glauben machen - von anderen geführt. Damit konnten sie ganz dem Klischee entsprechen, wonach Frauen zu eigener Schöpferkraft nicht fähig seien."
Weitere Artikel: Jana Janika Bach freut sich in der taz, dass mit Ausstellungen von Miriam Cahn, Alison Knowles und Carol Rama die Dominanz der Männer im Kunstbetrieb aufgemischt wird. In der Berliner Zeitung betrachtet Ingeborg Ruthe die "Goldelse", die die Künstlerin Alicja Kwade der Neuen Nationalgalerie geschenkt hat und die ohne Flügel und Machtsymbole geradezu "menschlich" wirkt. Auf den Bilder und Zeiten-Seiten der FAZ würdigt Friedrich Dieckmann die Künstlerin Hannelore Teutsch, die Berlin-Veduten stickt.
Besprochen werden die Ausstellung "Von Wolken und anderen Lügen" in der Berliner Galerie Eigen + Art (Tsp), die Installation "Walking with Kant", die Peter Greenaway und Saskia Boddeke in der Orangerie des Neuen Gartens in Potsdam zu Kants 300. Geburtstag gestaltet haben (Tsp), die Gustav Metzger-Retrospektive im Frankfurter Museum für moderne Kunst im MMK-Tower (FAZ), die Ausstellung "Caspar David Friedrich. Wo alles begann" im Albertinum Dresden (FAZ) und Holm Friebes Kunstaktion "Works on Skin", für die man von Künstlern entworfene Motive kaufen und sich tätowieren lassen kann (FAS, Tagesspiegel).
Design
Julia Werner trauert in der SZ den "glorreichen Zeiten" der Modefotografie nach, "in denen Steven Meisel in der italienischen Vogue ein paar teure Kleider samt Model kunstvoll in einer Ölpest versenkte. Oder Linda Evangelista als irre gewordenes, Prada-tragendes Chirurgie-Opfer im Rollstuhl durch eine Klinik rollen ließ." Heute hingegen "herrscht Zeitdruck, es mangelt an Budget und einer gewissen Lustlosigkeit am Geschichtenerzählen, und deswegen sind wir in der Tat an einem Punkt, an dem Modefotografie so austauschbar und handwerklich so mittelmäßig geworden ist, dass man es wirklich auch gleich einen Computer machen lassen kann." Weshalb genau das auch schon geschieht: "Die Mode ist echt und wird vorab fotografiert, und dann trainiert man eine KI, sie einem digitalen Model anzuziehen. Jetzt also steht ein wunderschönes Mädchen mit hohen Wangenknochen, schmaler Nase und natürlich gewelltem Haar, außerdem mageren, also täuschend echten Modelmaßen, traurig in der Gegend rum." Das "ist stinklangweilig, und genau deswegen kaum von der Wirklichkeit zu unterscheiden."
Außerdem: Ein namentlich nicht genannter "Experte für Männermode" unterzieht in der taz das führende Personal der AfD einer vernichtenden Stilkritik. Peter-Philipp Schmitt porträtiert für "Bilder und Zeiten" der FAZ den Möbelgestalter Philipp Mainzer, der in den Neunzigern mit seiner Firma e15 die damals schwer verpönten und daher überall rausgerissenen Eichenbrettern rettete und daraus seinen Designklassiker, den bis heute produzierten Tisch "Bigfoot", produzierte.
Außerdem: Ein namentlich nicht genannter "Experte für Männermode" unterzieht in der taz das führende Personal der AfD einer vernichtenden Stilkritik. Peter-Philipp Schmitt porträtiert für "Bilder und Zeiten" der FAZ den Möbelgestalter Philipp Mainzer, der in den Neunzigern mit seiner Firma e15 die damals schwer verpönten und daher überall rausgerissenen Eichenbrettern rettete und daraus seinen Designklassiker, den bis heute produzierten Tisch "Bigfoot", produzierte.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Bühne

In der FAZ ist Wiebke Hüster wütend: Die "Funktionalisierung und Bagatellisierung" der Kunst sieht sie besonders im Programmheft der diesjährigen Ausgabe des Berliner Festivals Tanz im August, das ihr Kunst mit "Versteh-Anleitung" zeigt - Stücke die aller Voraussicht nach nicht mehr als zwei Spielzeiten gezeigt werden: "Gewalt, Migration und die 'lebensfeindliche Logik des Kapitalismus' meint man in Berlin zu tanzen, auf dem Skateboard und ohne. (…) Im Prinzip kann man nur zugestehen, dass es einer Berliner Kulturverwaltung und den anderen Subventionsquellen des Festivals reicht, wie es läuft. Dass sie es einfach gut finden, wenn 75 Minuten lang Michelle Mouras vier Frauen mit gebeugten Knien auf der Spielfläche zwischen vier kleinen, nicht voll besetzten Tribünen umherschreiten." Gnädiger urteilen Nachtkritiker Falk Schreiber und Tagesspiegel-Kritikerin Sandra Luzina über die jüngst gezeigten Stücke "Steal you for a moment" von und mit Francisco Camacho und Meg Stuart (trocken und theoretisch, aber auch mit "Witz und Verspieltheit", so Schreiber) und "Non human dances" von Jérôme Bel und Estelle Zhong Mengual (eher eine "Lecture Perfomance", so Luzina).
Am 28. August bekommt Carmen Romero, Gründerin des chilenischen Theaterfestivals "Teatro a Mil" die Goethe-Medaille in Weimar verliehen. Im taz-Gespräch gibt sie Einblicke in die chilenische Theaterszene, die sich aktuell vor allem der Erinnerung widme, und erklärt, was das Besondere an "Teatro a Mil" ist, das als wichtigstes Theaterfestival Lateinamerikas gilt: "Für mich hält das Festival den Geist jener Jahre lebendig, in denen wir die Demokratie zurückerobert haben. Es ist der Versuch, den öffentlichen Raum zu besetzen und den Zugang zu Kunst und Kultur zu öffnen. Auch deswegen findet sehr viel unserer Arbeit auf der Straße statt."
Im Tagesspiegel resümiert Rüdiger Schaper die ersten Tage des Kunstfests Weimar, das unter dem Motto "Wofür wir kämpfen" steht. Die Buchenwald-Gedächtnis-Rede wurde von dem Historiker Norbert Frei gehalten, der sich nicht nur darum sorgte, dass in vielen ländlichen Regionen keine Zeitungen mehr zugestellt werden. Frei sorgt sich insgesamt um die "'Zukunft der Erinnerung": "Er hält den Begriff der Erinnerungskultur für problematisch - es könne zu rituell, zu selbstzufrieden wirken. Es gelinge uns auch recht gut, aus der Realität zu flüchten, der Westen habe den 'Rücksturz in die Vergangenheit' des Kalten Kriegs und der neuen Diktaturen verschlafen. Was nottue: Kämpfen für eine 'aufgeklärte bürgerliche Öffentlichkeit'."
Weitere Artikel: In der taz wirft René Hamann einen Blick auf die kommende Theatersaison. Besprochen wird außerdem Amala Dianors Stück "DUB" bei Tanz im August (nachtkritik).
Literatur
Dass die Bestseller-Autorin Caroline Wahl auf Instagram über ihre Wut und ihren Schmerz schreibt, dass sie es nicht auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat, hält Bernhard Heckler in der SZ nicht nur für "peinlich" (wenngleich auch für "menschlich und nahbar"), sondern vor allem für einen Tabubruch im Literaturbetrieb. Wahl "gewährt uns einen Blick in den Maschinenraum eines Betriebs, der vor lauter gekränkten Eitelkeiten kaum noch laufen kann, das aber selbst niemals zugeben würde."
Weitere Artikel: Judith von Sternburg spricht für die FR mit dem Schriftsteller Ingo Schulze über 75 Jahre Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Der Schriftsteller Klaus Modick schreibt in "Bilder und Zeiten" der FAZ über seine Erfahrungen als Tutor bei Literatur-Workshops für junge Menschen, bei denen er zwar stets viel zu mäkeln hatte, doch "sprach aus all diesen Hervorbringungen" auch "allemal Begeisterung fürs Spiel mit der Sprache". Andreas Kilcher beugt sich für das "Literarische Leben" der FAZ über erst kürzlich aufgetauchte Briefe Walter Benjamins an den Schweizer Literaturwissenschaftler Jonas Fränkel aus dem Jahr 1928. Christian Thomas fügt in der FR Stefan Wolles "Wladimir der Heilige" seiner Ukraine-Bibliothek hinzu. Der Comiczeichner Alfred gibt im Tagesspiegel-Fragebogen über sich Auskunft. In "Bilder und Zeiten" fragt sich Martin Kämpchen, warum er im großen Kafka-Jahr eigentlich nichts von Kafka gelesen hat.
Besprochen werden der Band "Senza casa" mit bisher unbekannten Aufzeichnungen Ingeborg Bachmanns (taz), Jessica Linds "Kleine Monster" (Standard), Silja Behres Kishon-Biografie (online nachgereicht von der FAZ), Sara Paretskys Krimi "Entsorgt" (FR), Barbara Thériaults "Abenteuer einer linkshändigen Friseurin" (Freitag), Clemens Meyers "Die Projektoren" (WamS), Eva Maria Leuenbergers Gedichtband "Die Spinne" (FAZ) und Ruth-Maria Thomas' Debütroman "Die schönste Version" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Weitere Artikel: Judith von Sternburg spricht für die FR mit dem Schriftsteller Ingo Schulze über 75 Jahre Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Der Schriftsteller Klaus Modick schreibt in "Bilder und Zeiten" der FAZ über seine Erfahrungen als Tutor bei Literatur-Workshops für junge Menschen, bei denen er zwar stets viel zu mäkeln hatte, doch "sprach aus all diesen Hervorbringungen" auch "allemal Begeisterung fürs Spiel mit der Sprache". Andreas Kilcher beugt sich für das "Literarische Leben" der FAZ über erst kürzlich aufgetauchte Briefe Walter Benjamins an den Schweizer Literaturwissenschaftler Jonas Fränkel aus dem Jahr 1928. Christian Thomas fügt in der FR Stefan Wolles "Wladimir der Heilige" seiner Ukraine-Bibliothek hinzu. Der Comiczeichner Alfred gibt im Tagesspiegel-Fragebogen über sich Auskunft. In "Bilder und Zeiten" fragt sich Martin Kämpchen, warum er im großen Kafka-Jahr eigentlich nichts von Kafka gelesen hat.
Besprochen werden der Band "Senza casa" mit bisher unbekannten Aufzeichnungen Ingeborg Bachmanns (taz), Jessica Linds "Kleine Monster" (Standard), Silja Behres Kishon-Biografie (online nachgereicht von der FAZ), Sara Paretskys Krimi "Entsorgt" (FR), Barbara Thériaults "Abenteuer einer linkshändigen Friseurin" (Freitag), Clemens Meyers "Die Projektoren" (WamS), Eva Maria Leuenbergers Gedichtband "Die Spinne" (FAZ) und Ruth-Maria Thomas' Debütroman "Die schönste Version" (SZ). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.
Musik
Im aktuellen Bayreuther Jahrgang schwingen erstmals mehr Frauen als Männer den Taktstock - und das noch nicht einmal als geplante Zäsur, sondern im Grunde eigentlich schon zufällig. Damit ist nun endgültig klar, schreibt Christian Wildhagen in der NZZ, dass "die letzte verbliebene Männerbastion in der Kulturwelt" bereits ansehnlich geschliffen ist: das Dirigentenpult. "In der Praxis verändert sich der Musikbetrieb dadurch so stark wie seit dem Siegeszug der historischen Aufführungspraxis ab den 1950er Jahren nicht mehr. Aber außer ein paar letzten chauvinistischen Sottisen hört man, anders als früher, dagegen kaum mehr grundsätzliche Einwände. "Charakteristisch für die zunehmende Normalisierung ist auch, dass jüngere Dirigentinnen eine Karriere dezidiert aus eigener Kraft schaffen wollen. Die Ablehnung geschlechtsspezifischer Förderung gehört dabei ebenso zum guten Ton wie die demonstrative Absage an weibliche Seilschaften. Es dürfte sie trotzdem inzwischen geben, aber im Gegensatz zu den ohne Scheu zelebrierten Mentoren- und Lehrer-Schüler-Verhältnissen unter Dirigenten, bei denen die Berufung auf große Vorbilder oft als Qualitätsausweis dient, wird nicht offen darüber geredet."
Weitere Artikel: Für die taz porträtiert Julian Weber den Berliner Club-Unternehmer Dimitri Hegemann. Peter Kemper berichtet in der FAZ von seinem Besuch in der Jazzwerkstatt Peitz. Katrin Wilke verschafft in der taz einen Überblick darüber, wo in Deutschland Jazz stattfindet. In der FAZ gratuliert Jan Wiele Elvis Costello zum 70. Geburtstag.
Besprochen werden das neue Album "Romance" von Fontaines D.C. (Standard), ein Auftritt von Gianluigi Trovesi mit Quintett in Frankfurt (FR), ein Open-Air-Konzert des HR-Sinfonieorchesters und der HR-Bigband (FR) und Maxim Billers Album "Studio" (WamS).
Weitere Artikel: Für die taz porträtiert Julian Weber den Berliner Club-Unternehmer Dimitri Hegemann. Peter Kemper berichtet in der FAZ von seinem Besuch in der Jazzwerkstatt Peitz. Katrin Wilke verschafft in der taz einen Überblick darüber, wo in Deutschland Jazz stattfindet. In der FAZ gratuliert Jan Wiele Elvis Costello zum 70. Geburtstag.
Besprochen werden das neue Album "Romance" von Fontaines D.C. (Standard), ein Auftritt von Gianluigi Trovesi mit Quintett in Frankfurt (FR), ein Open-Air-Konzert des HR-Sinfonieorchesters und der HR-Bigband (FR) und Maxim Billers Album "Studio" (WamS).
Architektur
Fünf Milliarden Euro investierte Disney im Jahr 1992, um in Frankreich fünf Retortenstädte zu gestalten, die das "Val d'Europe" bilden, heute wohnen dort über 37.000 Menschen, erinnert Niklas Maak, der sich für die FAS die Ausstellung "L'architecture des réalités mises en scène: Re-construire Disney" im Architekturmuseum Arc En Rêve Bordeaux angesehen hat. Sie zeigt ihm, wie Disney "Kulissen seiner Fiktionen immer weiter in die Realität" schob: "Noch nie hatte ein Konzern in der Geschichte Frankreichs so viel zu sagen, wenn es um den Bau neuer Städte ging, und noch nie wurden so hemmungslos alle modernen Stile und Ideen ausgeblendet, die nach dem Städtebau von Baron Haussmann und dem Ideal der Gartenstadt des 19. Jahrhunderts kamen: Die Stadtplaner Cooper, Robertson & Partners kommen aus New York und sind für ihren New Urbanism bekannt, der in Amerika versucht, Retortenstädte nach dem Vorbild alter europäischer Städte zu bauen. Dass sie für Disney im Pariser Osten neue Städte errichten durften, ist eine Art doppelter ästhetischer Rückkoppelung zwischen verschiedenen Fiktionsebenen: Ein Teil des Pariser Ostens sieht nun so aus, wie man sich in Amerika Frankreich vorstellt, und diese Vorstellung von Frankreich haben die Amerikaner vor allem aus Disney-Filmen. Die Franzosen, die im Val d'Europe leben, werden von dieser Architektur auf direktem Wege zu Frankreich-Darstellern gemacht..."
In der FAZ gratuliert Matthias Alexander dem Architekturhistoriker Winfried Nerdinger zum achtzigsten Geburtstag.
In der FAZ gratuliert Matthias Alexander dem Architekturhistoriker Winfried Nerdinger zum achtzigsten Geburtstag.
1 Kommentar