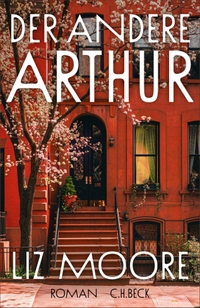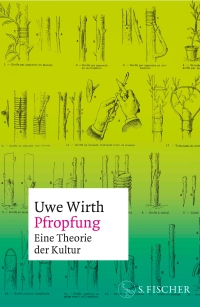Efeu - Die Kulturrundschau
Verharren im Provinziellen
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
14.04.2018. Volksbühnenintendant Chris Dercon ist weg. Die Kritiker sind trotzdem nicht froh. Dercons Demontage war so hässlich, dass jetzt keiner verantwortlich sein will: Kultursenator Klaus Lederer nicht, OB Michael Müller nicht, die teils unglaublich gehässigen Kritiker nicht und die Castorf-Verehrer an der Volksbühne, die Dercon Kot an die Tür schmierten, natürlich auch nicht. Bleibt die Frage, wer will jetzt noch nach Berlin? Auch in Schweden ist keine Lösung im Streit um die Akademie in Sicht. Jetzt sollen wir uns auch noch an Antisemitismus gewöhnen, stöhnt die FAZ nach der Verleihung des Echo an die Rapper Kollegah und Farid Bang. Und der Hollywoodreporter bringt noch eine traurige Meldung: Milos Forman ist gestorben.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
14.04.2018
finden Sie hier
Bühne

Vom Regen heute morgen schon fast abgewaschen: die höhnischen "Tschüss, Chris"-Plakate vor der Volksbühne
Na, das ist geschafft. Volksbühnenintendant Chris Dercon wurde nach einem knappen halben Jahr aus dem Amt gemobbt. Kommissarischer Leiter wird jetzt erst einmal Klaus Dörr, eigentlich von kommender Spielzeit an Geschäftsführer der Volksbühne. Wäre die Sache nicht so ekelhaft - die Anfeindungen gingen bis zu Fäkalienschmierereien an Dercons Bürotür - könnte man sich köstlich amüsieren über die Eilfertigkeit, mit der die schärfsten Kritiker Dercons jetzt jede Verantwortung für den Rücktritt von sich weisen. Angefangen mit Klaus Lederer. Der hatte sein Amt als Kultursenator noch nicht angetreten hatte, als er bereits ankündigte, Dercon passe nicht zur Volksbühne, er wolle seinen Vertrag überprüfen. Heute behauptet er im Interview mit der Berliner Zeitung: "Ich bin im Übrigen nicht bereit, alle Probleme, denen die Volksbühne jetzt ausgesetzt ist, an einer Person festzumachen und Chris Dercon die alleinige Verantwortung für das alles zuzuschieben. Ich habe mich bewusst nicht mehr öffentlich zur Volksbühne geäußert, und es war mir auch wichtig, anonyme Angriffe und Invektiven unter der Gürtellinie gegen Chris Dercon strikt zurückzuweisen und mich vor ihn zu stellen."
Ein Statement, das Andreas Busche im Tagesspiegel "nur als blanken Hohn verstehen" kann: "Lederer hatte Dercon mit seiner frühen Weigerung, überhaupt mit dem von seinem Vorgänger Tim Renner eingesetzten Volksbühnen-Intendanten inhaltlich zu diskutieren, von Beginn an zum Abschuss freigegeben. Dass ein Großteil des Volksbühnen-Ensembles, das in Wirklichkeit längst keines mehr war, Dercon ebenfalls die Zusammenarbeit aufkündigte, war auch dem Klima in der Stadt geschuldet."
In der nachtkritik macht Esther Slevogt kein Hehl aus ihrer Zufriedenheit mit dem Rücktritt, fand sie Dercons Berufung doch intransparent und im "Hinterzimmer par Ordre de Mufti" getroffen und Dercons kurzes Schaffen präsentierte sich ihr als "Avantgarde von gestern". Unverständlich ist ihr allerdings, dass OB Michael Müller, mitverantwortlich für die Berufung Dercons, sich keine Sekunde hinter seinen Intendanten gestellt hat: "Im Gegenteil: Müller sah schweigend zu, wie sich die Berliner Kulturszene in Folge seiner Entscheidung zerfleischte. Müller stellte sich nicht schützend vor Chris Dercon, den seine eigene kulturpolitische Inkompetenz in eine so fatale Lage gebracht hatte. Als habe er nichts mehr mit dieser Personalentscheidung zu tun, ließ er Dercons galoppierende Demontage zu." Auch jetzt duckt sich Müller wie immer weg.
Für Ulrich Seidler (Berliner Zeitung) kommt Dercons Rücktritt nach fünf Monaten Amtszeit noch zu spät: "Bei allem Respekt für Dercons Entscheidung, bei allem Mitleid, das der eine oder andere für Dercon empfinden mag und mithin auch für seine Programmchefin Marietta Piekenbrock, die ihm mit großer Tapferkeit zur Seite stand, oder auch für die Künstler, die von diesem Abenteuer die eine oder andere Blessur davontragen werden − letztlich ist es doch Dercon, der sich seines Scheiterns viel zu spät bewusst wurde und die Konsequenz viel zu lange hinauszögerte." In der FAZ geißelt Simon Strauß die "unspezifische Gier nach Progressivität" der Berliner Politiker, die für die Berufung Dercons verantwortlich gewesen sei. Auch Susanne Messmer (taz) ist froh, dass die "Schnapsidee" der Dercon-Berufung ihr Ende gefunden hat.
Harry Nutt sieht dagegen in der Berliner Zeitung überhaupt keinen Grund zur Freude: "Wer immer sich jetzt in seiner Annahme bestätigt sehen mag, dass Chris Dercon als erfahrener Mann des Kunstbetriebs nicht der Richtige war, um ein Theater zu leiten, der sollte nicht übersehen, dass die trotzige Verteidigung der alten Volksbühne auch ein Verharren im Provinziellen bedeutete." Katrin Bettina Müller sieht das in der taz ähnlich: Der Sieg der Dercon-Gegner "ist traurig und spricht nicht für Offenheit".
Und was folgt jetzt? Wer will jetzt noch nach Berlin? "Für die deutschsprachige Theaterwelt ist Dercons Rücktritt ein Fanal. Denn viele, meist jüngere theaterbegeisterte Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbanden mit Dercons Bestellung zum Volksbühnenchef die Hoffnung, der Mann könne eine Öffnung und Erneuerung der heimischen Theaterwelt bewirken", fürchtet Wolfgang Höbel auf Spiegel online. "Dass das Experiment mit ihm gescheitert ist, mag die Leute freuen, die ohnehin von Anfang an wussten, dass Dercon der falsche Mann am falschen Platz sein würde. Doch geholfen ist damit niemandem", ahnt Dirk Pilz auf Zeit online. "Blickt man auf sein Scheitern und Matthias Lilienthals Abgang in München, muss man festhalten: Experimente werden es im deutschen Theater künftig schwerer haben", meint Jörg Häntzschel in der SZ. "Man darf Dercon nicht zum Märtyrer machen, aber wenn Berlin schon immer als hartes Theaterpflaster galt, dann kann man es jetzt als unbetretbar bezeichnen", prophezeit Rüdiger Schaper im Tagesspiegel.
Weiteres: In der NZZ berichtet Michael Stallknecht von der Wiedereröffnung des renovierten Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth mit Johann Adolph Hasses "Artaserse". Besprochen wird die Uraufführung von Olga Bachs Stück "Kaspar Hauser und Söhne" in der Inszenierung von Ersan Mondtag am Theater Basel (NZZ).
Besprochen werden Gavin Bryars Oper "Marilyn Forever" in Wien (Presse) und Jan Bosses Inszenierung von Shakespeares "Maß für Maß" in Zürich (FAZ).
Kunst
In der taz widmet sich Tal Sterngast in der Serie "Alte Meister" Poussins Selbstporträt in der Berliner Gemäldegalerie. Marc Zitzmann erinnert in der FAZ an den Aufruhr, den Degas' Skulptur einer "Petite Danseuse de quatorze ans" 1881 auslöste.
Literatur
Das Fiasko der Schwedischen Akademie, die sich in einer Art Domino-Effekt der Skandale vor den Augen der Öffentlichkeit täglich ein kleines bisschen mehr zerlegt, beschäftigt die Feuilletons auch weiterhin: Dass der durch eine #MeToo-Aufdeckung losgetretene Skandal nun ausgerechnet in einen Rücktritt der Ständigen Sekretärin Sara Danius gemündet ist, stößt in Schweden einigen besonders auf, berichtet Thomas Borchert in der FR. Überhaupt haben sich in Schweden viele Frauen mit Danius solidarisiert, erklärt Matthias Heinemann in der FAZ. Verwirrt von den vielen Namen und Interessenskonflikten? Abhilfe schafft Wieland Freund, der für die Welt online die Konfliktkonstellationen aufdröselt.
Aber wie könnte es weitergehen? Thomas Steinfeld berichtet in der SZ: "Die Verbliebenen reden davon, die Abtrünnigen zurückholen zu wollen, ohne Sara Danius. Diese denken offenbar nicht einmal im Traum an eine Rückkehr, sodass das Quorum unerreichbar bleibt. Der König erklärt, die Statuten ändern zu wollen. Dabei ist nicht einmal gewiss, ob er es vermag, denn auch die Statuten stammen aus dem Jahr 1786 und sind so vage gehalten, dass jeder Versuch einer Änderung einen endlosen Deutungsstreit nach sich ziehen muss."
Im Deutschlandfunk Kultur hatte Schriftsteller Ilija Trojanow vor wenigen Tagen angeregt, die schwedische Jury doch aufzulösen und durch eine internationale Jury zu ersetzen - schließlich habe der Preis auch weitreichende Folgen für die internationale Literatur. Bei taz-Redakteur Dirk Knipphals stößt er damit auf amüsierte Skepsis: "Wer soll die Jury bestimmen? Am besten gleich die UNO? Und nach welchen Maßstäben soll sie zusammengesetzt sein? Pro Kontinent zwei Sitze? Pro eine Million Buchverkäufe eine Stimme?" Stattdessen schlägt er gelassenen Pragmatismus als bessere Alternative vor und hofft auf Erneuerungskräfte aus dem Inneren: "Man kann sich, auch wenn man es bedauert, eine solche Institution (...) nicht einfach neu schnitzen."
Weitere Artikel: Jonas Lages berichtet im Tagesspiegel vom Auftakt der Deutsch-Israelischen Literaturtage in Berlin. Denis Scheck ergänzt seinen Literaturkanon in der Welt um Mary Shelleys "Frankenstein". Im literarischen Wochenendessay der FAZ befasst sich die Schriftstellerin Anna Katharina Hahn mit der Angst als Motor ihres Schreibens. Ralph Hammerthaler schreibt in der SZ einen Nachruf auf den mexikanischen Schriftsteller Sergio Pitol.
Besprochen werden unter anderem Ruth Klügers "Gegenwind" (Freitag), Hans Magnus Enzensbergers "Überlebenskünstler" (Welt), Emily Ruskovichs "Idaho" (Welt), Sayaka Muratas "Die Ladenhüterin" (taz), Alexander Schimmelbuschs "Hochdeutschland" (Zeit), Torsten Schulz' "Skandinavisches Viertel" (Freitag), Ahmet Altans "Wie ein Schwertstreich" (NZZ) und Botho Strauß' "Der Fortführer" (FAZ).
Aber wie könnte es weitergehen? Thomas Steinfeld berichtet in der SZ: "Die Verbliebenen reden davon, die Abtrünnigen zurückholen zu wollen, ohne Sara Danius. Diese denken offenbar nicht einmal im Traum an eine Rückkehr, sodass das Quorum unerreichbar bleibt. Der König erklärt, die Statuten ändern zu wollen. Dabei ist nicht einmal gewiss, ob er es vermag, denn auch die Statuten stammen aus dem Jahr 1786 und sind so vage gehalten, dass jeder Versuch einer Änderung einen endlosen Deutungsstreit nach sich ziehen muss."
Im Deutschlandfunk Kultur hatte Schriftsteller Ilija Trojanow vor wenigen Tagen angeregt, die schwedische Jury doch aufzulösen und durch eine internationale Jury zu ersetzen - schließlich habe der Preis auch weitreichende Folgen für die internationale Literatur. Bei taz-Redakteur Dirk Knipphals stößt er damit auf amüsierte Skepsis: "Wer soll die Jury bestimmen? Am besten gleich die UNO? Und nach welchen Maßstäben soll sie zusammengesetzt sein? Pro Kontinent zwei Sitze? Pro eine Million Buchverkäufe eine Stimme?" Stattdessen schlägt er gelassenen Pragmatismus als bessere Alternative vor und hofft auf Erneuerungskräfte aus dem Inneren: "Man kann sich, auch wenn man es bedauert, eine solche Institution (...) nicht einfach neu schnitzen."
Weitere Artikel: Jonas Lages berichtet im Tagesspiegel vom Auftakt der Deutsch-Israelischen Literaturtage in Berlin. Denis Scheck ergänzt seinen Literaturkanon in der Welt um Mary Shelleys "Frankenstein". Im literarischen Wochenendessay der FAZ befasst sich die Schriftstellerin Anna Katharina Hahn mit der Angst als Motor ihres Schreibens. Ralph Hammerthaler schreibt in der SZ einen Nachruf auf den mexikanischen Schriftsteller Sergio Pitol.
Besprochen werden unter anderem Ruth Klügers "Gegenwind" (Freitag), Hans Magnus Enzensbergers "Überlebenskünstler" (Welt), Emily Ruskovichs "Idaho" (Welt), Sayaka Muratas "Die Ladenhüterin" (taz), Alexander Schimmelbuschs "Hochdeutschland" (Zeit), Torsten Schulz' "Skandinavisches Viertel" (Freitag), Ahmet Altans "Wie ein Schwertstreich" (NZZ) und Botho Strauß' "Der Fortführer" (FAZ).
Musik
Große Einigkeit im Feuilleton: Die Echo-Auszeichnung für Kollegah und Farid Bang hätte nicht passieren dürfen. Jens Balzer wirft in der taz insbesondere der deutschen Pop-Öffentlichkeit jenseits der kritischen Feuilletonstimmen Totalversagen und Kapitulation vor: Noch vor wenigen Jahren war der Betrieb gesammelt aufgestanden, als es darum ging, gegen Frei.Wild - zu Recht - zu protestieren, wobei die Tiroler Rocker sich im Vergleich insbesondere zu dem derben Sexismus der Rapper wie brave Chorknaben ausnehmen: Doch "es ist zu einfach, jetzt mit dem Finger auf die Echo-Veranstalter zu zeigen. ... Natürlich hätte man die beiden ausschließen können, aber das hätte ihnen nur wieder dabei geholfen, sich als Opfer zu inszenieren. Wichtiger wäre zunächst, sich in Erinnerung zu rufen, warum sie überhaupt für den Echo infrage kamen: Weil mehrere hunderttausend Menschen ihre Platte gekauft und Millionen von Menschen sie gern gehört haben. Dass das so ist, ist ein Problem, über das man nicht - wie bisher - milde hinwegsehen kann. Wir alle müssen da genauer hinsehen und hinhören."
In dem auf der Bühne absolvierten Schlagabtausch zwischen den Rappern und Campino zeigt sich für Tagesspiegel-Kommentator Gerrit Bartels der Generationenkonflikt im Pop. Für ein "Empörungsbäuerchen" hält Karl Fluch im Standard Campinos Protestrede: "Hätte er ein Zeichen setzen wollen, hätte er gesagt, dass er den Preis in dieser Nachbarschaft nicht akzeptieren kann." Ähnlich sieht es NZZ-Kommentator Benedict Neff: Er empfand den Abend als "würdelose Veranstaltung, die zu verlassen die einzig angemessene Reaktion für die versammelte Abendgesellschaft gewesen wäre." Gefördert wurde "die Verharmlosung des Holocaust." Ursula Scheer schlägt in der FAZ die Hände über dem Kopf zusammen: "Jetzt sollen wir uns auch noch an Antisemitismus gewöhnen. Der Echo 2018 hat ihn musikalisch hoffähig gemacht."
Auch Oliver Polak empört sich in der Welt über das Versagen der Popbranche: "Wie können Künstler, Musikbranchenheinis und andere ernsthaft dieser Veranstaltung beiwohnen, wo bleibt der Aufstand? Wie unemphatisch, wie kalt muss man sein, dass man hier keinen Widerstand leistet? ... Im Publikum Prosecco trinkend rumzubuhen ist kein Widerstand, das ist nicht einmal ein Widerständchen. Einen Löwen bekämpft man nicht, indem man ihn mit Federn bewirft."
Viel Freude hat ZeitOnline-Kritiker Daniel Gerhardt an dem neuen Album "Dimensional People" der aus dem Rheinland nach Berlin gezogenen Elektro-Frickeler Mouse on Mars deren Musik "sich ohne erkennbare Anstrengung über vermeintliche Genregrenzen und Trennlinien zwischen Hoch- und Ramschkultur hinwegsetzt." In diesem Mini-Dokumentarfilm gestatten die Musiker einen Blick in ihre digitale Hexenküche:
Weiteres: Nach einem Berliner Konzert der Berliner Philharmoniker unter deren nächstem Chefdirigenten Kirill Petrenko freut sich FAZ-Kritiker Clemens Haustein nur noch mehr auf Petrenkos vollständiger Ankunft 2019 in Berlin. Karl Fluch erinnert sich im Standard an die Austro-Popband STS.
Besprochen werden Jeffrey Lewis' "Works by Tuli Kupferberg, 1923-2010" (taz), Charly Hübners Dokumentarfilm "Wildes Herz" über die Punkband Feine Sahne Fischfilet (Freitag), ein Britten-Konzert des Bundesjugendorchesters (Tagesspiegel) und ein Auftritt des Tenors Juan Diego Flórez (FR).
In dem auf der Bühne absolvierten Schlagabtausch zwischen den Rappern und Campino zeigt sich für Tagesspiegel-Kommentator Gerrit Bartels der Generationenkonflikt im Pop. Für ein "Empörungsbäuerchen" hält Karl Fluch im Standard Campinos Protestrede: "Hätte er ein Zeichen setzen wollen, hätte er gesagt, dass er den Preis in dieser Nachbarschaft nicht akzeptieren kann." Ähnlich sieht es NZZ-Kommentator Benedict Neff: Er empfand den Abend als "würdelose Veranstaltung, die zu verlassen die einzig angemessene Reaktion für die versammelte Abendgesellschaft gewesen wäre." Gefördert wurde "die Verharmlosung des Holocaust." Ursula Scheer schlägt in der FAZ die Hände über dem Kopf zusammen: "Jetzt sollen wir uns auch noch an Antisemitismus gewöhnen. Der Echo 2018 hat ihn musikalisch hoffähig gemacht."
Auch Oliver Polak empört sich in der Welt über das Versagen der Popbranche: "Wie können Künstler, Musikbranchenheinis und andere ernsthaft dieser Veranstaltung beiwohnen, wo bleibt der Aufstand? Wie unemphatisch, wie kalt muss man sein, dass man hier keinen Widerstand leistet? ... Im Publikum Prosecco trinkend rumzubuhen ist kein Widerstand, das ist nicht einmal ein Widerständchen. Einen Löwen bekämpft man nicht, indem man ihn mit Federn bewirft."
Viel Freude hat ZeitOnline-Kritiker Daniel Gerhardt an dem neuen Album "Dimensional People" der aus dem Rheinland nach Berlin gezogenen Elektro-Frickeler Mouse on Mars deren Musik "sich ohne erkennbare Anstrengung über vermeintliche Genregrenzen und Trennlinien zwischen Hoch- und Ramschkultur hinwegsetzt." In diesem Mini-Dokumentarfilm gestatten die Musiker einen Blick in ihre digitale Hexenküche:
Weiteres: Nach einem Berliner Konzert der Berliner Philharmoniker unter deren nächstem Chefdirigenten Kirill Petrenko freut sich FAZ-Kritiker Clemens Haustein nur noch mehr auf Petrenkos vollständiger Ankunft 2019 in Berlin. Karl Fluch erinnert sich im Standard an die Austro-Popband STS.
Besprochen werden Jeffrey Lewis' "Works by Tuli Kupferberg, 1923-2010" (taz), Charly Hübners Dokumentarfilm "Wildes Herz" über die Punkband Feine Sahne Fischfilet (Freitag), ein Britten-Konzert des Bundesjugendorchesters (Tagesspiegel) und ein Auftritt des Tenors Juan Diego Flórez (FR).
Film

"Montags in Dresden", hier mit einer Szene außerhalb Dresdens (Bild: Sabine Michel/Solofilm)
In Berlin läuft heute Abend Sabine Michels Dokumentarfilm "Montags in Dresden", ein Porträt dreier Pegida-Anhänger, das bereits bei seiner Premiere bei DOKLeipzig für Wellen geschlagen hat - ohne Kommentar und Einordnung biete der Film Pegida ein Forum, lautete der Vorwurf. "Ratlos" habe die nachgetragene Stellungnahme des Festivals sie gemacht, erklärt dazu die Schriftstellerin Annett Gröschner im "10 nach 8"-Blog auf ZeitOnline: "Ich musste an Thomas Heise denken und die Geschichte seines ersten Films, den er 1980 in der DDR gedreht hatte und der den treffenden Titel hatte: 'WOZU ÜBER DIESE LEUTE EINEN FILM?'. In der DDR galten die kleinkriminellen Weberbrüder aus Prenzlauer Berg, die soffen und klauten, nicht als legitime Protagonisten für einen Film. Also wurde er staatlicherseits untersagt. Heutzutage verbietet der Staat keine Dokumentarfilme, aber ein Teil der Öffentlichkeit fragt dasselbe bei 'Montags in Dresden': 'Wozu über diese Leute einen Film?' Das wurde allerdings auch schon bei den Protagonisten von Heises Nachfolgefilm 'Stau' vor 25 Jahren gefragt. Auch dieser Film hatte sich einer eindimensionalen Erklärung des Phänomens Rechtsradikalismus verweigert."
Für die taz spricht Thomas Winkler mit der Filmemacherin: Ihr war es um eine "differenzierte Betrachtung" der diffusen Mentalitätslage in Dresden gegangen, erklärt sie und unterstreicht, dass es sich um einen "künstlerischen Dokumentarfilm" handelt: Sie wolle den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Der Film ist auch ein Gesprächsangebot - und Gespräche zwischen den verschiedenen Lebenswelten finden in unserer Gesellschaft zu selten statt. ... Ich wollte vor allem die Prägungen aus der Kindheit in der DDR, ihren Alltag vor und nach dem Mauerfall, ihre Sorgen und Ängste und ihr soziales Umfeld ins Verhältnis setzen zu dem, was sie heute bewegt."
Philipp Lichterbeck erklärt auf ZeitOnline die Hintergründe, warum José Padilhas brasilianische Netflix-Serie "Der Mechanismus" in seiner Heimat für politischen Wirbel sorgt: Es geht um die Korruptionsaffären des ehemaligen Staatsoberhaupts Luiz Inácio Lula da Silva, die für das Land weitreichende Folgen hatten. Da sollte man meinen, dass Padilha "Wert auf historische Akkuratesse legt und sensibel mit den Fakten umgeht. Doch das tut er nicht. ... Padilha wirft Zeitabläufe und Fakten wild durcheinander. Damit hat er in Brasilien einen Streit über die Grenzen der Kunstfreiheit bei der Darstellung historischer Ereignisse ausgelöst." Ist das die Methode Padilha? Auch sein bei der Berlinale gezeigter Terrorismus-Thriller "Sieben Tage in Entebbe" zeichnete sich schon durch eine liberale Handhabe historischer Details aus.
Milos Forman ist tot, melden die Agenturen - hier die Meldung beim Standard. Erste Nachrufe bringen der Hollywood Reporter und Deutschlandfunk Kultur.
Weitere Artikel: Für die Berliner Zeitung durchstöbert Frédéric Jaeger die für Cannes angekündigten Wettbewerbsfilme. Skeptisch blickt Franz Everschor im Filmdienst zurück auf die jüngsten Filme Clint Eastwoods, in denen der Kritiker ein konservatives Verhältnis des Filmemachers zum Heldentum ausmacht. Simon Hauck berichtet im Filmdienst vom Kongress Zukunft Deutscher Film. Karl Smith erinnert sich auf The Quietus an den Trickfilm "Die letzten Glühwürmchen" des kürzlich verstorbenen japanischen Filmemachers Isao Takahata. Susanne Ostwald (NZZ) und Simon Strauß (FAZ) gratulieren Claudia Cardinale zum Achtzigsten. Wir erinnern uns an ihre großartige erste Szene in Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod":
Besprochen werden John Krasinskis Horrorfilm "A Quiet Place" (FR, mehr dazu hier) und die Netflix-Serie "Lost in Space" (FAZ).
Kommentieren