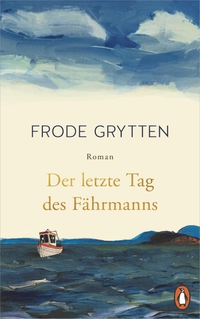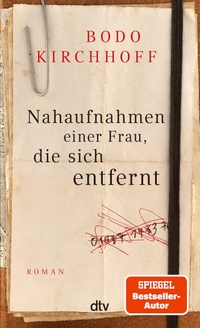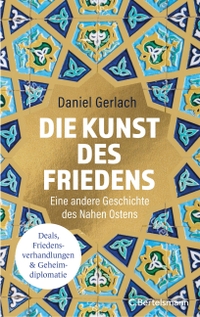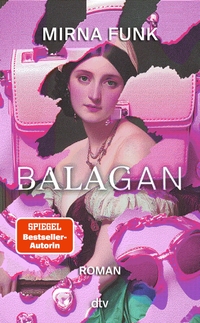Efeu - Die Kulturrundschau
Unterfutter eines gewaltigen Weltwissens
Die besten Kritiken vom Tage. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
30.12.2022. Die Welt erfreut sich im Leipziger Museum für Völkerkunde an Enotie Paul Ogbedors farbsatten Gemälden von Benin-Bronzen und erfährt nebenbei auch noch etwas über die Rolle der Frauen in Benin. In der Berliner Zeitung kämpft der polnische Theaterregisseur Jakub Skrzywanek für Meinungsfreiheit in Polen. Die FR ertastet die Oberflächenstruktur in der Musik von Barre Phillips und György Kurtág jr. NZZ und FAZ bringen erste Nachrufe auf Vivienne Westwood, die so wunderbar jedem Bild entsprach, das man sich von britischen Exzentrikern macht.
9punkt - Die Debattenrundschau
vom
30.12.2022
finden Sie hier
Design
29th December 2022.
- Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022
Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.
The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV
Vivienne Westwood ist gestorben. Die britische Modedesignerin gilt als die Miterfinderin des Punk. Kann man das tragen - Sie ahnen es - ist also eine Frage die Westwood nie eingefallen wäre. Auch "Alter war für die Modeschöpferin Vivienne Westwood immer nur eine Zahl", erzählt Marion Löhndorf in der NZZ. "Altersgemässe Kleidung? Mit 78 sah man sie im Schottenrock, mit nackten Knien über bunten Kniestrümpfen, Sneakers und einer wild gemusterten Jacke. Was die Leute dachten, war ihr egal. Und was sie trug, musste nicht neu sein. Denn Westwood, die auch im hohen Alter noch durch London radelte und bescheiden auf kleinster Wohnfläche lebte, rezyklierte bereits lange bevor auch das Mode wurde."
In der FAZ würdigt Gina Thomas die Designerin, die so wunderbar jedem Bild entsprach, das man sich von britischen Exzentrikern macht: "Heftige politische Gefühle und der Wunsch, gegen den Strich zu bürsten, gehörten denn auch zu den Merkmalen der Designerin, die ihre berufliche Karriere als Grundschullehrerin begonnen hatte. Ihre Entwürfe prägten Anfang der siebziger Jahre die Punk-Ära. Damals hatte sie mit ihrem Lebensgefährten Malcom McClaren, dem späteren Manager der Punkband 'Sex Pistols', in der Londoner King's Road einen Laden eröffnet, dessen häufig wechselnder Name die Dynamik ihres Wesens, der Zeit und des Milieus spiegelte. Bei aller Aufsässigkeit verriet ihr Stil auch eine Faszination für historische Kostümen und Stoffe wie Tweed und Tartan, denen sie einen eigenwilligen schrägen Schliff verlieh. Aus einer mittelenglischen Arbeiterfamilie stammend, wurde sie als enfant terrible vom Establishment gefeiert und als Dame des Britischen Empire geadelt." Im Guardian schreibt Jess Cartner-Morley den Nachruf auf Westwood. Und eine schöne Bilderstrecke gibts auch dazu.
Kunst

Andreas Platthaus wiederum ist für die FAZ nach Halle gereist, wo der Kunstverein Talstraße eine Ausstellung der Fotografin Helga Paris präsentiert. Sie und ihr Mann Ronald "gehörten zur Künstlerszene in Prenzlauer Berg, enge Freundschaften pflegte Helga Paris besonders zu Schriftstellerinnen wie Elke Erb, Christa Wolf und Sarah Kirsch. So entstanden Fotos, die nicht nur Lebensumstände dokumentieren, sondern auch Lebensschwierigkeiten. Und persönliche Zuneigung. ... Rund sechzig Aufnahmen bilden den Ausgangspunkt der Schau, doch sie sind leider erst am Ende des Parcours versammelt, im zweiten Obergeschoss. Dort entfaltet sich ein Panoptikum unangepasster DDR-Kunst mit Protagonisten wie Heiner Müller, Cornelia Schleime, Helmut Brade, Günter de Bruyn, Katja Lange-Müller, Carlfriedrich Claus, Ursula Scheib, Adolf Endler oder Bert Papenfuß und an Schauplätzen wie dem Atelier von Hans Scheib oder dem Salon von Ekkehard Maaß. Immer wieder in Gruppenbildern dabei übrigens Sascha Anderson - wie als Mahnung, dass es in der DDR keine geschützten Bereiche gab."
Weitere Artikel: In der FR schreibt Ingeborg Ruthe über Max Beckmanns Gemälde "Geburt" (1937), das man in der Neuen Nationalgalerie Berlin sehen kann. Im Tagesspiegel stellt Lars von Törne die Moskauer Künstlerin Victoria Lomasko vor, die nach dem Angriff auf die Ukraine ins Exil ging. In der NZZ schreibt Tobia Bezzola einen großen Nachruf auf den Künstler Franz Gertsch. In der taz schreibt Sebastian C. Strenger zum Tod der Künstlerin Dorothy Iannone.
Besprochen werden die Ausstellung ""Susanna - Bilder einer Frau vom Mittelalter bis MeToo" im Kölner Wallraf-Richartz-Museum (taz) und Katy Hessels Kunstgeschichte "The Story of Art Without Men" (Standard).
Literatur
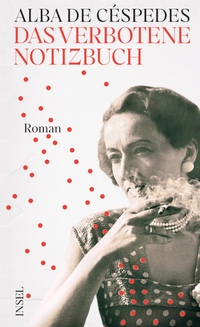 Die SZ hat sich im Betrieb nach den besten Büchern des Jahres umgehört. Die Schriftstellerin Judith Schalansky etwa schwärmt von Alba de Céspedes' erstmals 1952 erschienenem Tagebuchroman "Das verbotene Notizbuch", in dem eine in eine Familie eingekerkerte Frau sich einen Freiraum erschreibt: "Die im Schreiben gewonnenen Erkenntnisse sind so berauschend wie schmerzhaft, weil sie Valeria die Grenzen der eigenen, zwischen Moral, Abstiegsangst und Entsagung rigide abgezirkelten Existenz erst bewusst machen." Zu entdecken ist mit dem Buch "ein Kassiber aus einer zwar vergangenen, doch noch lange nicht überwundenen Zeit. Schonungslos, scharfsinnig, spannend."
Die SZ hat sich im Betrieb nach den besten Büchern des Jahres umgehört. Die Schriftstellerin Judith Schalansky etwa schwärmt von Alba de Céspedes' erstmals 1952 erschienenem Tagebuchroman "Das verbotene Notizbuch", in dem eine in eine Familie eingekerkerte Frau sich einen Freiraum erschreibt: "Die im Schreiben gewonnenen Erkenntnisse sind so berauschend wie schmerzhaft, weil sie Valeria die Grenzen der eigenen, zwischen Moral, Abstiegsangst und Entsagung rigide abgezirkelten Existenz erst bewusst machen." Zu entdecken ist mit dem Buch "ein Kassiber aus einer zwar vergangenen, doch noch lange nicht überwundenen Zeit. Schonungslos, scharfsinnig, spannend."Paul Ingendaay reibt sich in der FAZ verwundert die Augen: Nanu, Len Deighton lebt ja noch! In Deutschland hatte der britische Thrillerautor ("Harry Palmer", "Bernard Samson") gegenüber John le Carré, Eric Ambler und Co. immer deutlich das Nachsehen - in seiner Heimat ehrte man ihn letztes Jahr mit einer großen Neuausgabe seiner Romane, ohne dass dies deutsche Verlage hätte aufmerken lassen. Diese Indifferenz hat uns "nicht nur Deightons Literatur, sondern auch sein Witz, seine Klugheit und sein radikal furchtloser Umgang mit deutscher und britischer Geschichte unsichtbar" gemacht. "Was Deightons Romane außergewöhnlich macht, sind ihre Atmosphäre, die brillanten Dialoge und das Unterfutter eines gewaltigen Weltwissens. Wenige lebende Schriftsteller haben so intensiv die Spannungen und politischen Obsessionen der zweiten Jahrhunderthälfte ausgedrückt - immer vorausgesetzt, man traut der Genreliteratur eine solche Verarbeitungsleistung überhaupt zu." Außerdem hat Ingendaay mit Deighton ein Gespräch über dessen historische Abrisse über den Zweiten Weltkrieg geführt.
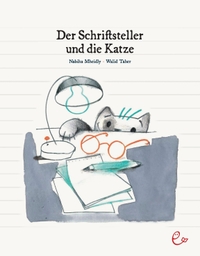 Arabische Kinderbücher sind zwar immer noch vor allem mit erhobenem Zeigefinger geschrieben, aber es zeige sich auch immer mehr eine Tendenz, die das Fantasievolle feiert und Möglichkeitsräume eröffnet, schreibt Dunja Ramadan in der SZ. "Die Bücher von Nabhia Mheidly sind anders. Sie sind humorvoll, auch mal philosophisch. Für ihre Werke hat die Autorin bereits mehrere Preise gewonnen. Ihr Buch 'Der Schriftsteller und die Katze' wurde ins Deutsche übersetzt, darin geht es ums Schreiben und um eine eigensinnige Katze mit Stummelschwanz, 'der es völlig egal ist, wenn sie wegen ihres Stummelschwanzes ausgelacht wird. ... Beiden Frauen ist es ein Anliegen, in ihren Büchern den reichen arabischen Wortschatz abzubilden. 'Das moderne Hocharabisch ist das Tor, das man durchschreiten muss, um seine Wurzeln kennenzulernen', sagt Thomure. Ihr tue es im Herzen weh, wenn Kinder in den Vereinigten Arabischen Emiraten schlechtes Arabisch sprechen."
Arabische Kinderbücher sind zwar immer noch vor allem mit erhobenem Zeigefinger geschrieben, aber es zeige sich auch immer mehr eine Tendenz, die das Fantasievolle feiert und Möglichkeitsräume eröffnet, schreibt Dunja Ramadan in der SZ. "Die Bücher von Nabhia Mheidly sind anders. Sie sind humorvoll, auch mal philosophisch. Für ihre Werke hat die Autorin bereits mehrere Preise gewonnen. Ihr Buch 'Der Schriftsteller und die Katze' wurde ins Deutsche übersetzt, darin geht es ums Schreiben und um eine eigensinnige Katze mit Stummelschwanz, 'der es völlig egal ist, wenn sie wegen ihres Stummelschwanzes ausgelacht wird. ... Beiden Frauen ist es ein Anliegen, in ihren Büchern den reichen arabischen Wortschatz abzubilden. 'Das moderne Hocharabisch ist das Tor, das man durchschreiten muss, um seine Wurzeln kennenzulernen', sagt Thomure. Ihr tue es im Herzen weh, wenn Kinder in den Vereinigten Arabischen Emiraten schlechtes Arabisch sprechen."Weitere Artikel: In der NZZ setzt Sergej Gerassimow sein Kriegstagebuch aus Charkiw fort. Für die Literarische Welt wirft Marc Reichwein einen Blick auf die Jahresbestseller-Listen und muss einmal mehr feststellen: "Die Feuilleton-Darlings tauchen bestenfalls hinten auf." Der Belletristik ging es übrigens blendend - aber nur, wenn man den Manga-Markt mitrechnet, schreibt Christiane Lutz in der SZ.
Besprochen werden unter anderem Mohsin Hamids "Der letzte weiße Mann" (NZZ), neue Kinder- und Jugendbücher, darunter Julia Donaldsons und Axel Schefflers "Die Rüpelbande" (SZ), und Wolfgang Hardtwigs "'Der Hof in den Bergen'. Eine Kindheit und Jugend nach 1945" (FAZ).
Film

Eine Wiederentdeckung gibt es unmittelbar nach dem Jahreswechsel bei der neuen Ausgabe des Berliner Filmfestivals "Unknown Pleasures" zu machen, schreibt Perlentaucher Nikolaus Perneczky: Zu sehen sind unter anderem Filme von Michael Roemer, darunter sein in den Sechzigern unter den Eindrücken der schwarzen Bürgerrechtsbewegung entstandenes Debüt "Nothing But a Man", das den Alltag eines schwarzen Eisenbahnarbeiters schildert. "Ivan Dixon spielt ihn mit sengender Intensität als einen Rastlosen, dem es schlicht unmöglich ist, sich mit den herrschenden Zuständen zu arrangieren. ... Als Film über race relations ist 'Nothing but a Man' von seltener Kompromisslosigkeit. Es gibt keine 'gute' weiße Figur, die als Sympathieträger*in oder Identifikationsangebot fungiert. Die weißen Menschen, die Duffs Fluchtlinie durchkreuzen, sind keine ihrer selbst bewusste Individuen, sondern erscheinen als wandelnde Symptomatologien einer kranken Gesellschaftsordnung."
James Camerons zweiter "Avatar"-Blockbuster (unsere Besprechung) steht in der Kritik, indigene Kulturen zu exotisieren, sie zu fetischisieren und dabei auch das Motiv vom "weißen Retter" zu strapazieren, berichtet Daniel Kothenschulte in der FR. Die Kritik findet er ziemlich plausibel: "Es ist wie es ist: Cameron verwendet sorglos die alten, für ein westliches Publikum identifikationsstiftenden Narrative über wohlmeinende weiße Siedler oder Trapper, wie sie etwa James Stewart im alten Hollywood verkörperte. Wie Old Shatterhand kämpfen sie für die Unterdrückten - und bestätigen doch in ihrer Überlegenheit eine koloniale Hierarchie." In diesem Sinne allerdings unproblematisch ist es offenbar, wenn die mehrheitlich weiße Filmkritik den Unterdrückten zur Seite steht.
Weitere Artikel: Im Standard spricht der Schauspieler Karl Markovics über seine Rolle in Aron Lehmanns Verfilmung von Mariana Lekys Okapi-Bestseller "Was man von hier aus sehen kann". Elmar Krekeler porträtiert in der Welt Natalie Scharf, "eine der am meisten beschäftigten deutschen Drehbuchschreiberinnen", deren neue Mini-Serie "Gestern waren wir noch Kinder" heute ab 10 Uhr beim ZDF online geht.
Besprochen werden Kristina Lindströms und Kristian Petris Dokumentarfilm "Der schönste Junge der Welt" über Björn Andrésen (Tsp, mehr dazu hier), Scott Coopers "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" mit Christian Bale (SZ) und die dritte Staffel von "Emily in Paris" (NZZ).
Architektur
In der NZZ würdigt Hubertus Adam den japanischen Baukünstler und Pritzkerpreisträger Arata Isozaki, der gestorben ist. Isozaki war stark geprägt von der Zerstörung seiner Heimatstadt Oita im Zweiten Weltkrieg, erzählt Adam. "Später, aber lange vor Francis Fukuyamas gleichnamigem Bestseller, sprach Isozaki angesichts dieser Situation vom 'Ende der Geschichte'. In der Folge widmet sich Isozaki wiederholt dem Thema der Ruine. 1962 zeichnet er 'Incubation Process', die dystopische Vision einer aus Fragmenten eines griechischen Tempels herauswuchernden modernen japanischen Stadtstruktur, die schon den Keim des Untergangs in sich trägt: 'Auch die zukünftigen Städte sind Ruinen. Unsere zeitgenössischen Städte entstehen, um einen flüchtigen Moment lang zu leben. Dann verlieren sie ihre Energie und verwandeln sich wieder in träge Materie.' Die Idee einer zyklischen Erneuerung ist dem asiatischen Denken nicht fremd. Und doch war 'Incubation Process' eine Provokation" zu einer Zeit, als Japan an seiner Wiederauferstehung arbeitete.
Bühne
Der Regisseur Jakub Skrzywanek, Direktor des Zeitgenössischen Theaters in Stettin, spricht im Interview mit der Berliner Zeitung über seine Arbeit und die Meinungsfreiheit in Polen. Für ihn das Wichtigste: "Die Tätigkeit des Theaters als öffentliche Einrichtung muss ausgeweitet werden. Theater muss aufhören, nur ein Ort für die Produktion von Aufführungen zu sein. ... Das Theater sollte eine Art Kulturzentrum oder sogar ein Gemeinschaftszentrum sein. Das Theater hat eine sehr wichtige gesellschaftliche Funktion zu erfüllen - vor allem dann, wenn andere Institutionen, die diese Funktion erfüllen sollten, versagen. Deshalb haben wir das Stück 'Sex Education' entwickelt. Es war eine starke Geste. Ich wollte vor allem junge Erwachsene und Menschen im Sekundarschulalter ansprechen. Wir haben sie gefragt, was sie brauchen. Das allein verändert bereits die Perspektive des Theaters und befreit es von einer bevormundenden Haltung. Wir bekamen schnell die Antwort, dass es notwendig sei, über Sexualität zu sprechen, was zu einem Symbol des Kampfes gegen den Bildungsminister Przemyslaw Czarnek und die griesgrämige konservative katholische Ideologie wurde, die er in den polnischen Schulen verbreitet. Wir beschlossen, dass wir, da es in den Schulen keinen Platz für Sexualkunde gibt, diesen Platz im Theater finden würden."
Weiteres: Im Tagesspiegel schreibt Peter von Becker zum Tod des Theaterkritikers Günter Grack. Besprochen werden Anne Lenks Adaption von Michael Frayns Komödie "Der nackte Wahnsinn" am Schauspiel Hannover (nachtkritik), Saverio Mercadantes Oper "Francesca da Rimini" in Erl (nmz, Tsp) und Günther Rühles Theatergeschichte "Theater in Deutschland" (FR).
Weiteres: Im Tagesspiegel schreibt Peter von Becker zum Tod des Theaterkritikers Günter Grack. Besprochen werden Anne Lenks Adaption von Michael Frayns Komödie "Der nackte Wahnsinn" am Schauspiel Hannover (nachtkritik), Saverio Mercadantes Oper "Francesca da Rimini" in Erl (nmz, Tsp) und Günther Rühles Theatergeschichte "Theater in Deutschland" (FR).
Musik
Hans-Jürgen Linke staunt in der FR über die Musik von Barre Phillips und György Kurtág jr, die mit "Face à Face" gerade ein neues Album veröffentlicht haben. "Was zu erwarten wäre, wird gar nicht erst gespielt. Es geht um Klanggegenstände, um Klangereignisse, die sich jenseits oder oberhalb von gängigen Parametern wie Melodie, Rhythmus, Dynamik herstellen lassen. Es geht um Farben und Oberflächenstrukturen. Und immer sucht Barre Phillips die reibungsvolle Nähe zu den unvorhersehbaren elektronischen Klängen seines Gegenübers." Sie "arbeiten bevorzugt mit Klangkomponenten, die sich am Rande von scheinbar immateriellen Regionen bewegen. Und wenn es um Oberflächenarbeit geht, dann vor allem um klangstoffliche Eigenschaften: um raue Flächen, blitzende Stellen, handschmeichelnde Handläufe, scharfe Kanten, störende Risse, bizarre fliegende Kleinobjekte, rasselnde, mahlende, schnarrende Zeitstrecken." Wir hören rein:
Weitere Artikel: In der taz erzählt Petra Schellen von Leben und Werk der Komponistin Emilie Mayer, die sich als erste Frau im 19. Jahrhundert daran machte, Sinfonien zu komponieren. In der taz plaudert Greg Graffin, als Mitbegründer von Bad Religion Hardcore-Punk der ersten Stunde und im Nebenberuf Evolutionsbiologe, über seinen Werdegang, den er aktuell auch in einer Autobiografie nachgezeichnet hat. Ljubisa Tosic berichtet im Standard von Franz Welser-Mösts Pressekonferenz zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. In der FAZ erzählt Christian Gohlke, warum beim Wiener Neujahrskonzert vor allem gerne Walzer gespielt werden.
Besprochen werden die Compilation "Girls with Guitars Gonna Shake" (taz), Disarstars Rap-Album "Rolex für alle" (taz), ein Konzert von Extrabreit (Tsp) und neue Jazz- und Klassikveröffentlichungen, darunter Igor Levits "Tristan" (Standard). Ein kleiner Ausschnitt:
Weitere Artikel: In der taz erzählt Petra Schellen von Leben und Werk der Komponistin Emilie Mayer, die sich als erste Frau im 19. Jahrhundert daran machte, Sinfonien zu komponieren. In der taz plaudert Greg Graffin, als Mitbegründer von Bad Religion Hardcore-Punk der ersten Stunde und im Nebenberuf Evolutionsbiologe, über seinen Werdegang, den er aktuell auch in einer Autobiografie nachgezeichnet hat. Ljubisa Tosic berichtet im Standard von Franz Welser-Mösts Pressekonferenz zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. In der FAZ erzählt Christian Gohlke, warum beim Wiener Neujahrskonzert vor allem gerne Walzer gespielt werden.
Besprochen werden die Compilation "Girls with Guitars Gonna Shake" (taz), Disarstars Rap-Album "Rolex für alle" (taz), ein Konzert von Extrabreit (Tsp) und neue Jazz- und Klassikveröffentlichungen, darunter Igor Levits "Tristan" (Standard). Ein kleiner Ausschnitt:
Kommentieren