
30.11.2017 Die FAZ lernt mit einer Volksballade des chinesischen Immobilienunternehmers Luo Yings die Kulturrevolution in China aus einer etwas anderen Perspektive kennen. Die SZ verfällt in Zurab Karumidzes Roman "Dagny oder Ein Fest der Liebe" der (realen) norwegischen Femme fatal Dagny Juel, die stilecht in Tiflis einem Eifersuchtsmord zum Opfer fiel. Die taz empfiehlt die perfekten Noir-Krimis der Comickünstler Juan Díaz Canales und Juanjo Guarnido. Die Zeit lernt mit dem vergessenen Harro Harring einen echten deutschen Freiheitskämpfer kennen.

29.11.2017 Wenig los heute. Die NZZ rettet die Ehre der Rezensenten mit drei Buchbesprechungen. Karl-Markus Gauß empfiehlt den Roman "Menschenwerk" der südkoreanischen Autorin Han Kang - eine Aufarbeitung des Massakers von Gwangju. Besprochen werden auch Günther Anders' "Musikphilosophische Schriften". Die SZ befasst sich mit dem für Regensburg segensreichen Wirken derer von Thurn und Taxis .

28.11.2017 Die SZ stellt neue argentinische Lyrik vor: Bei Sergio Raimondi liest sie von Dampfmaschinen und Kraftwerken, Martin Gambarotta raubt ihr mit seinem Drive geradezu den Atem. Dramatisches, Melancholisches und Komisches findet sie in Annette Pehnts "Lexikon der Liebe". Die FR liest den Briefwechsel zwischen Christa Wolf und Lew Kopelew. Die FAZ sträubt sich unter der Kaskade von Kosewörtern, die Vladimir Nabokov auf sie niederprasseln lässt.

27.11.2017 Die FAZ spürt mit Rindert Kromhouts Jugendbuch "Brüder für immer" dem Geist von Bloomsbury nach. Außerdem lässt sie sich georgische Märchen erzählen. Der SZ sind Scott Andersons Reportagen "Zerbrochene Länder" aus dem Nahen Osten irgendwie zu amerikanisch. Zu schätzen weiß sie dagegen Frank Heiberts halsbrecherische Übersetzung von Boris Vians "Gischt der Tage". Die FR lernt von Martin Walser, keine unangenehmen Fragen zu stellen.

25.11.2017 Die NZZ bringt einen lesenswerten Schwerpunkt mit neuer afrikanischer Literatur. Besonders begeistert sie Alain Mabanckous melancholische Rückkehr nach Pointe-Noire. Dazu passt die SZ-Besprechung eines Bandes über afrikanische Fotografie. Die Welt befasst sich mit dem Dreißigjährigen Krieg. Die FR friert mit Maurizio de Giovanni in Neapel. Die FAZ erkundet Erdoganistan.

24.11.2017 Schwungvoll, kritisch und zart findet die SZ Dany Laferrieres politisch inkorrekte "Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu ermüden". Mit Michael Opitz legt sie gebannt Wolfgang Hilbigs Lebensschichten frei. Außerdem bespricht sie heute Kinderbücher. Die FAZ denkt mit dem Philosophen David Miller über moralische Verpflichtungen in Migrationsfragen nach. Die FR tanzt zu Barbaras unvollendeten Memoiren. Die NZZ entdeckt in Petra Morsbachs "Justizpalast" eine monumentale "Comedie humaine". Die Welt verübt mit Tanguy Viel lieber Selbstjustiz.

23.11.2017 Die FAZ fragt sich nach Emmanuel Boves psychologisch meisterhafter Erzählung "Was sie gesehen hat". Die FR versinkt in der Novemberdepression von Attila Bartis' Roman "Das Ende". Die SZ lässt sich von Lize Spits autobiografischer Coming-of-Age-Story "Und es schmilzt" die Schlinge um den Hals legen. Die Zeit staunt Bauklötze über die deutsche "Sonderwahrheit", die Martin Walser im Gespräch mit seinem Sohn Jakob Augstein zur Nazizeit verkündet.

22.11.2017 Wie man frei über Wissenschaft und Kunst nachdenken und dabei poetisch und doch verständlich schreiben kann, lernt die FAZ aus Gaston Bachelards Essays aus den 30er Jahren, die im Band "Der Surrationalismus" vereinigt sind. Großes Lob auch für Christophe Boltanskis Familiengeschichte "Das Versteck". Die SZ lässt sich von Julia Kissina Autoren der russischen "neuen Welle" vorstellen. Die taz steuert mit Max P. Häring und Arno Tauriinen durch die "goldgefasste Finsternis" Wiens.

21.11.2017 Die NZZ ist hin und weg von Lucia Berlins klugen und sinnenfreudigen Stories "Was wirst Du tun, wenn du gehst". Die SZ folgt Asne Seierstads "Zwei Schwestern" mit klopfendem Herzen nach Syrien in den Kampf für den IS. Die FAZ rühmt Ljudmila Ulitzkajas Roman "Jakobsleiter", der die Geschichte ihrer jüdischen Familie in den Anfangsjahren der Sowjetunion erzählt. Außerdem meint sie in Richtung Leo Steinbeis Zorn: "Mit Rechten reden" gut und schön. Aber doch nicht so selbstverliebt und mit so rechten Argumenten.

20.11.2017 Die SZ bespricht aktuelle Bücher zur Türkeikrise: Bei Inga Rogg liest sie die Vorgeschichte von Erdogans Siegeszug nach, mit Hasan Cobanli reist sie in ein "Erdoganistan" voller amüsanter Anekdoten. Mit Heinrich Gerlach begibt sie sich auf eine "Odyssee in Rot" und erhält einen platischen Eindruck der historischen Tatsachen in Stalingrad. Die FAZ bespricht Hörbücher: Mit David Foster Wallace und 1400 Laiensprechern erlebt sie 79 Stunden "Unendlichen Spaß".

18.11.2017 Die taz liest gefesselt Ralf Höllers Geschichte der Bayerischen Revolution von 1918, auf deren obersten Barrikaden die Schriftsteller saßen. Die NZZ verfolgt beeindruckt, wie Christophe Boltanski mit seinem Buch "Das Versteck" Familiengeschichte, Vichy-Zeit und soziologische Analysen verbindet. Die FR lässt sich von der guten Laune anstecken, mit der Melinda Nadj Abonjis ihren klugen Simpel Zoltan ausstattet.

17.11.2017 Beglückt liest die SZ Emmanuelle Loyers Levi-Strauss-Biografie, die ein Jahrhundert akademische Welt in Paris erwachen lässt. Gebannt lauscht sie auch Frauenstimmen aus aller Welt, die erzählen, was sie bewegt und verstört. Die NZZ amüsiert sich mit den "fragwürdigen" Gestalten in Judith Kellers Debüt. Der Funke von Durs Grünbeins "Zündkerzen" will hingegen nicht überspringen, meint sie. Die FAZ vertieft sich in Joseph Leo Koerners "Reformation des Bildes".

16.11.2017 Die Zeit lernt Felix Mendelssohn Bartholdy in der nun vollendeten Gesamtausgabe als "Briefschreiber von literarischem Rang" kennen. Außerdem empfiehlt sie Peter Handkes "Obstdiebin" als meditative Lektüre für lange Herbstwochenenden. Die FAZ schlägt mit Handke Haken wie Wolfram von Eschenbach. In Nadeem Aslams Roman "Die Goldene Legende" lernt sie die Hintergründe des Konfliktes zwischen Christen und Muslimen in Pakistan kennen. Die SZ vertieft sich in Pablo Nerudas "Nachgelassene Gedichte".

15.11.2017 Mit seinem monumentalen Roman "Aufleuchtende Details" reiht sich Peter Nadas neben Musil und Proust ein, schwärmt die taz. Die FAZ entdeckt in dem Erzählband "Wie meine Mutter ihr sanftes Gesicht bekam", dass James Matthew Barrie weit mehr war als nur der Peter-Pan-Erfinder. Dank Laurenz Lütteken sieht sie Mozart in einem ganz neuen Licht. Die SZ streift mit Johannes Jensens Wüterichen und Trinkern durch das trostlose Himmerland. Und die FR geht mit Petra Morsbach auf Tuchfühlung mit dem deutschen Justizsystem.

14.11.2017 Die FAZ lernt von David Sedaris, dass man auch ohne Selbstoptimierung ein tolles Leben haben kann. Mit Francis Spufford zieht sie durch Straßen der Kolonie "Neu-York". Die SZ streift mit Hans Biebelriether durch den Bayerischen Wald und die Geschichte des Nationalparks. Die NZZ sucht mit Peter Handkes "Obstdiebin" den heiligen Clan. Die FR bewundert noch einmal die intellektuelle Brillanz und Widerständigkeit des Ralf Dahrendorf, dem Franziska Meifort eine Biografie gewidmet hat.

13.11.2017 Die SZ pflückt mit Peter Handkes Obstdiebin Lesefrüchte. Mit Katja Gloger wirft sie einen bewundernden und zugleich kritischen Blick auf Russland. Von Stephan Mosch lässt sie sich mit der Geschichte der Gesangsstimme von Monteverdi bis Henze vertraut machen. Die FR erkundet mit der Philosophin Beate Rössler die Bedrohungen der Autonomie des Ich. Und die taz erfährt bei Lynn Rother, wie die Berliner Museen von der NS-Verfolgung jüdischer Sammler profitierten.

11.11.2017 Die Kritiker stürzen sich auf Peter Handkes letztes Epos "Die Obstdiebin": Himmelhebend und weltflüchtig, meint die FR, während die Welt noch den Quellcode entschlüsselt. Brillant im genau richtigen Maße findet die taz Daniel Kehlmanns Eulenspiegel-Roman "Tyll". Die SZ schaut mit Juli Zeh "quadratisch-praktisch" ins Jahr 2025. Die Welt schlachtet mit Stephen und Owen Kings Lügen-Präsidenten schlafende Schönheiten. Und die FAZ radelt mit Hans-Erhard Lessing durch 200 Jahre Kulturgeschichte des Fahrrads.

10.11.2017 Die FAZ lässt sich von Hugh Kennedy ausführlich die Geschichte des Kalifats von Mohammeds Tod bis heute erläutern. Die SZ lernt von John Green mit fiesen Gedanken zu leben. Die NZZ setzt mit Jan Kjaerstads durchgeknalltem Roman "Das Norman-Areal" gleich zum neuronalen Quantensprung an. In Yaa Gyasis Roman "Heimkehren" liest sie von den Folgen des Sklavenhandels für die afroamerikanische Gemeinschaft.

09.11.2017 Die taz begrüßt mit Patricia Hempels "Metrofolklore" den ersten lesbischen Campusroman: poetisch und wortgewaltig, findet sie. Die SZ blickt mit Elnathan John in die hoffnungslose Zukunft Nigerias. "Alles über Heather", der erste Roman von Mad-Men-Autor Matthew Weiner, bereitet der FAZ grimmiges Vergnügen. Die Zeit reist mit Jean Echenoz nach Pjöngjang und findet ein Gedicht. Die FR freut sich über den vierten Band von Joachim Meyerhoffs Lebensgeschichte. Und die NZZ liest Bücher zum Salafismus.
![]()
09.11.2017

08.11.2017 Die FR erlebt mit Artjom Wesjolys Roman "Blut und Feuer" die Oktoberrevolution in ruppigen Dialogen. Die SZ öffnet Margaret Atwoods Flaschenpost und entdeckt kluge Essays zu Afghanistan, Toni Morrison und peinlichen Momenten. Außerdem fragt sie sich nach der Lektüre von Günther und Joy Weisenborns "Liebe in Zeiten des Hochverrats", weshalb die "Rote Kapelle" nicht längst so bekannt ist wie die "Weiße Rose". Und die NZZ findet in Wladislaw Chodassewitschs "Nekropolis" einen Höhepunkt russischer Prosa.

07.11.2017 Die FR ist hingerissen von David Haskells poetischem und gelehrten Buch "Der Gesang der Bäume". Die FAZ goutiert Michael Wildenhains Roman "Das Singen der Sirenen" nicht zuletzt als Rache an der Berlin-Mitte-Literatur. Außerdem empfiehlt sie noch einmal Javier Cercas Hochstapler-Porträt "Der falsche Überlebende". Die SZ liest mit Wehmut einen letzten Gesprächsband mit Zygmunt Bauman. Hart ins Gericht geht die NZZ mit Leila Slimanis gefeiertem Roman "Dann schlaf auch du".

06.11.2017 Die SZ lässt sich von Sepp Dreissinger in die Wiener Kaffeehauskultur einführen und verdankt Gregor Schöllgen einen ganz neuen Blick auf "Hundert Jahre Weltgeschichte". Die taz erkundet mit Andrea Böhm vier Kontinente und beginnt, die Krise des Westens zu verstehen. Die FR liest Heinrich Bölls Kriegstagebücher als Zeugnis menschlichen Irrsinns. Die FAZ bespricht heute Krimis: Besonders empfiehlt sie David Whish-Wilsons "Ratten von Perth", der ihr die Skrupellosigkeit im Australien der Siebziger vor Augen führt.

04.11.2017 Die SZ erklimmt mit Paolo Cognettis Vater-Sohn-Gespann "Acht Berge". Die taz verzieht sich lieber mit Stefan Bollmanns Lebensreformern auf den Monte Verità und träumt von Bircher-Müsli und Licht-Luft-Hütten. Mit Sonja Hartwig und Kazim Erdogan sucht sie den deutsch-türkischen Dialog in Neukölln. Die Welt erfährt in Youssef Rakhas "Arab Porn", was der Arabische Frühling mit Porno zu tun hat. Und die FAZ staunt in Arnoldo Galvez Suarez' "Rache der Mercedes Lima" über die lateinamerikanische Fortentwicklung des Magischen Realismus seit Bolano.

03.11.2017 Die NZZ lässt sich von Martina Clavadetschers dystopischen "Knochenliedern" beunruhigen und beeindrucken. Kurt Steinmann verdankt sie die beste Ilias-Übersetzung seit langem. Die SZ berauscht sich mit Georg Trakl an Kokain und mit Peter Handke an sich selbst. Gebannt schaut sie Nina Jäckle zu, wie sie in "Stillhalten" das Bildnis ihrer Großmutter entstehen lässt. Die FR reist mit Helene Cixous nach "Osnabrück" und lernt weibliches Schreiben. Und die FAZ begutachtet mit Volker E. Pilgrim angewidert Hitlers genitales Unvermögen.

02.11.2017 Die FAZ lernt in Petra Morsbachs "Justizpalast" Gerechtigkeit und wirft mit Annie Ernaux einen soziologischen Blick auf "Die Jahre" zwischen 1945 und 2007 in Frankreich. Besser als Houellebecq findet die SZ Tristan Garcias bitterbösen "Faber". Die NZZ entdeckt in Markus Freitags "Psyche des Politischen" den weißen Fleck in der Wählerforschung. Die Zeit schaudert nicht nur vor der moralischen Leere in Irene Disches Roman "Schwarz und Weiß", sondern auch vor dem Versagen der Behörden im Fall Gurlitt. Außerdem empfiehlt sie heute Krimis.

01.11.2017 Amüsiert schiebt die FAZ mit Jean Echenoz' Mata Hari aus Paris die Revolution in Pjöngjang an und lernt ganz nebenbei etwas über Elefantenbrunst und Fische mit Ohren. In Markus Günthers raffiniertem Debütroman "Weiß" folgt sie dem subtil gezeichneten Strafprozess einer Ehe. Und von Roman Töppel lässt sie sich die Hintergründe der größten Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Kursk erläutern. Die NZZ lernt bei der Comiczeichnerin Penelope Bagieu fünfzehn "unerschrockene" Frauen kennen.
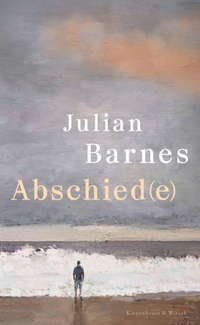 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)