
29.09.2018 Nach Lektüre von Chantal Mouffes "Für einen linken Populismus" entscheidet sich der Politologe Jan-Werner Müller in der FAZ doch lieber für die gute alte Sozialdemokratie. Die FR liest mit Gewinn Wolfgang Englers und Jana Hensels Gesprächsband über "die Erfahrung, ostdeutsch zu sein". Schön aufklärerisch findet die NZZ Stephan Thomes chinesischen Historienroman "Gott der Barbaren". Die SZ versteht mit Annie Ernaux was Klasse ist. Die taz hört James Baldwin.

28.09.2018 Die FAZ lernt bei W. Daniel Wilson den antisemitischen Geist der Goethe-Gesellschaft zwischen 1933 und 1945 kennen. Die SZ freut sich über aus dem Nachlass herausgegebenen "Stimmen" von Wolfgang Herrndorf. Außerdem bespricht sie Kinderbücher und empfiehlt besonders einen kindertauglichen Bauhaus-Bildband. Die FR verdankt Louise Penny knallharte Krimikost aus Quebec. Und die NZZ reist mit Markus Ganz zurück zu den Seen und begegnet wundersamen Mischwesen.

27.09.2018 Warum der Glaube an die Schönheit des Universums fatal ist für die Physik, lernt die NZZ von Sabine Hossenfelder. Mit Maggie Nelsons "Bluets" verfällt sie der Farbe Blau. Die FAZ liest angeregt einen Sammelband mit Relektüren von zwanzig Klassikern der Holocaustliteratur. Die Zeit denkt mit Stuart Hall über das "Verhängnisvolle Dreieck" Rasse, Ethnie, Nation nach. Und taucht ab mit Guram Dotschanaschwilis so hochtraditonellem wie avantgardistischem Roman "Das erste Gewand".

26.09.2018 "Die Hoffnung stirbt am Bosporus": Yavuz Baydars Geschichte der Türkei von 1976-2016 liest sich für die FAZ als fesselndes Protokoll einer Desillusionierung. In der FAZ bespricht Stephan Wackwitz außerdem Mark Mazowers Geschichte seiner Familie, die zugleich einen Einblick in das untergegangene Judentum Osteuropas bietet. Die FR empfiehlt Gerhard Henschels "Erfolgsroman".

25.09.2018 Wie H.P. Lovecraft, nur besser geschrieben findet die FAZ Rasha Abbas' syrische Geschichten "Eine Zusammenfassung von allem, was war". Die SZ feiert Emil Ferris' innovativen, maßlosen und prall gefüllten Comic "Am liebsten mag ich Monster". Einen schönen Sinn für Dramatik und Atmosphäre attestiert die NZZ dem georgischen Autor Aka Morchiladse. Und die FR streift mit der Fotografin Maria Sewcz durch Istanbul.

24.09.2018 Warum soll das Drunter und Drüber nicht als poetisches Konzept taugen?, fragt die taz vergnügt nach Philipp Weiss' tausendseitigem Romandebüt "Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen". Suggestiv findet sie auch Danielas Dröschers auf Eribons Spuren wandelnden Essay "Zeige Deine Klasse". Die SZ überschreitet mit Dirk Baecker die Schwelle zur Epoche 4.0. Und die FAZ stellt neue Kinderbücher vor, berühtt ist sie von Nikola Huppertz' und Tobias Krejtschis Bilderbuch "Meine Mutter die Fee".

22.09.2018 Die SZ liest im neuen Buch des Historikers Timothy Snyder, wie Russland die westlichen Demokratien schwächt. Einer Russlandreise mit Honoré de Balzac kann sie trotzdem nicht widerstehen. Berührt lauscht die FAZ Frank Schulz' Erzählungen von "Anmut und Feigheit". Erschüttert, aber ohne Sympathie liest die Welt Briefe von Elias Canetti. Die taz verdankt der Künstlerin Patrizia Bach einen tiefen Einblick in Walter Benjamins Denkgebäude. Beeindruckt liest sie auch Sebastian Barrys Western "Tage ohne Ende".

21.09.2018 Die FAZ erliegt dem diskreten Charme der Anthropologie mit Irene Albers' Streifzug durch das Werk des Ethnologen Michel Leiris. Die NZZ versinkt lieber in Patrick Modianos "Schlafenden Erinnerungen" an das melancholische Paris der Sechziger. Die FR liest Bücher zum Dreißigjährigen Krieg und empfiehlt besonders Andreas Bährs Studie "Der grausame Komet".

20.09.2018 Die Zeit liest überwältigt Ursula Krechels Roman "Geisterbahn" über das Schicksal einer Schaustellerfamilie im Nationalsozialismus: Wie die Jelinek, meint sie. Die FAZ begibt sich mit Eckhart Nickel auf einen verschwörungstheoretischen Horrortrip mit Retroschick. Die SZ liest Tom Boumans Krimi "Im Morgengrauen" als Milieustudie über Pennsylvania. Und die FR legt Peter Reichels Biografie des Weimarer Reichskanzlers Hermann Müller nicht nur Politikern wärmstens ans Herz.

19.09.2018 Die NZZ empfiehlt nachdrücklich Christine Fischers Werkausgabe von Boris Pasternak, die ihr vor allem dessen lyrisches Werk näher bringt. Die FAZ liest Thomas Gaethgens Buch über den Brand der Kathedrale von Reims als lehrreiche Geschichte eines Kulturkampfes. Die SZ erkennt in Michal Hvoreckys Sci-Fi-Dystopie über das Trollunwesen im Internet die finstere Realität in Osteuropa.

18.09.2018 Die NZZ jubelt über den Abschlussband von Virginie Despentes' glitzernd-hyperrealistischer Vernon-Subutex-Trilogie, auch wenn in ihm Dogmatismus und Grausamkeit Oberhand gewinnen. "Schmerzhaft schöne Poesie" sieht die FAZ in Donatella DiPietrantonios Roman "Arminuta". Die FR lobt Hélène Gesterns Roman "Der Duft des Waldes". Und die SZ empfiehlt David Armitages instruktive Geschichte des "Bürgerkriegs".

17.09.2018 Die FAZ lauscht höchst vergnügt, wenn Claus Peymann Thomas Bernhards Tiraden gegen den österreichischen Kulturbetrieb liest. Die SZ unterhält sich prächtig mit Wolf Haas' hakenschlagendem Roman "Junger Mann". Max Czolleks Attacken auf diedeutsche Mehrheitsgesellschaft hakt sie als linke Vulgärversion identitären Denkens ab. Die taz liest etwas erschöpft Heinz Strunks dauerpessimistische Erzählungen "Das Teemännchen".

15.09.2018 Mit ihrem Roman aus der ostdeutschen Provinz eröffnet Kathrin Gerlof der SZ bleibende Bilder für diesen aufgeheizten Herbst. Schön viel Stoff zum Ärgern bieten ihr Jana Hensel und Wolfgang Engler mit ihrer Ostseelen-Erkundung "Wer wir sind". Die NZZ feiert Heinz Helles wunderschöne Brüdergeschichte "Die Überwindung der Schwerkraft". Die Welt bewundert den Hochmut in Alexa Hennig von Langes Achziger-Abrechnung "Kampfsterne". Die "Poets' Collection" zeigt ihr, dass Lyrik akustische Kunst ist. Und die FAZ widmet sich mit Ingrid Haslinger der "Wiener Küche".

14.09.2018 Die SZ lernt in Stephan Thomes Roman "Gott der Barbaren" eine Menge über den über den Taiping-Aufstand, aber auch über die Schwierigkeiten des Historischen Romans. In der FAZ erledigt Stephan Lessenich einen Bullshit-Job: nämlich die Rezension von David Graebers Buch gleichen Titels. Außerdem empfiehlt die SZ zwei Jugendbücher.

13.09.2018 Die Zeit lässt sich von Nicola Gardini und Andrea Marcolongo für die Schönheit und köstliche Präzision des Lateinischen und Altgriechischen begeistern. Die NZZ sieht uns mit Karl Pilny ins asiatische Jahrhundert steuern. Die FAZ sitzt mit Philipp Weiss "Am Weltenrand", lacht ein bisschen und weint ein bisschen. Die FR freut sich über Mercedes Rosendes herrlich unberechenbaren Kriminalroman "Krokodilstränen".

12.09.2018 Die NZZ lässt sich von Alex Capus nach Versailles versetzen, an den Hof Ludwigs XVI., wo sich ein armer Kuhhirte in eine reiche Bauerstocher verliebt. Eckhart Nickel wiederum lehrt sie mit "Hysteria" die Kunst des feinen Genusses. Die SZ freut sich über die stilistische Eleganz von Maxim Billers Roman "Sechs Koffer". Die FAZ amüsiert sich mit David Schalkos Ganovenroman aus dem Nachkriegswien, "Schwere Knochen".

11.09.2018 Die FAZ möchte nach Norbert Sachsers Buch "Der Mensch im Tier" wieder über Tierethik nachdenken. Mit Perry Andersons "Hegemonie" erkundet sie das Machtgebaren politischer Eliten. Die SZ lernt mit Frederika Finkelkraut das Leben paranoider Millennials in Paris kennen. Die NZZ nähert sich mit Gregor Mayer dem ewigen Kind Egon Schiele. Und die FR liest Juli Zehs neuen Roman "Neujahr".

10.09.2018 Die FAZ lernt von Achim Wambach und Hans Christian Müller, dass "Digitaler Wohlstand für alle" möglich ist, wenn die Macht der Internet-Konzerne eingeschränkt wird. Die SZ erkennt mit Behnam T. Saids "Geschichte al-Qaidas", dass auch weiterhin mit der Terrorgruppe zu rechnen ist. Etwas befremdet liest sie Ronan Farrows "Das Ende der Diplomatie" als Empfehlungsschreiben in eigener Sache.

08.09.2018 Juli Zeh hat mit "Neujahr" über die Überforderung eines Mannes beim Fahrradfahren in Lanzarote ihren bisher besten Roman vorgelegt, findet die SZ. Die FR entdeckt mit großer Freude Anita Brookners jetzt übersetzten Debütroman "Ein Start ins Leben". Die Welt empfiehlt Lukas Rietzschels Debütroman "Mit der Faust in die Welt schlagen" über eine Jugend in den neuen Ländern als Buch der Stunde.

07.09.2018 Die FAZ lässt sich von der jungen Bauingenieurin Roma Agrawal fasziniert in "Die geheime Welt der Bauwerke" einführen. Bei Franklin Foer liest sie, wie das Silicon Valley freies Denken und Selbstbestimmung bedroht. Die SZ bewundert mit Sonja Hnilica Großstrukturen in der Architektur der Moderne. Und die NZZ liest erschüttert Winnie M Lis Protokoll einer Vergewaltigung.

06.09.2018 Die FAZ amüsiert sich königlich mit Thomas Klupps Hochstapler-Provinzkomödie "Wie ich fälschte, log und Gutes tat". Die FR gruselt sich mit Jo Nesbøs Thriller-Version von "Macbeth". Die NZZ reist mit Martin Zimmermann zu den seltsamsten Orten der Antike. Die taz feiert mit Annett Gröschner fünfzig Jahre Berliner Frauenbewegung. Die Zeit liest zwei Jugendbücher über Vergewaltigung.

05.09.2018 Für die NZZ explodiert mit dem Wimmelbuch "Eins zwei drei VIELE" ein ganzes naturwissenschaftliches Museum. Die taz freut sich über einen Ostberliner "Spirou" von Flix. Die SZ denkt mit Perry Anderson über den Begriff der Hegemonie nach. Die FR entdeckt mit Luce D'Eramos Memoir "Der Umweg" einen Solitär in der Holocaust-Literatur. Empfehlenswert findet sie auch "Retroland", Valentin Groebners Buch über die Sehnsucht des modernen Touristen nach dem Authentischen.

04.09.2018 Die SZ jubelt über Eckhart Nickels ersten Roman "Hysteria", der vielleicht dekadent und reaktionär, aber vor allem von unanfechtbarer Eleganz sei. Die FAZ feiert Heinz Strunks auf die Spitze getriebenen Erzählungen "Das Teemännchen". Von Roberto Simanowskis Studie "Stumme Medien" lernt sie, wie Informiertheit an die Stelle der Bildung treten konnte. Die FR lässt sich von Ronald Weber Leben und Werk des großbürgerlichen Sozialisten Peter hHacks erklären. Und die taz empfiehlt noch einmal nachdrücklich Francesca Melandris brisanten Roman "Alle, außer mir".

03.09.2018 Einblick in ein zerrissenes Land erhält die FR mit Goran Vojnovics Roman "Unter dem Feigenbaum". Die taz blickt mit Mana Neyestanis düsterer Graphic Novel "Die Spinne von Maschhad" in die bigott-sadistischen Abgründe des Iran. Die SZ feiert mit "Spirou in Berlin" von Flix die erste nicht-frankophone Episode der reihe. Die FAZ liest Krimis, darunter Lisa McInnerneys "Glorreiche Ketzereien".

01.09.2018 Die SZ staunt, wie brillant David Christian Weltgeschichte vom Urknall bis zum Anthropozän auf 400 Seiten zusammenschnurren lässt. Die taz freut sich über einen vierzehnstündigen Tonbandschatz mit englischsprachiger Lyrik von Hemingway bis Atwood. Die Welt lernt von Paco Bacilieri, wie gut Umberto Eco und Kreuzworträtsel als Graphic Novel funktionieren. Einen neuen Puschkin entdeckt die FR mit der georgischen Schriftstellerin Ruska Jorjoliani. Und die FAZ liest Nino Haratischwilis neuen Roman "Die Katze und der General".
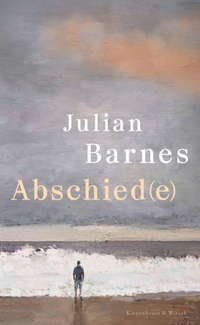 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)