
30.11.2011 Karl Heinz Bohrer überzeugt die NZZ mühelos von den Vorzügen des Selbstdenkens. Die FR empfiehlt Michael Martens Buch "Heldensuche" über einen deutschen Wehrmachtshelden, der keiner war. Die FAZ würde bis in alle Ewigkeit auf den Fußballstar Perlassi warten, solange Eduardo Sacheri über Torschüsse und Depressionen plaudert.

29.11.2011 Nicholas Shakespeare weiß genau, was er tut, frohlockt die SZ und folgt freudig dem Zickzackkurs seines Romans "Die Erbschaft". Sehr freundlich nimmt sie auch Christian Zehnders Debüt "Julius" auf. Die taz liest mit wachsendem Schrecken Rainer Becks Geschichte des Freisinger Hexenprozess von 1715 "Mäuselmacher oder die Imagination des Bösen".

28.11.2011 Als "vortreffliches Werk" lobt die FAZ Ian Kershaws Panorama des letzten Kriegsjahres "Das Ende". Die existentielle Not des kleinen Angestellten erlebt sie in Maurice Blanchots Roman "Der Aller-Höchste". Selbst Peter Gauweiler findet in der SZ Anton Pelinkas Plädoyer für Europa gar nicht so schlecht, dafür dass es Plädoyer für Europa ist.

26.11.2011 Die taz freut sich, dass mit Ottfried Dascher endlich jemand die längst fällige Biografie des Kunsthändlers und Verlegers Alfred Flechtheim geschrieben hat, in dessen Berliner Galerie sich in den zwanziger Jahren alles traf, was Rang und Namen hatte. Die NZZ liest Johan Huizingas Amerika-Bücher und meint: auch nach 85 Jahren noch von ungebrochener Relevanz. Die SZ versteht nicht, warum Julia Francks Roman "Rücken an Rücken" derart heftig verrissen wurde.

25.11.2011 Als Buch der Stunde empfiehlt die SZ Steven Uhlys Geheimdienstgroteske um durch- und rechtsdrehende V-Männer "Adams Fuge". Von Winfried Schröder lernt sie, dass "Athen und Jerusalem" überhaupt nicht zusammengehören, zumindest nicht philosophigeschichtlich. Die FAZ feiert mit Hans-Jörg Neuschäfers Einführung in die spanische Literatur die Rückkehr der Klassik in die Romanistik.

25.11.2011 Als Buch der Stunde empfiehlt die SZ Steven Uhlys Geheimdienst-Groteske "Adams Fuge". Von Winfried Schröder lernt sie, dass "Athen und Jerusalem" überhaupt nicht zusammenzugehören, zumindest nicht philosophiegeschichtlich. Die FAZ feiert mit Hans-Jörg Neuschäfers Einführung in die spanische Literatur" die Rückkehr der Klassik in die Romanistik und .

24.11.2011 In der SZ präsentiert Karl-Markus Gauß das Bollwerk der österreichischen Demokratie: den Falter-Reporter Florian Klenk, dessen wichtigste Reportagen in dem Band "Früher war hier das Ende der Welt" zu lesen sind. Die Zeit ist hellauf begeistert von Simon Urbans Roman "Plan D", in dem die DDR nicht untergegangen ist. Der FR imponiert Nuran David Calis' zorniger Roman "Der Mond ist unsere Sonne".

23.11.2011 Die SZ feiert Nino Haratischwilis Roman "Mein sanfter Zwilling" als groß, fremd und dunkel, ob ihn jeder aushalten wird, mag sie aber nicht sagen. Die NZZ betrachtet staunend Gundula Schulze Eldowys Fotos aus "Berlin in einer Hundenacht". Ganz schön schlucken muss sie bei Rainer Becks Geschichte des Kinderhexenprozesses von 1715 "Mäuselmacher oder die Imagination des Bösen". Die FAZ stellt die beiden amerikanischen Dichterinnen Mary Jo Bang und Matthea Harvey vor.

22.11.2011 Geschichtsrapport, Aberwitz und überbordende Fantasie: Die NZZ liest beeindruckt und begeistert Miljenko Jergovics neuen Roman "Wolga, Wolga". Außerdem stellt sie Antonio Lobo Antunes kataraktische Erzählung "An den Flüssen, die strömen" vor. Die FAZ erlebt in Anthony McCartens Roman "Liebe am Ende der Welt" extraterrestrische Erweckunsgerlebnisse. Die taz empfihelt nachdrücklich Klaus-Michael Bogdals Geschichte des Antiziganismus "Europa erfindet die Zigeuner".

21.11.2011 Die SZ schluckt eine bittere Pille, die ihr die ehemalige Weltbankerin Dambisa Moyo mit dem Buch "Dead Aid" verabreicht: Entwicklungshilfe fördert nicht den Wohlstand, sondern die Korruption. Die FAZ lernt von Jürgen Habermas' Essay "Zur Verfassung Europas", wie die Europäer selbstbestimmert werden können. In Sahra Wagenknechts "Freiheit statt Kapitalismus" findet sie weder Menschen noch Mehrheiten.

19.11.2011 Die FAZ hört eine ganze Reihe neuer und schöner Kleist-Hörbücher, aber keines kommt an die wilde, verwegene Lesung des neunzigjährigen Rolf Boysen heran. Außerdem freut sie sich über Hunter S. Thompsons ihrer Ansicht nach tiefsinnigstes Buch, den Roman "Der Fluch des Lono". Die NZZ liest den abenteuerlichen "Ameisenroman" des Insektenforscher Edward O. Wilson. Als brillantes Geschichtsbuch empfiehlt die taz Orlando Figes' "Kriemkrieg".

18.11.2011 Die Literaturkritik ist schon im Wochende: Die FAZ zieht mit dem Helden von Imran Ayatas Roman "Mein Name ist Revolution" durch Berlins Kneipen. Die FR rätselt nach Marc Degens' Roman über Literatur und Betrieb "Das kaputte Knie Gottes", wer hier wen vorführt.

17.11.2011 Die NZZ folgt fasziniert Iris Meders Streifzug durch die Bädergeschichte Mitteleuropas. Evelyn Schlags Roman "Die große Freiheit des Ferenc Puskas" lässt sie die Macht des Zufalls spüren. Die Zeit verliert sich mit Begeisterung in Wolfgang Herrndorfs "Sand". Sehr empfehlen kann die FAZ Christian Stöckers Führer durch die digitale Welt "Nerd Attack!".

16.11.2011 Die NZZ freut sich, wie unsentimental Norbert Scheuer in seinen Gedichten "Bis ich dies alles liebte" die Eifel besingt. Außerdem frohlockt sie: Das geheime Tagebuch des Herzog von Croy "Nie war es herrlicher zu leben" hat kein Höfling geschrieben, sondern ein Aufklärer! Die FAz ist nachhaltig verstört von Andre Pilz' Drogenroman "Man down". Allen Ärzten, die sich nicht von der Pharmalobby umarmen lassen wollen, empfiehlt sie den Band "Interessenkonflikte in der Medizin".

15.11.2011 Kunst für Sex? Die SZ lernt in Winfried Menninghaus' Buch "Wozu Kunst?" alles über Ästhetik nach Darwin und die ganze Wirklichkeit der Kultur. Kalt und existenziell erwischt es die taz bei der Lektüre von Wolfgang Herrndorfs Roman "Sand". Die NZZ rät dringend, Petur Gunnarssons intelligenten und witzigen Roman "punkt punkt komma strich" zu lesen. Außerdem macht sie sich mit Jürgen Habermas auf in die Weltbürgergesellschaft.

14.11.2011 Intellektuellen Irrwitz macht die FAZ in Ermanno Cavazzonis "Kleinem Buch der Riesen" aus und ist begeistert. Außerdem stellt sie Werner Abelshausers "Deutsche Wirtschaftsgeschichte" vor. Die SZ liest Erhard Epplers neuestes Brevier "Eine solidarische Leistungsgesellschaft".

12.11.2011 Spionagethriller, Melodram, postkolonialer Gesellschaftsroman? Jedenfalls ist Wolfgang Herrndorfs neuer Roman "Sand" ein "grandioses Spiel der Mehrdeutigkeiten", meint die FAZ. Die NZZ unterhält sich bestens mit den Autoreninterviews der Paris Review. Die taz geht mit Ian Kershaw bis zum Ende. Und die FR bewundert Nicolas Mahlers Comicvariation auf Thomas Bernhard.

11.11.2011 Die NZZ präsentiert Gemma Bovery, unglücklich verheiratete Frau in der französischen Provinz. Die FAZ bewundert die barocke Ausdruckskraft der Kinnfalten, die Alexandra Kardinar und Volker Schlecht dem "Fräulein von Scuderi" verleihen. Sehr gern gelesen hat sie auch Jan Böttchers Roman "Das Lied vom Tun und Lassen". Bewegt folgt die SZ Hector Abad auf seiner Spurensuche nach einem Borges-Poem "Das Gedicht in der Tasche".

10.11.2011 Als heillos überdreht und sehr zukunftsweisend feiert die Zeit Douglas Couplands Roman "JPod". Als Buch der Stunde legt sie uns auch Jürgen Habermas' Essay "Zur Verfassung Europas" sehr ans Herz. Die FAZ empfiehlt J.G. Ballards Autobiografie "Wunder des Lebens", die selbst vom Kulturbetrieb im gelassenen Ton erzählt. Berührt liest sie Ana Maria Matutes Roman "Unbewohntes Paradies" über ein ungeliebtes Kind.

09.11.2011 Von der Menschenfreundlichkeit der Halbwelt lernt die SZ in Steve Earles Roman im Country-Sound "I'll Never get Out of This World Alive". Wie kleine Kriege ein Weltreich zermürben, erfährt die NZZ in Stefan Smids Geschichte des "Spanische Erbfolgekriegs". Außerdem liest sie gerührt Klaus Manns Briefe an seinen "Lieben und verehrten Onkel Heinrich".

08.11.2011 Bewegt liest die FR den tragischen Briefwechsel zwischen Joseph Roth und Stefan Zweig "Jede Freundschaft ist mir verderblich". Die NZZ liest mit Begeisterung die mitunter hoffnungslos redundanten, überladenen und formsprengenden Erzählungen "Alles ist grün" von David Foster Wallace. Die SZ wagt den "Vorstoß ins Innere" und streift durch die Sammlungen des Naturkundemuseums.

07.11.2011 Gelehrt, erfrischend und sehr lässig findet die SZ Jan Wagners Essays über Lyrik "Die Sandale des Propheten". Sehr empfehlen kann sie auch Frederick Taylors kühlen Blick auf die Besatzungszeit "Zwischen Krieg und Frieden". Die FR verdankt Svenja Flaßpöhlers Polemik "Wir Genussarbeiter" die Einsicht, dass wir schon allein deshalb gern arbeiten müssen, da sie uns alle anderen Freuden verboten haben.

05.11.2011 Künstlerische Avantgarde, Paris, 20er Jahre - und mittendrin Kiki de Montparnasse, die Jose-Luis Bocquet und Catel Muller zur Freude der FR jetzt in einem Comic verewigt haben. Die NZZ liest mit gespitzten Ohren den Reisebericht Christoph Carl Fernbergers, der 1624 zu einer Weltreise gepresst wurde. Die SZ liest Jocelyn Maclures und Charles Taylors Buch über "Laizität und Gewissensfreiheit". Die FAZ hört Robert Walsers "Im Bureau". Die taz durchlebt mit Bärbel Bohleys "Englischen Tagebuch 1988" noch einmal den Mauerfall.

04.11.2011 Die FAZ durchbricht die Mauern der Schwerverständlichkeit und widmet sich ausführlich der Lyrik des Sizilianers Salvatore Quasimodo. Etwas strapaziös, aber sehr beeindruckend findet sie Elias Khourys Beirut-Roman "Yalo".

03.11.2011 Sehr einverstanden ist die taz mit Eva Illouz' Buch "Warum Liebe weh tut" und ihrem Plädoyer gegen Ironie und für die Leidenschaft. Die NZZ lernt in Lars Gustafssons "Gegen Null" unter anderem, dass sich Exzellenz nicht planen lässt. Die FAZ rühmt Klaus Merz für seine Gedichte "Aus dem Staub" als einen Meister der Verknappung. Und die SZ lässt sich vom Archäologen Andreas Schachner in die Hethiterstadt "Hattuscha" führen.

02.11.2011 In der FAZ stellt Harald Hartung den italienischen Dichter Mario Luzi (1914-2005) vor, der Gewalt, Konvention, Mode und Markt verabscheute und glaubte: "Das Leben wird geboren zum Leben, / das ist das Ereignis, das / ist seine einzige Wahrheit." Die FR versinkt in Don Winslows Drogenkrimi "Zeit des Zorns". Die NZZ warnt Leser mit empfindlichem Magen vor Thomas Jeiers ausgezeichneter Geschichte der Indianer. Die taz findet in Dirk von Gehlens "Mashup. Lob der Kopie" einen neuen Begriff des Originals.

01.11.2011 Lesen und Hören kann man Ilse Aichinger mit dem Interviewband "Es muss gar nichts bleiben", freut sich die FAZ. In Gerlind Reinshagens Roman "Nachts" packt ein alter Mann am Telefon aus, und die FR hört gebannt zu. Die NZZ trauert um Tine, die sich in Herman Bangs 1889 erschienenem gleichnamigen Roman um Kopf und Kragen liebt.
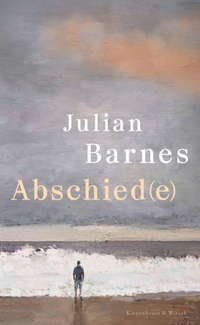 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)