
31.03.2011 Die SZ liest bewundernd Milan Kunderas kunstvolle Essays über Literaten und Romane, besonders imponiert ihr die Ehrenrettung von Anatole France. Als großen New-York-Roman preist die Zeit Jonathan Lethems "Chronic City". Unbeschädigt übersteht sie E.M. Ciorans Artikel "Über Deutschland" aus den Jahren 1933-37 und schließlich flaniert sie mit Franz Hessel durch Berlin. Die FAZ wird mit Suelette Dreyfus' Roman "Underground" über den jungen Hacker Julian Assange nur halb froh.

30.03.2011 Mit angehaltenem Atem liest die NZZ Jan Karskis "Bericht an die Welt", der nach 67 Jahren zum ersten Mal auf Deutsch erscheint. Karski berichtet darin, wie er als Kurier des polnischen Untergrunds kämpfte und sich unter anderem ins Warschauer Ghetto schleusen ließ. Die SZ stellt staunend fest, dass ausgerechnet D.H. Lawrence dem Sex wieder ein Geheimnis gibt, und zwar in seinem Roman "Söhne und Liebhaber". Die FAZ verfolgt gespannt, wie Ian Morris den kommenden Kampf um die Weltherrschaft zwischen Ost und West ausgehen lässt.

29.03.2011 Die SZ reist mit Xavier de Maistre um dessen Zimmer und staunt, wie viel Welt sie darin entdeckt. Gebannt folgt sie auch Najat El Hachmis Erzählung "Der letzte Patriarch" über ein Scheusal von einem Vater. Die NZZ entdeckt eine würgend spürbare Verlorenheit in Clemens Setz' Erzählband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes". Die FAZ liest James Palmers Biografie "Der blutige weiße Baron".

28.03.2011 Peter Handke ist in die Stadt zurückkehrt, meldet die SZ erfreut nach Lektüre seiner neuen Erzählung "Der Große Fall" . Als romantisches, offenes Kunstwerk empfiehlt die FR Wolfgang Schlüters Roman "Die englischen Schwestern". Die FAZ wandelt mit Fontane durch Berlin und wundert sich, dass Rafael Seligmanns Leben nur eine einzige Autobiografie ergeben hat.

26.03.2011 Gegen erste Widerstände erliegt die FAZ Najat El Hachmis wunderbarem Roman "Der letzte Patriarch": Erstaunlich heiter findet sie ihn auch, erzählt er doch von einem Vater allerübelster Sorte. Noch großartiger als Thomas Wolfes Klassiker "Schau heimwärts, Engel" erscheint ihr Christian Brückners Lesung desselben. Die SZ liest fasziniert Gregor Hens' Essay über Genuss und Sucht, "Nikotin". Die NZZ liest Wassili Grossman.

25.03.2011 Voller Begeisterung liest die FAZ die von Karl Corino herausgegebenen "Erinnerungen an Robert Musil", aber auch als bittere Lektion über schriftstellerischen Narzissmus. Als eines der klügsten Geschichtsbücher über die napoleonische Zeit preist die SZ Theodor Fontanes Befreiungsroman "Vor dem Sturm". Sehr berührt hat sie auch Gilles Leroys "Zola Jackson".

24.03.2011 Die Zeit empfiehlt - trotz allem - Hubert Manias Buch "Kettenreaktion", das die Geschichte der Atomenergie als enthusiastischen Wettlauf der WissenschaftlerInnen beschreibt, die sich an selbstmörderischen Experimenten gegenseitig übertrafen. Auf "Müller MP3" erlebt sie einen weise vor sich hin brabbelnden Schamanen. "Müller Die SZ attestiert Orhan Pamuk, sich für seinen lange unterm Tisch gehaltenen Erstling "Cevdet und seine Söhne" keinesfalls schämen zu müssen. Die FR liest beeindruckt Herta Müllers Essays "Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel".

23.03.2011 Erstaunlich, wieviel einem die
Toten erzählen können, findet die
FAZ nach der Lektüre von
Richard Cobbs "Die Leichen der Seine" (
Leseprobe). Die
NZZ liest
David Shields' Manifest "Reality Hunger" (
Leseprobe), wird aber nicht satt. Die
SZ ist arg enttäuscht von den Memoiren
Alfred Grossers. Die
FR empfiehlt
Aris Fioretos' neuen Roman "Der letzte Grieche".

22.03.2011 Die NZZ beobachtet gespannt wie Joseph Zoderer in "Die Farben der Grausamkeit" den Ausbruch aus einem Doppelleben organisiert. Die FAZ reist mit Werner Köhler drei Tage ins Paradies. Die NZZ bewundert Clothilde Schlayers Entschiedenheit im politischen Disput mit Stefan George (die George-Jünger dagegen stehen starr und schweigend).

21.03.2011 Sehr beeindruckt liest die SZ David Vanns erbarmungslosen Roman "Im Schatten des Vaters". Gewohnt engagiert stellt sie politische Jugendbücher vor, zum Beispiel Anne-Laure Bondoux' Geschichte einer Flucht "Die Zeit der Wunder". Die FAZ reist in das Rom des Pier Paolo Pasolini. Und in das Paris der Liebe, Moden und Tete-a-Tetes.

19.03.2011 Die taz hat mit William Dalrymples Reportagenband "Neun Leben" einen faszinierenden Einblick in das vielgesichtige religiöse Leben Indiens gewonnen. Die FAZ und die FR loben Neuauflagen bekannter Autoren: Die FAZ empfiehlt Per Olov Enquists Dokumentarroman "Die Ausgelieferten" von 1968. Die FR liest Richard Price' ersten Krimi "Clockers" von 1992.

18.03.2011 In Siri Hustvedts Roman "Der Sommer ohne Männer" verbringt eine betrogene Ehefrau den Sommer bei ihrer Mutter. Doch daraus wird kein Betrogenenroman, sondern ein subtiles, boshaftes und herzenswarmes Frauenbuch, lobt die FAZ. Gespenstisch aktuell findet die FR Rüdiger Lubrichts Fotografien rund um Tschernobyl. Die SZ erkennt in Salman Rushdies Roman "Luka und das Lebensfeuer" die blanke Mordlust des Autors.

17.03.2011 Großer Text, meint die SZ über Dave Eggers' Reportageroman "Zeitoun". Die FAZ vertieft sich mit Gewinn in Bernd Schneidmüllers Geschichte des spätmittelalterlichen Europas. Bei Clemens J. Setzs Erzählband "Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes" spitzt sie erst das Mündchen, muss dann aber zugeben: Schreiben kann er.

16.03.2011 Die NZZ bringt eine Hommage von Katharina Hacker auf Anna Maria Jokl. Die taz begibt sich mit Richard Kämmerlings auf die Suche nach einem Kanon der Gegenwart. In der Zeit bewundert Jana Hensel die unerbittliche Klarheit der Bärbel Bohley. Die FAZ empfiehlt wärmstens Sybille Bedfords Reportage über den Prozess gegen Stephen Ward, der eine wichtige Rolle in der Profumo-Affäre spielte.

15.03.2011 Die
NZZ freut sich über die späte Übersetzung von
Jean-Pierre Abrahams düsterer Schilderung des Lebens auf einem weit entlegenen
Leuchtturm der Bretagne (
Leseprobe "Vorgeblättert" hier). Die
SZ lobt
Milovan Danojlics Roman "Mein lieber Petrovic". Die
FR lobt das Talent und tadelt die Jugend des
Clemens J. Setz. Die
FAZ kriecht mit der polnischen Putzfrau
Justyna Polanska "Unter deutsche Betten".

14.03.2011 Die SZ freut sich über Philipp Bloms "Böse Philosophen", die schon im 18. Jahrhundert nicht an Gott glaubten. Sehr bewundert sich auch das präzise Arrangement, die Kunst der Komprimierung in Peter Stamms Erzählband "Seerücken". Die FAZ hat Michael Kempes Buch "Fluch der Weltmeere" über Piraterie und Völkerrecht gelesen und freut sich, dass endlich mal einer den Schmittianern widerspricht.

12.03.2011 Michel Houellebecq ist weise geworden - aber nicht platt kommerziell. Die FAZ liegt ihm zu Füßen. Außerdem empfiehlt sie dringend Andrea Böhms Reportagen aus dem Kongo. Die SZ freut sich sehr über die Neuausgabe von Hans Falladas Roman "Jeder stirbt für sich allein". Die NZZ bringt kurz vor der Leipziger Messe eine Menge Besprechungen zu serbischer Literatur. Die FR stirbt bei Karl Ove Knausgards Roman "Sterben" auch. Aber an "Logorrhö".

11.03.2011 Atemlos liest die FR Jan Karskis "Bericht an die Welt". Karski hatte 1942/43 die Alliierten über die Vernichtung der Juden informiert, nachdem er mehrmals ins Warschauer Ghetto und in ein Vernichtungslager eingeschleust worden war. Die SZ findet Friedrich Wilhelm Grafs Kritik an den Kirchen in Deutschland ein wenig zu stark: jedenfalls soweit es die protestantische Kirche angeht. In der FAZ der Mediziner Michael Hagner und der Dichter Dirk von Petersdorff ein Buch des Dichters Raoul Schrott und des Psychologen Arthur Jacobs, "Gehirn und Gedicht".

10.03.2011 Die Zeit bestaunt Clemens J. Setz und fragt sich unsicher: Ist der echt? An Thomas Webers Studie über Hitler im Ersten Weltkrieg interessiert sie vor allem das neue Quellenmaterial. Die NZZ folgt mit Andrea Amort den Spuren der kommunistischen Tänzerin Hanna Berger. Die FR zieht den Hut vor Joseph Zoderer.

09.03.2011 Die SZ empfiehlt zwei Bücher zu Hannah Arendt: Den Band "Eichmann war von empörender Dummheit" mit Briefen und Gesprächen zwischen Hannah Arendt und Joachim Fest sowie Marie-Luise Knotts essayistischen Band "Verlernen - Denkwege bei Hannah Arendt". Die NZZ lässt sich von der alterslosen Schönheit der Gedichte Mario Luzis betören. Die FAZ lernt einiges über die Aufgabe des Kritikers aus Richard Kämmerlings Band über die deutschsprachige Literatur seit 1989, "Das kurze Glück der Gegenwart".

08.03.2011 Die
FAZ dankt
Julia Schoch für die Entdeckung
Georges Hyvernauds, der in seinem Heimkehrerroman "Haut und Knochen" einen Antihelden in der Tradition
Sartres und
Celines beschreibt. Die
FR liest mit einigem Vergnügen Arnon Grünbergs Roman "Mitgenommen" über einen
Berufskiller mit Familie und
Swimmingpool. Setzt
Maßstäbe, meint die
NZZ über
Julian Schütts Frisch-Biografie (
Leseprobe).
Sexismus ist längst wieder salonfähig, stellt
Natasha Walter in "Living Doll" fest. Die
SZ hofft, dass das nur für Großbritannien gilt - auch wenn das
deutsche Cover des Buchs ihr das Gegenteil sagen müsste.

07.03.2011 Die SZ hat mit Jonathan Lethems "Chronic City" DEN New-York-Roman der Nullerjahre gelesen. Die FAZ hört in Damian Tabarovskys "Medizinischer Autobiografie" einen ganz neuen Ton, nicht zuletzt in der lateinamerikanischen Literatur, und kein Tango nirgends. Gut besprochen wird auch Stephan Ruderers Untersuchung über "Das Erbe Pinochets" und Hermann Rumschöttels Biografie Ludwigs II. von Bayern.

05.03.2011 Die FAZ versenkt sich in die durch und durch wunderbaren Gedichte John Ashberys. Einfach atemberaubend findet die FR neunzehn bisher nicht übersetzte Geschichten von Joyce Carol Oates. Brillante Sprachexperimente beglücken die SZ in Aris Fioretos' Roman "Der letzte Grieche". Die taz freut sich über Thomas Willmanns von Ludwig Ganghofer und Sergio Leone gleichermaßen inspirierten Krimi "Das finstere Tal".

04.03.2011 Sehr sympathisch ist der FR Uwe Timms sanft-ironische Arno-Schmidt-Novelle "Freitisch". Der FAZ gefällt David Gilmours Roman über das Abschiednehmen "Die perfekte Ordnung der Dinge". Und die SZ erinnert sich mit Roberto Cotroneo an den italienischen Terrorismus und "Die Jahre aus Blei".

03.03.2011 Absolut berückend findet die FAZ Fredrik Sjöbergs Buch "Der Rosinenkönig" über den Regenwurmforscher, Avocadozüchter und Glasperlensystematiker Gustav Eisen. Sehr empfehlen kann sie auch die "Kindheitshefte" der argentinischen Autorin Norah Lange und den Drehbuch-Almanach "Scenario 5". Die NZZ rühmt den fulminanten Erzähler Catalin Dorian Florescu und seine Familiensaga aus dem Banat "Jacob beschließt zu lieben". Die Zeit begrüßt Heinrich Steinfests Krimi "Wo die Löwen weinen" als scharfe Waffe im Kampf gegen Stuttgart 21.

02.03.2011 Nur nicht von dem süffigen Cover täuschen lassen, rät die SZ: Eher ziemlich bitter erzählt Alon Hilus Roman "Das Haus der Rajanis" Tel Avivs palästinensische Vorgeschichte. Die FAZ liest mit Freude Ivan Nagels gesammelte "Schriften zum Dramen". Eingenommen berichtet sie auch von Robert Schopflochers Lebenserinnerungen "Weit von wo".

01.03.2011 Von der Wirklichkeit doppelt überholt ist heute die Guttenberg-Biografie von Eckart Lohse und Markus Wehner erschienen, die taz fand sie dennoch sehr instruktiv. Die FR unterhält sich blendend mit Silke Scheuermanns coolem Roman aus der Kunstwelt "Shanghai Performance". Ganz verzaubert ist die NZZ von Eleonore Freys poetischem Roman "Aus der Luft gegriffen".
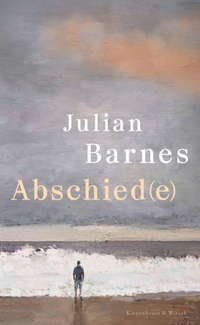 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)