
31.01.2017 1250 Seiten stark, aber als kunstvolles Katz- und Mausspiel ein echter Paul Auster, versichert die FR nach Lektüre des neuen Romans "4 3 2 1". Als klug und gelehrt empfiehlt die SZ Klaus Birnstiels Geschichte des Poststrukturalismus "Wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand". Sehr ger gelesen hat sie auch Saphia Azzedines "Bilqiss". Mit "Sieben Küssen" von Peter von Matt taumelt die NZZ beglückt von der Weltliteratur mitten ins Dasein. Und die FAZ versichert: Laszlo Darvasis Erzählungen "Wintermorgen" sitzen wie Faustschläge.

30.01.2017 Die SZ blickt mit Joachim Radkau in die "Geschichte der Zukunft" und erkennt darin eine Abfolge reiner Irrtümer. Ulrich Becks "Metamorphose der Welt" eröffnet ihr das Zeitalter der Nebenfolgen. Die FAZ reist mit der Maus Armstrong zum Mond und lernt, Fallen entgeht. Gut gefallen hat ihr auch Ursula Poznanskis Jugendroman "Elanus" über eine kleine unsoziale Intelligenzbestie, die ihre Rivalen mit Drohnen ausspioniert.

28.01.2017 Ein wenig mehr als ein wenig Leben bringt Hanya Yanagiharas Roman "Ein wenig Leben" in die deutsche Literaturkritik. Heute gleich drei Besprechungen. Nur die FR will nicht völlig in die Hymnen einstimmen. SZ und taz besprechen mit Charles Jacksons "Die Niederlage" und Rafael Chirbes' "Paris-Austerlitz" zwei Romane über Homosexualität. In der NZZ schreibt Jan-Werner Müller über Timothy Garton Ashs Buch "Redefreiheit".

27.01.2017 Ein gespenstisches Meisterstück ist Varujan Vosganians Roman "Das Spiel der hundert Blätter" für die SZ. Als eloquent und quellensatt lobt sie außerdem Hubert Wolfs "Konklave" über die Geheimnisse der Papstwahl. Die FAZ lernt mit Habbo Knoch das Grandhotel als Laboratorium der Moderne und mit Andrew Pettegree Martin Luther als geschickten Marketingstrategen kennen.

26.01.2017 Wer Bartok, Nono oder Ligeti hasst, dem legt die SZ wärmstens das informative Lexikon Neue Musik ans Herz. Allen anderen sowieso. Großes Lob auch für Michael Lewis, der mit seinem Buch über die Freundschaft von Daniel Kahneman und Amos Tversky einen brillanten und abenteuerlichen Einstieg in die Verhaltensöknomie liefert. Die FAZ zieht den Hut vor den Betrachtungen des großen Imre Kertesz. Die NZZ lernt mit zwei Neuübersetzungen Dostojewski als rotzfrechen Aufwiegler kennen. Die FR empfiehlt Otfried Höffes Einlassungen zur Geschichte des politischen Denkens.

25.01.2017 Die FAZ blickt mit Alexander Goldtstein in Parallelgeschichten von Baku aus auf die Brüche des russischen Imperiums. Die NZZ lernt mit Andreas Kraß, einen Freund zu lieben. Die SZ liest Louis-Philippe Delamberts Kurzgeschichten aus Haiti. Die Welt hängt mit Patrick McGinley an einer irischen Theke ab.

24.01.2017 Als wunderbaren Roman über Fall und Zufall, Feststellung und Vorstellung lobt die FAZ Jan Kuhlbrodts Künstlergeschichte "Das Modell". Außerdem lernt sie von Barry Cunliffe, wie Europas Dörfer zu Metropolen wurden. Die SZ reist mit Ales Steger durch die Gegenwart und von Ljubljana nach Fukushima. Die FR liest "Die Briefe der Manns".

23.01.2017 Hin- und mitgerissen ist die FAZ von der dunklen poetischer Kraft des H.G. Wells, dessen große SciFi-Romane zwei neue Hörbücher sehr suggestiv in Szene setzen. Außerdem lässt sie sich von Giacomo Casanova gern noch einmal die Kunst der Verführung erklären. Die SZ staunt, wie körperorientiert Thomas Meinecke in seinem neuen Roman "Selbst" schreibt.

21.01.2017 Als Buch der Stunde empfiehlt die NZZ Alberto Barrera Tyszkas Hugo Chávez-Roman "Die letzten Tage des Comandante". Die taz begrüßt Kristine von Sodens Collage aus Berichten von aus Nazideutschland geflüchteten Jüdinnen als überfällige Ergänzung zu den männlichen Narrativen. Mit "Die lachenden Ungeheuer" hat Denis Johnson einen postfaktischen Spionagethriller vorgelegt, staunt die SZ. Und die Welt geht vergnügt mit Albrecht Selge auf "Trunkene Fahrt".

20.01.2017 So atemlos liest die FR Simon Becketts neuen Thriller "Totenfang", dass sie schon mal ein paar Seiten überblättert. Die FAZ freut sich über Michael Sommers Ereignis- und Strukturgeschichte des antiken Syriens und Nilüfer Göles Studie "Europäischer Islam". Und die SZ liest mit großem Gewinn John Burnsides Gedichtband "Anweisungen für eine Himmelsbestattung" sowie Jugendsachbücher über die Arbeitswelt und die Technik der Alpen.

19.01.2017 Die NZZ reist mit Ottessa Moshfeghs saufendem Seemann McGlue ins Salem des 19. Jahrhunderts. Der SZ wird ganz melancholisch mit Peter Henischs kleinem Peter im Wien der Nachkriegszeit. Die Zeit lernt von Elena Ferrante, was es heißt Mensch zu sein, erlebt erektile Momente von ewiger Gültigkeit mit Kurt Drawerts Langgedicht "Der Körper meiner Zeit" und streift mit Jörg Sundermeier durch die Sonnenallee.

18.01.2017 Die FAZ untersucht mit Philipp Schönthalers Essay "Porträt des Managers als junger Autor" das Verhältnis von Literatur und Wirtschaft. NZZ und SZ unterhalten sich gut mit Martin Suters Roman "Elefant" - wenn auch literarisch nicht auf Niveau, wie die NZZ anmerkt. Die SZ vertieft sich in die "Totale Religion" Jan Assmanns.

17.01.2017 Die FAZ lernt von Alexander Gallus, warum die Hoffnungen, die die Deutsche Studienstiftung in "Meinhof, Mahler, Ensslin" setzte, sich nicht ganz, ähem, erfüllten. Gelungen findet sie allerdings, wie Mathias Rohe in "Der Islam in Deutschland" Bedürfnisse von Religion und Rchtsstaat abwägt. Als ein Lehrstück der Herzensbildung liest die FR Astrid Lindgrens Briefe "Ich habe auch gelebt!". Die taz erinnert sich mit Avi Pitchons "Rotten Johnny and the Queen of Shivers" an Punk in Israel.

16.01.2017 Schön grotesk und also ganz fabelhaft findet die SZ David Foster Wallace' wiederaufgelegte Reportage über die Pornoindustrie "Der große rote Sohn". Viele pragmatische Einsichten zum Leben und zum Schreiben entnimmt die taz Selma Lagerlöfs Briefen "Liebe Sophie, liebe Valborg". Die FAZ blickt auf die neuen Megastädte, die nicht mehr Wohlstand für alle verheißen.

14.01.2017 Die SZ feiert den zweiten und dritten Band von Michail Ossorgins Trilogie über die russische Revolution, in deren Mittelpunkt eine kommunistische Attentäterin aus gutem Hause steht. Außerdem empfiehlt sie Lyonel Trouillots eleganten Haiti-Roman "Yanvalou für Charlie". Wohin das Postfaktische führt, lernt die Welt in Korea mit Anna Kims Roman "Die große Heimkehr". Die FAZ amüsiert sich mit Wolfgang Seibels "Verwaltung verstehen".

13.01.2017 Zum 300. Todestag von Maria Sibylla Merian lesen FAZ und SZ mit großem Gewinn Barbara Beuys' Biografie der Künstlerin, Insektenforscherin und Geschäftsfrau. Sehr empfehlen kann die FAZ auch Rolf Lindners Großstadtbetrachtung von Berlin um 1900 und die scharfzüngige Islamkritik Samuel Schirmbecks. Die NZZ begegnet in Noam Chomskys "Was für Lebewesen sind wir?" dem besseren Amerika. Und die FR stürzt durch die Falltüren in Andrew Michael Hurleys Debutroman "Loney".

12.01.2017 Die SZ lässt sich von den frühen Farbfotografien Fred Herzogs zurückversetzen in die Barbershops, Rummelplätzen und Cadillacs im Vancouver der Fünfziger. In der NZZ empfiehlt Felix Philipp Ingold die Lyrik Kandinskys, aber nicht unbedingt die Ausgabe, in der sie präsentiert wird. Die FAZ feiert Juan Gomez Barcenas Romandebüt "Himmel von Lima". Der Zeit wird bei Thomas Meinecke postgenderbedingt schwindlig.

11.01.2017 Die taz erinnert mit Robert Hillburn an einen der Musiker, die glaubten, sie könnten mir ihrer Musik die Welt verändern: Johnny Cash. Außerdem bewundert sie die Beiläufigkeit des Komischen bei Otto Jägersberg. Amitva Ghosh scheitert laut FAZ bei dem Versuch, den Opiumkrieg zu erzählen. Und bei Margaret Atwood ist das Alter nicht nur unaufhalt-, sondern auch unterhaltsam, findet die SZ.

10.01.2017 Kulturelle Tiefenschärfe erblickt die NZZ in Teju Coles Essay über die Fotografie "Vertraute Dinge, fremde Dinge". Die FAZ lernt von Regina Frisch, dass nach dem Bayerischen Kochbuch schon immer von der Schnauze bis zum Schwanz gegegessen wurde. Die SZ blättert verzaubert durch "Walt Disney Filmarchives", die Daniel Kothenschulte mit einem klugen und vergnüglichen Prachtband würdigt.

09.01.2017 Ein großes Verlangen nach Sinn verspürt die SZ in John Bergers leidenschaftlichen Essays "Der Augenblick der Fotografie". Außerdem empfiehlt sie Rena Molhos fundierte Studie über die Vernichtung der griechischen Juden Deutschen so nachdrücklich wie Griechen. Die FAZ lobt noch einmal Liza Codys bereits viel gefeierten Roman "Miss Terry".

07.01.2017 Einen schöneren Nachruf hätte sich niemand wünschen können, seufzt die FAZ zwei Jahre nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo über Maryse Wolinskis Erinnerung an ihren Mann, den Zeichner Georges Wolinski. Die taz empfiehlt noch einmal Catherine Meurisse gezeichnete Traumbewältigung "Die Leichtigkeit". Die NZZ liest mit angehaltenem Atem Adriaan van Dis' schonungslosen Roman "Das verborgene Leben meiner Mutter". Außerdem stürzen sich FAZ, SZ und taz auf den zweiten Band von Elena Ferrantes Neapel-Saga "Die Geschichte eines neuen Namens".

06.01.2017 Mit der siebenbändigen Werkausgabe der Feuilletons des Wiener Sprachkünstlers Anton Kuh hat Walter Schübler eine editorische und detektivische Großtat vollbracht, die man nicht hoch genug rühmen kann, jubelt die FAZ. Relevant und verdienstvoll findet sie auch neue Bücher von Jon Krakauer und Mithu M. Sanyal, die sich mit dem Thema Vergewaltigung befassen. Die FR amüsiert sich bestens mit dem Band "Ballverliebt" mit Jochen Schmidts von Flohmarkt-Fotos angestoßenen Improvisationen zum Fußballglück.

05.01.2017 FAZ und SZ nähern sich dem neuen Walser: Die FAZ bleibt kühl, die SZ muss lachen. Die Welt begutachtet mit Kommissar Kluftinger drei Leichen auf dem Himmelhorn. Die Zeit stellt sich mit Klaus von Stosch der "Herausforderung Islam" und feiert die Prosaminiaturen von Botho Strauss.

04.01.2017 Glaubt man Karl-Markus Gauß in der SZ, dann sollten sich alle begeisterten Leser schleunigst Miroslav Krležas fünfbändiges Epochenpanorama "Die Fahnen" besorgen. Die NZZ ist befremdet, aber irgendwie auch begeistert von Martin Walsers neuem Roman (wenn man so sagen kann) "Statt etwas". Die FAZ empfiehlt Bret Anthony Johnstons psychologischen Thriller "Justins Heimkehr" und ein Buch über Pegida.

03.01.2017 Ganz verzaubert geht die FAZ mit Jiri Mahen auf Mondfahrt und erkundet in böhmischen Regenbogenschlössern den tragischen Poetismus. Für seine "Stasis"-Schrift bescheidet sie Giorgio Agamben streng: Die Zeit des "Antiliberalismus aus Langeweile" ist vorbei. Die geheime Meisterin von Le Corbusier lernt die NZZ in seinem Brevier über Algier kennen. Und die taz wandelt mit Manuele Fior durch die traumhaft schönen Hallen des Musée d'Orsay.

02.01.2017 Ein Buch über Oriana Fallaci ist ohne Pathos gar nicht möglich, weiß die SZ und lässt sich daher Cristina de Stefano Biografie der großen, wenn auch zerrissenen Reporterin gern gefallen. Empfehlen kann sie auch Muriel Asseburgs und Jan Busses Brevier zum "Nahostkonflikt", dessen Lösung natürlich auch in diesem Jahr nicht näherrücken wird. Die FR folgt ein letztes Mal John Harveys Inspector Charlie Resnick, diesmal "Unter Tage" und ins England des Bergarbeiterstreiks.
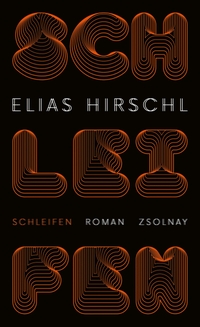 Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: Schleifen